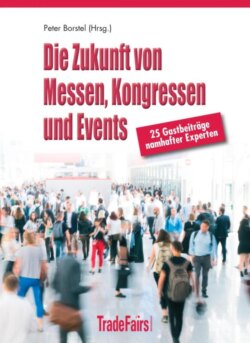Читать книгу Die Zukunft von Messen, Kongressen und Events - Peter Borstel (Hrsg.) und 28 Top-Experten - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wachstum durch Vertrieb: Zur Neuausrichtung von Messen
ОглавлениеWOLFRAM N. DIENER
Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Düsseldorf
Die Coronakrise ist sicherlich ein harter Einschnitt für Messegesellschaften, ihre Partner, Dienstleister – für alle, die von Messen leben. Doch das Ende scheint absehbar. Anders sieht es bei den Trends aus, die sich schon vor der Pandemie abgezeichnet haben: Seit längerem stagniert am Messeplatz Deutschland der Flächenverkauf, der den Großteil der Umsätze einer Messe ausmacht. Betriebswirtschaftlich betrachtet müssen Messeunternehmen neue Erlösquellen erschließen, wenn sie künftig weiter Wachstum erzielen möchten – und ihr Mandat erfüllen wollen: für die von den öffentlichen Anteilseignern gewünschte Umwegrentabilität zu sorgen. Veränderte Formate und Services können dazu beitragen, indem sie Ausstellern dazu verhelfen, den Return on Investment (ROI) ihrer Messebeteiligungen zu erhöhen. Denn: Verglichen mit vielen Emerging Markets hat in Deutschland der vertriebliche Charakter von Messen abgenommen. Damit stellt sich zunehmend die Frage von Ziel und Zweck der Präsenzmessen.
Um mit etablierten Nationen gleich zu ziehen (oder diese sogar zu überholen), brauchen Wachstumsmärkte Maschinen und Technologie. Die dort herrschende Nachfrage sorgt bei großen Herstellern und Marktführern für leuchtende Augen – weil sie dort unmittelbar am Stand verkaufen, deutlich mehr als das in Deutschland der Fall ist. Solche Aufträge während einer Messe führen bei den Ausstellern zu einem besseren ROI; sie sind deshalb ein gutes Argument für erneute Beteiligungen. Der Selbstzweck deutscher Messen hat sich dagegen gewandelt: Es rücken verstärkt andere Messeziele in den Vordergrund, wie etwa das Networking, Information und Inspiration sowie die Präsentation von Weltneuheiten. Allerdings könnte es in der Nach-Corona-Zeit eine Rückbesinnung auf vertriebliche Ziele geben. Denn viele ausstellende Unternehmen haben während der Pandemie spürbare Einbußen hinnehmen müssen. Da erscheint das Ziel „Geld in die Kasse“ bei einer Messebeteiligung akut wichtiger als die Pflege des Firmenimages oder des Netzwerkes. Andere Regionen wie die USA oder China machen es vor, wie sich Messen auf das Wesentliche konzentrieren – es muss allerdings angemerkt werden, dass ein Emerging Market wie China eine andere Nachfragedynamik entwickelt.
Eine weitere Herausforderung ist die abnehmende Verweildauer von Messebesuchern. Die gefühlte Betriebsamkeit in den Hallen und Gängen ist in den letzten Jahren tendenziell geringer geworden. Einerseits hat das einen negativen psychologischen Effekt, weil Aussteller dies bewusst oder unterbewusst wahrnehmen: Wenn gefühlt alle zehn Minuten ein Besucher am Stand vorbeiläuft, kommt kein richtiges Messefeeling auf. Dann wird schnell der Nutzen des Auftritts hinterfragt. Auch geht eine geringere Verweildauer von Einkäufern auf Messen oft mit weniger Geschäft einher. Für positive Effekte könnte da die Verkürzung der Messelaufzeit sorgen, um so die Besucherzahl pro Tag zu erhöhen. Wichtig ist es ebenso, für eine gute Zirkulation der Besucher in den Hallen und Gängen zu sorgen. Und noch eine Entwicklung lässt sich auf den Messen in Europa und Nordamerika beobachten: Das Durchschnittsalter der Messebesucher steigt stetig an. Teilweise ist das soziodemografisch erklärbar, aber nicht nur. Messen haben sich zu Informations- und Kommunikationsplattformen von Entscheidern entwickelt – und diese bringen meist eine gewisse Berufserfahrung sowie ein entsprechendes Alter mit. Auf Messen treffen sie sich und tauschen sich aus. Dies geschieht jedoch zeitlich begrenzt. Gleichzeitig suchen Entscheider alternative Einkaufsmöglichkeiten, anstatt den ganzen Tag in der Messehalle zu verbringen. Dies führt ebenfalls zu einer insgesamt niedrigeren Verweildauer der Besucher. Die erwähnten Herausforderungen müssen sich konsequenterweise auf künftige Messekonzepte auswirken. Dabei geht es um die Frage, wie sich diese negativen Trends verlangsamen lassen.
Künftige Formate
Die Ergänzung von Präsenzmessen durch digitale Formate wird sich – auch durch die aktuelle Situation – beschleunigen. Der Knackpunkt ist jedoch, dass digitale Veranstaltungen auf der Ertragsseite derzeit noch nicht so gut funktionieren. Blicken wir auf die weltweit führende Medizintechnikmesse Medica bei uns in Düsseldorf. Normalerweise versammelt sie einschließlich der Compamed fast 6.500 Aussteller. Bei der coronabedingt digital durchgeführten Ausgabe im November 2020 buchten rund 1.500 Firmen entsprechende Pakete. Sie bezahlten jeweils 3.500 Euro, um online vertreten zu sein und erzeugten gemeinsam einen Umsatz von rund fünf Millionen Euro – ein Bruchteil dessen, was bei der in erster Linie „physischen“ Medica umgesetzt wird. Und dies ist immer noch deutlich mehr als bei anderen digitalen Events.
Positiver Ausblick: Ausgelöst durch die Pandemie und die bereits zuvor zurückgegangene Geschäftsreisetätigkeit dürfte es einen Riesenschub auf technischer Seite geben. Aussteller werden eher bereit sein, Geld für nutzerfreundlichere digitale Angebote auszugeben, um ihre relevanten Zielgruppen zu erreichen. Einerseits könnte sich das positiv auf die Einnahmen von Veranstaltern auswirken. Andererseits erscheinen die von Präsenzmessen gewohnten Erlöse noch in weiter Ferne. Für uns als Messe Düsseldorf bedeutet diese Erkenntnis, dass es digitale Ereignisse oder Elemente nur messebegleitend geben wird. Die Zukunft liegt auch aus der Kundenperspektive (sowohl für Aussteller als auch für Besucher) in medienübergreifenden beziehungsweise hybriden Formaten. Das Digitale wird schließlich ein immer größerer und unverzichtbarer Bestandteil des (Geschäfts-)Lebens – und dies wird zu immer digitaler aufgestellten Veranstaltungen führen. Gleichzeitig bieten Präsenzmessen den „Faktor Mensch“, der unerlässlich ist, um Vertrauen zu schaffen – die härteste Währung in der Wirtschaft. Gerade in digitalen Zeiten wird der persönliche Kontakt daher wichtiger.
Ohnehin wird die Trennschärfe zwischen digitalen und rein physischen Elementen abnehmen. Nehmen wir Branchen, in denen die internationale Leitmesse nur alle zwei oder drei Jahre durchgeführt wird. Hier können hybride Ergänzungen die Community auch in den langen Zwischenzeiträumen erreichen. Eine große Chance liegt ebenso in der immensen Reichweite hybrider Konzepte, die helfen kann, neue Zielgruppen zu erobern. Das gilt nicht zuletzt für neu in den Markt tretende Akteure aus Schwellenländern. Stellen wir uns einen (fiktiven) Ingenieur aus Bangalore vor, der gerade ein Unternehmen gegründet hat und über wenig Geld verfügt. Aus diesem Grund kann er sich die Reise zu einer Maschinenmesse in Düsseldorf erst in ein paar Jahren leisten. Bis es soweit ist, hat er die Möglichkeit, zunächst eine digitale Version dieser Messe zu besuchen – und wird idealerweise dadurch „heiß gemacht“, unbedingt das reale Event sehen zu wollen.
Ein Schlagwort, das in den letzten Jahren häufig zu hören war, ist „Erlebnisorientierung“. Dabei geht es weniger darum, vermeintlich spektakuläre Einrichtungen oder Inszenierungen auf Messen zu bringen. Vielmehr sind einfache, aber positive Erlebnisse gefragt. Veranstalter sollten davon ausgehen, dass Geschäftsleute bei ihren Bedürfnissen prinzipiell ähnlich ticken wie Normalverbraucher. Sie möchten sich wohlfühlen, sich nicht abgekämpft durch die Hallen schleppen und in einem dunklen Restaurant essen. Das bedeutet, sich auf ein bequemes Sofa setzen zu können und ohne Lärm entspannt einen Latte Macchiato zu trinken. Wenn dann noch Tageslicht einfällt und das WiFi perfekt funktioniert, sind die meisten mit sich und der Welt zufrieden. Künftige Formate haben solche Ruhezonen und verbesserte Gastronomieangebote zu berücksichtigen, um Besucher weiterhin an das Medium Messe zu binden.
Präsenz oft unverzichtbar
Die hybride Zukunft birgt also vielversprechende Optionen. Aber was bedeutet das für das klassische Geschäftsmodell „Aussteller finanzieren eine Messe“? Hier wird die Entwicklung stark von der jeweiligen Branche und ihrer Struktur abhängen. Zum Glück haben wir in Düsseldorf viele Messen, auf denen Maschinen und ihre Anwendungsmöglichkeiten vorgeführt werden. Solche Maschinen fertigen Aussteller teilweise eigens als Exponate für die spezielle Messesituation. Digital lassen sich die Funktionsweisen kaum abbilden. Und wer als Unternehmensentscheider viel Geld in die Hand nimmt, um eine Maschine zu erwerben, will diese zuvor auch persönlich sehen und testen. Hinzu kommt, dass Hersteller technischer Produkte gerade bei Innovationen oder einer Weltpremiere nur eine ausgewählte Klientel erreichen wollen – und nicht der weltweiten Online-Community eine Einsicht in die verbesserten Optionen ihrer Neuheit gewähren möchten. Allzu sehr beschränkte Zugänge würden dann aufwändige Registrierungsprozesse mit sich bringen, die wiederum andere negative Effekte zur Folge hätten: Wer hat schon Lust, sich fünfmal am Tag einem komplizierten Anmeldeprozedere zu unterwerfen? Zudem lassen sich die Angebote von Ausstellern physisch wesentlich leichter vergleichen als dies mit digitalen Tools möglich ist. Das alles spricht auch in Zukunft zumindest im Maschinenbereich für die Präsenzmesse als Geschäftsmodell. Dieser klassische Ansatz bietet ebenso für Messen im hochwertigen Konsumgüterbereich wie Boote, Reisemobile und Caravans gute Überlebenschancen, wenn dort regelmäßig neues Produktdesign gezeigt wird. Letztlich sind die Bedarfe der jeweiligen Branchen unterschiedlich, da muss jeder Veranstalter selbst sein Erfolgsmodell finden.
Dass in nächster Zeit neue digitale Anbieter auf den Plan treten und erfolgreich virtuelle oder hybride Veranstaltungen anbieten, erscheint unwahrscheinlich. Ihnen fehlen die entsprechenden Bausteine, mit denen etablierte Messeunternehmen als Kapital überzeugen können: Netzwerke, Daten, Branchenexpertise und Reputation. Anders als technisches Know-how lassen sich diese drei Faktoren nicht mal eben schnell erwerben oder erarbeiten. Hier besteht die große Chance für Messegesellschaften, ihren Vorsprung zu nutzen. Das wird ihnen gelingen, wenn sie bestehende Veranstaltungen mittels neuer Technologien weiterentwickeln, um den künftigen Anforderungen und Bedürfnissen zu genügen.
Ähnliches gilt auch für die Gelände deutscher Messegesellschaften, die entsprechende Fixkosten mit sich bringen. Aufgrund der Besitzverhältnisse haben deutsche Messegesellschaften jedoch die Möglichkeit, in die digitale Infrastruktur zu investieren. So können sie die oft anspruchsvollen technologischen Anforderungen von Gastveranstaltern erfüllen – und sich einen echten Wettbewerbsvorteil im Kampf um externe Veranstaltungen verschaffen. Natürlich profitieren auch die eigenen Messen davon, werden dadurch noch attraktiver für Aussteller und Besucher.
Digitale Hard- und Software
Grundsätzlich muss die Veranstaltungs-Infrastruktur digitaler werden. Und: Wenn es um Investitionen in die Messegelände geht, müssen die Veranstaltungsflächen multifunktionaler ticken, was mit veränderten Formaten zusammenhängt. In reifen und stark entwickelten Märkten werden sich Messen stärker spezialisieren und als „Special Interest“-Formate in Nischen gehen. Das muss sich auch in der Messearchitektur widerspiegeln: Es braucht Hallen, die kurzfristig ohne großen Aufwand umgebaut werden können – die sich so an die größere Variabilität der Veranstaltungsformate anpassen lassen. Neben der Infrastruktur werden auch die weicheren Faktoren davon profitieren. Mehr Digitalisierung ermöglicht zielgenauere Marketingangebote und eine bessere Effizienzmessung. Das hilft wiederum Ausstellern beim Verwirklichen ihrer Absatzziele. Der Datenschutz sollte kein Hindernis sein, hier hat sich der Optionsbutton mit einer Einverständniserklärung bewährt.
Letztlich bietet die Zukunft trotz aller Herausforderungen viele Möglichkeiten, das Erfolgsmodell Messe fortzuschreiben: Es gilt, den vertrieblichen Charakter zu stärken und hybride Chancen zu nutzen.