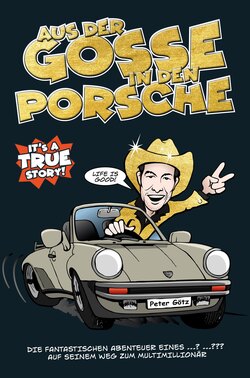Читать книгу Aus der Gosse in den Porsche - Peter Götz - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеHeimat
Der Tag, an dem ich feststellte, glücklich zu sein, war ein beliebiger Wochentag. Ich war zehn Jahre alt und hing mit meinen Kumpels Aaron, Murat, Mike, Tim und Andi draußen auf der Straße ab. Es war neu für mich, Freunde zu haben. Siebenmal hatte ich aufgrund familiärer Umstände umziehen müssen, was zur Folge hatte, dass ich fünfmal in eine andere Grundschule und einmal in eine neue Hauptschule wechselte. Ich hatte mich gar nicht getraut, mit jemandem näher befreundet zu sein. Wie lange hätte die Freundschaft gedauert? Aber jetzt schien endlich klar, wo ich hingehörte, konnte dieses von zahlreichen Kulturen geprägte Viertel meine Heimat nennen, und wusste, dass auch der nächste Tag ein guter Tag sein würde.
Dieses Unstete hatte bereits kurz nach meiner Geburt begonnen, als ich nicht bei meiner Mutter bleiben durfte, sondern in die Obhut meiner Oma kam. Nicht gerade ein leichter Start ins Leben, wenn auch die Vorgeschichte zu den Klassikern zählt: Hübsches blondes deutsches Fräulein verliebt sich in rassigen türkischen Gastarbeiter. Kaum wird sie schwanger, ist er weg!
Das scheint mir allerdings die falsche Pointe, denn meine Mutter lernte während der Schwangerschaft einen anderen Mann kennen: groß, blond und ein Nachkriegsarier, wie ich ihn später nannte. Wer sich von wem trennte? Keine Ahnung. Der blonde Mann jedenfalls wollte meine Mutter, aber nicht mich, den Sohn eines Türken!
Das Erinnerungsvermögen setzt bekanntlich mit drei oder vier Jahren ein. Deshalb weiß ich noch ganz genau, wie schrecklich es sich anfühlte, als mich meine Mutter wieder zu sich und den blonden Mann, mit dem sie mittlerweile verheiratet war, zurückholte. Nein, das ist viel zu milde ausgedrückt. Sie riss mich aus meiner neuen Familie förmlich heraus.
Oma Else, selbst Mutter von zehn Kindern, sei nicht gerade „liebevoll“ gewesen, wurde von meiner Tante und meinen zahlreichen Onkeln immer wieder erzählt. Und von meinem Großvater – der nicht mein richtiger Großvater war – wurde behauptet, er habe seine Kinder früher geschlagen. Ich konnte mir das kaum vorstellen, denn ich, das Nesthäkchen und der Enkel, schien Narrenfreiheit zu haben. Ich fühlte mich geliebt und sah die viel älteren Verwandten als meine Geschwister an. Und jetzt sollte das alles nicht mehr gelten?
Dass mich auch im neuen Umfeld Geschwister erwarteten, nahm ich zwar zur Kenntnis, tröstete mich jedoch nicht. Meine Halbschwester war ein Jahr nach mir zur Welt gekommen, mein Halbbruder zwölf Monate später. Er hatte im Mutterleib unter Sauerstoffmangel gelitten und galt als schwerstbehindert. Ich verstand das damals noch nicht, wunderte mich aber, dass er weder eigenständig essen noch mit mir reden konnte. Er lag einfach nur da und wartete darauf, dass er gewaschen, gewickelt und gefüttert wurde.
Er hätte eine Lebenserwartung zwischen vier und sechs Jahren, wurde gesagt. Für mich nur eine Zahl. Erst als Erwachsener wurde mir klar, dass sein Alter von letztendlich siebenunddreißig Jahren Mutters hingebungsvoller Pflege zu verdanken war.
Wie soll ich ein Familienleben beschreiben, das nach außen hin Wohlstand in Form von Haus und dickem Auto demonstrierte, im Inneren jedoch von Angst und Gewalt beherrscht wurde? Meine Mutter sieht es mir hoffentlich nach, denn meine Sicht der Dinge scheint eine andere als die der restlichen Familie. Wenn ich an diese Zeit denke, wird mir noch heute ganz wirr im Kopf. Hatte mein Stiefvater nur mich regelmäßig geschlagen? Galten nur für seinen Stiefsohn bestimmte Regeln und für seine eigene Tochter nicht? Seinen schwerkranken Sohn lasse ich hier mal außen vor.
Die Atmosphäre war stets angespannt und eigentlich eine Katastrophe. Wie ich sie damals für mich benannte, kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich fand ich keine Worte dafür, sondern trug eine ständige Angst in mir, verbunden mit Aggressionen gegen alles und jeden.
Einmal fehlten angeblich fünf D-Mark im Geldbeutel meines Stiefvaters. Für ihn schien sofort klar, wer sie „geklaut“ hatte. Natürlich ich. Ohne mich anzuhören, zog er seinen Gürtel aus dem Hosenbund, legte mich übers Knie und versohlte mir den Hintern.
In meiner Erinnerung waren Gewaltausbrüche dieser Art an der Tagesordnung, so als bräuchte er ein Ventil für seinen Frust. Dass er Alkoholiker war, erfuhr ich erst Jahre später.
Während dieser Zeit fanden die zahlreichen Umzüge statt. Ich war nicht gut darin, mich immer wieder auf neue Mitschüler, unbekannte Lehrer und eine mir fremde Umgebung einzustellen. Und an gute Schulnoten war unter diesen Umständen nicht zu denken.
Meine Mutter konnte meine innere Zerrissenheit nicht ausgleichen. Sie schien mit der schwierigen Familiensituation überfordert. Dazu der plötzlich aufwallende Zorn ihres Mannes, unter dem auch sie zu leiden hatte. Wir mussten höllisch aufpassen, denn ehe wir uns versahen, kippte die Stimmung und der Tag war gelaufen.
Und dann geschah etwas, das ich kaum für möglich gehalten hätte und das alles verändern sollte. Meine Mutter trennte sich von ihrem Mann. Meine Schwester kam ins Internat – so die offizielle Version. Tatsächlich wurde sie bei einer Pflegefamilie untergebracht. Mein kranker Bruder blieb bei meiner Mutter und ich durfte endlich wieder zu meiner Oma zurück.
Der Wechsel fiel mir leicht. Ich hatte ihn ja geradezu herbeigesehnt. Eine Bindung zu meiner Mutter hatte ich damals nicht, und wenn ich meine Gefühle hätte beschreiben müssen, wäre mir dazu nichts eingefallen. Das klingt traurig, aber so war es.
Die meisten Onkel waren mittlerweile bei meiner Oma ausgezogen, und meine Tante Mia, die einzige in der Familie mit einem richtigen Schulabschluss (Hauptschule), lebte ebenfalls nicht mehr dort. Aus heutiger Sicht schienen fast alle mit jungen Jahren die Flucht von der Familie weg ergriffen zu haben. Hilfsarbeiter wurden auf dem Arbeitsmarkt gesucht und Gelegenheitsjobs gab es fast überall. Nur Onkel Oliver wohnte noch zu Hause, damals etwa sechzehn Jahre alt und für mich tatsächlich wie ein Bruder. Otto, Benno und die anderen kamen immer mal sporadisch und nur für kurze Zeit zurück, wenn eine Beziehung auseinandergegangen oder eine angemietete Wohnung gekündigt worden war. Ergab sich eine neue Lebensperspektive, zogen sie sofort wieder aus.
Meine Oma war das Familienoberhaupt. Ich sehe sie noch heute vor mir, damals Anfang fünfzig, mit ergrauten Haaren und in einer Kittelschürze. Dieser Hausfrauen-Uniform aus Baumwolle, Knopfleiste vorne, Arme frei, klein geblümt oder mit Karos. Sie pflegte meinen kränklichen Großvater, der zwischendurch immer mal wieder in ein Krankenhaus eingewiesen wurde.
Wir lebten in sehr einfachen Verhältnissen, und die Unterstützung vom Sozialamt reichte hinten und vorne nicht. Mitte des Monats, wenn das Geld endgültig ausgegangen war, wurde meine Oma regelmäßig krank. Sie lag dann im Bett und Opa, Onkel Oliver und ich mussten zusehen, wie wir uns selbst versorgten.
Und doch fühlte ich mich glücklich mit dieser „manchmal kranken“ Großmutter, dem pflegebedürftigen Opa, dem Onkel, den ich als Bruder ansah, und in dieser ärmlichen Wohnung, in der der Ofen im Badezimmer befeuert werden musste, um warmes Wasser zu haben.
Meiner Oma schien es egal, ob ich rechtzeitig zur Schule ging, Hausaufgaben machte und wie ich den restlichen Tag rumbekam. Doch sie achtete darauf, dass ich den Menschen in unserem Umfeld respektvoll begegnete. Anfangs sah ich keinen Sinn darin, die Nachbarn im Haus zu grüßen. Ich kannte die Leute ja kaum. Doch da bekam ich was zu hören: „Du hast dich zu benehmen, verstehst du? Guten Morgen, guten Tag, Hallo … das ist das Mindeste, was ich von dir verlange. Sonst kriegst du es mit mir zu tun!“ Sie rollte das R, wie es nur ein Franke kann, und sprach das K so weich aus, dass es wie von selbst die Kehle herunterrutschte.
Ich weiß nicht, ob diese erzieherische Maßnahme mich zum Nachdenken brachte. Doch ich hörte auf, die Ratschläge der Erwachsenen grundsätzlich infrage zu stellen oder – schlimmer noch – mich gegen sie aufzulehnen. Immer öfter gab es Situationen, in denen ich die Worte verinnerlichte oder im Nachhinein dachte: Ah, der hat ja doch recht gehabt. Ich begann, die Lebenserfahrung der Älteren anzuerkennen, manchmal jedenfalls. Diese Einstellung hörte im Klassenzimmer schlagartig auf. Die Lehrer konnten mir viel erzählen. Reflexartig nahm ich meine gewohnt aggressive und ablehnende Haltung ein. Entsprechend mies waren meine Noten: Deutsch fünf, Diktat sechs, Mathematik unterirdisch.
Einmal bekam ich eine Sieben im Diktat, weil der Lehrer sich keinen Rat mehr wusste, wie er die Aneinanderreihung völlig absurd geschriebener Worte beurteilen sollte. „Lass das zu Hause unterschreiben“, sagte er mit versteinertem Gesicht. Seine Stimme klang erschöpft, vielleicht sogar verzweifelt. Er schien sich keine Illusionen mehr zu machen, mich zu einem einigermaßen akzeptablen Hochdeutsch zu bewegen. Ich sprach den fränkischen Dialekt so aggressiv, wie ich mich den Lehrern gegenüber verhielt. Und wenn ich schrieb, ignorierte ich jeweils das T, bediente mich stattdessen des D, ersetzte P durch B und machte mit dem K, was ich wollte. Eines meiner Lieblingsworte war Schdroufzeddl. Das hochdeutsche „Strafzettel“ dagegen fand ich lächerlich. Fei gscheid bled gefiel mir ebenfalls gut, alleine schon der Widerspruch an sich, (gescheit blöd). Oder Geh kumm, gämmer (Lass uns gehen).
Meine Oma dachte, ich wollte sie verarschen, als ich ihr das missratene Diktat mit der Note Sieben vorlegte. Trotzdem unterschrieb sie es. Sie ging wohl davon aus, dass ich es trotz schlechter Noten zu was bringen würde. Immerhin schlugen sich ihre zehn erwachsenen Kinder ja auch tapfer durchs Leben, und die meisten hatten nicht mal einen Hauptschulabschluss geschafft, sondern waren zur Sonderschule gegangen.
Für mich spielte es keine Rolle, ob sich Oma kümmerte
oder nicht. Regeln waren mir fremd, außer der, dass ich im Sommer zu Hause sein musste, sobald die Straßenbeleuchtung anging, und im Winter, kurz bevor es dunkel wurde. Wann ich mich schlafen legte, interessierte keinen, und ob ich frühstückte und wie ich zur Schule kam, ebenfalls nicht. Hauptsache ich schwänzte nicht. Die Hausaufgaben wurden dann wieder zur Nebensache erklärt.
Gewohnt, früh selbstständig zu sein, kam ich alleine zurecht. Einige Freunde aus dem gleichen Viertel, die unter ähnlichen Verhältnissen aufwuchsen, konnten damit weniger gut umgehen und gerieten schon mal auf die schiefe Bahn. Andere wiederum verhielten sich ähnlich diszipliniert und zogen mich mit. Deshalb erschien ich wohl niemals zu spät zum Unterricht.
Während ich das schreibe, kommen mir reflexartig die Erinnerungen. Wie lief damals so ein Schultag eigentlich ab? Da war zunächst der Wecker, den ich mir abends gestellt hatte und der um halb sieben Uhr morgens klingelte. Ich streckte mich ein wenig, bevor ich aufstand, ging ins Badezimmer. Hielt mich dort aber nur kurz auf, fürs Nötigste halt. Dann kochte ich Tee und schmierte mir ein Brot mit Margarine und Marmelade. Manchmal legte ich Wurstscheiben darauf. Meist am Monatsanfang, wenn Oma noch genug Geld vom Amt hatte und beim Einkaufen nicht sparen musste. Anschließend holte ich die Zeitung vom Balkon, die der Zeitungsausträger, da wir parterre wohnten, durch die Ritzen des Geländers gesteckt hatte.
Ich las bereits als Zehnjähriger beim Frühstück die Zeitung. Jedenfalls die Überschriften der Sportseiten und der Regionalnachrichten, manchmal auch vom politischen Teil. Als ich noch bei meiner Mutter gelebt hatte, hatte ich abends die Tagesschau geguckt. Einmal war vom Kalten Krieg zwischen den USA und der UdSSR die Rede gewesen und dass die beiden Staaten sich mit ihren Atomwaffen gegenseitig auslöschen könnten. Die blanke Angst war in mir aufgestiegen. Aber vor allem das Wort „Kalt“, mit dem ich noch nichts anfangen konnte, hatte mich erschreckt. Seitdem wollte ich wissen, wie sich das mit diesem seltsamen Krieg und den mächtigen Raketen verhielt, und wie alles weiterging.
Um halb acht legte ich die Zeitung zur Seite, zog meine Jacke an, nahm den gepackten Schulranzen und machte mich davon. Gleichzeitig verließ Onkel Oliver die Wohnung, falls er es geschafft hatte, pünktlich aufzustehen. Anfangs ging er noch zur Schule, später dann zur Arbeit. Oma lag noch im Bett oder kümmerte sich um den kranken Opa. Meist bekam ich sie frühmorgens nicht zu Gesicht.
Der kurze Schulweg, den meine Freunde und ich zu Fuß zurücklegten, verlief fast immer lustig. Wir hatten uns viel zu erzählen, schräge Geschichten, die wir irgendwo aufgeschnappt hatten. Nur über Hausaufgaben sprachen wir nicht, und wenn, blockte ich das Thema sogleich ab. Hausaufgaben. Hatten wir wirklich Hausaufgaben aufgehabt?
Im Klassenzimmer angekommen, fühlte ich mich auf einmal sehr müde. Die Müdigkeit hielt während des Unterrichts an. Was interessierte mich, wie Re-gen-wet-ter getrennt wurde. Ich schrieb die Worte ja sowieso, wie ich wollte. Und im Addieren von Zahlenreihen sah ich keinen Sinn. Dabei hätte meine Oma ein Vorbild für mich sein können, sie war mathematisch hochintelligent. Nur mit dem Umsetzen in die Praxis haperte es bei ihr, was hieß, wenn sie Geld hatte, gab sie es sogleich aus.
Der Heimweg verlief genauso lustig wie am Morgen. Wir zogen über die Lehrer her. Witzelten über bestimmte Mädchen, die unserer Meinung nach immer nur herumgackerten. Beklagten uns über den öden Unterricht.
Wieder zu Hause, hatte Großmutter gekocht oder ich suchte mir etwas Essbares aus dem Kühlschrank zusammen. Anschließend ging ich wieder raus, auf die Straße, um mit meinen Kumpels am Spielplatz abzuhängen oder mit BMX-Rädern herumzufahren. Spätestens jetzt war ich hellwach.
Ich mochte das Viertel, auch wenn offiziell von „sozialer Armut, niedrigem Bildungsniveau, Migrantenfamilien, Arbeitslosigkeit, schlechter Bausubstanz und relativ vielen Problemfamilien“ gesprochen wurde. Selbst von „sozialem Brennpunkt“ war in den Medien die Rede. Aber was sagte mir das? Nichts. Ich hatte hier endlich Freunde gefunden und es war mir egal, ob sie Türken, Kurden, Araber, Deutsche, Sinti oder Roma waren.
Für mich schien alles völlig normal, und mit Begriffen wie multikulturell und Migrationshintergrund konnte ich nichts anfangen. Erst als erwachsener junger Mann erkannte ich, wie wichtig die verschiedenen kulturellen Einflüsse auf mich waren. Sie lehrten mich, respektvoll gegenüber jedem Mitbürger zu sein. Zeigten aber auch, dass Freundschaft und Toleranz ihre Grenzen hatten. Die kulturellen Einflüsse der Älteren auf die Jungen waren zu groß, als dass eine Anpassung an westliche Gepflogenheiten so ohne Weiteres akzeptiert worden wäre. Letztendlich kochte jeder sein eigenes Süppchen. Deshalb sage ich heute: „Lasst die Leute mal so sein, wie sie sind!“ Es wird noch viele Generationen brauchen, bis sich die Kulturen wirklich vermischen.
Das Aufwachsen mit völlig unterschiedlichen Menschen hat mein Leben bereichert und mich in meiner Persönlichkeit geprägt. Vielleicht besitze ich deshalb eine so gute Menschenkenntnis, kann nach wenigen Minuten analysieren, wen ich glaube, vor mir zu haben, wie mein Geschäftspartner tickt und wie die Verhandlung enden wird.
Ich habe von jeder Kultur etwas für mich mitgenommen, und bei vielen etwas Ähnliches entdeckt, das mir gut gefiel: nämlich Familienzusammenhalt und die Achtung vor älteren Menschen. Und ja, die Kinder und Jugendlichen im Viertel galten als aggressiv, waren es aber nicht untereinander. Nur wenn sich jemand von außerhalb einmischen wollte, musste er sich auf was gefasst machen. Da schlugen gewisse Jungs schon mal zu und verteidigten ihr Revier. Ich selbst hielt mich in solchen Situationen lieber zurück oder versuchte, die Streitereien zu schlichten.
Klaus, einer meiner Freunde, den ich am längsten kenne (wir trafen uns nach längerer Pause an einer anderen Grundschule wieder), kann sicher ein Lied davon singen. Dabei fällt mir zu unserer Kindheit eine harmlose Episode ein. Ich lebte damals noch bei meiner Mutter, und sie schickte uns gemeinsam los, um beim Metzger, etwa fünf-hundert Meter entfernt, Leberwurst zu kaufen. Auf dem Weg dorthin verhielten wir uns ziemlich albern, sodass wir den eigentlichen Auftrag völlig vergaßen. Als wir von der Verkäuferin gefragt wurden, was es denn sein dürfe, stotterten wir herum. Weil uns nichts mehr einfiel, trotte-ten wir wieder davon und fragten bei meiner Mutter noch einmal nach. Das ging so dreimal hin und her, bis Mutter uns – sichtlich genervt – das Wort Leberwurst aufschrieb. Wir legten den Zettel beim Metzger vor und dann klappte es endlich mit dem Einkauf.