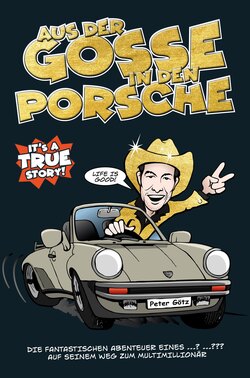Читать книгу Aus der Gosse in den Porsche - Peter Götz - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеTag für Tag in der Gitterbox
Ich glaube kaum, dass mich jemand aus meiner Familie einmal gefragt hat, was ich später werden möchte. Und wenn, wäre mir diese Frage sicher verhasst gewesen, denn als Fünfzehnjähriger hätte ich darauf keine Antwort gewusst. In der neunten Klasse wurde mir diese Frage dann aber doch gestellt. Ich zuckte hilflos mit den Schultern. Der Lehrer versuchte, mir auf die Sprünge zu helfen: „Vielleicht was mit Technik? Was mit Menschen? Mit Medien …?“
Am liebsten hätte ich eine weiterführende Schule besucht. Doch ein Wirtschaftsgymnasium wäre trotz meiner mittlerweile super Noten – in allen Fächern eine Eins, bis auf Deutsch und Englisch – aus finanziellen Gründen gar nicht möglich gewesen. Es war kein Geld da, um es auszugeben. Ich musste welches verdienen.
Die Gespräche in der Schule brachten mich nicht weiter, und als ich meiner Oma davon erzählte, meinte sie ungewohnt geschäftig: „Du, da fahr‘n wir zum Arbeitsamt, dort gibt‘s eine Beratungsstelle.“
Der Berufsberater war mindestens sechzig, jedenfalls schien er mir uralt. Würde mir dieser alte Mann mit einer bestimmt völlig anderen Denkweise wirklich helfen können?
Oma und ich hatten vor seinem Schreibtisch Platz genommen und warteten gespannt, was er uns zu sagen hatten. Er sah sich mein Zwischenzeugnis an, schien zufrieden. „Ja Bursch, das sind alles sehr gute Noten!“ Er überlegte einen Moment: „Du musst was mit Elektronik machen. Der Elektronik gehört die Zukunft.“
Ich nickte zustimmend, brachte aber kein Wort heraus. Was hätte ich auch sagen sollen?
„Interessieren dich Computer?“
Endlich eine Frage, die ich klar mit Ja beantworten konnte.
„Optimal. Da hab ich was für dich.“ Er suchte in seinen Unterlagen und holte eine Broschüre hervor, in der er kurz las. „Interessierst du dich mehr fürs Grobe oder fürs Feine?“
Eine seltsame Frage, wie ich fand, die ich mit „fürs Grobe“ beantwortete.
„Alles klar, dann machst du Energieanlagenelektroniker.“
Der Beruf klang modern, auch wenn ich mir nichts darunter vorstellen konnte. „Und, was ist das?“
„Da arbeitest du nach der Ausbildung als hoch qualifizierte Fachkraft mit umfangreichem Wissen über die Wirkungsweise sowohl elektrischer Energieanlagen selbst als auch über Maschinen und Anlagen, die durch elektrische Motoren angetrieben werden.“ Nein, so erklärte er es nicht. Er sagte: „Da machst du was mit Computern und Elektrik.“
Er druckte mir drei Adressen aus, Firmen, bei denen ich mich bewerben sollte: Bosch, Siemens und die Deutsche Bundesbahn.
Meine Oma schien entzückt über den Vorschlag und sah mich bereits als Chef in einer Vorstandsetage. In ihren Augen war ich zu Höherem berufen. Schließlich würde ich nicht nur die Hauptschule erfolgreich abschließen, sondern eine richtige Ausbildung machen. Das hatte noch keiner aus ihrer Familie geschafft.
Mangels Alternativen – mir fiel wirklich nichts ein, was ich hätte lernen können oder mich interessiert hätte – schickte ich drei Bewerbungen raus, und wurde zweimal zum Eignungstest eingeladen. Mit den Fragen über Allgemeinwissen, Physik und Chemie kam ich noch klar. Bei den mathematischen Tests dagegen fühlte ich mich teilweise überfordert. Die Aufgaben schienen für Abiturienten gedacht. Es gab Begriffe, die kannte ich überhaupt nicht. Meine Chancen hätten sich womöglich in einem Vorstellungsgespräch erhöht, doch die Einstellung hing einzig und alleine von den Prüfungsergebnissen ab.
Bosch hatte sich überhaupt nicht mehr gemeldet, Siemens sagte mir ab, und von der Deutschen Bundesbahn rief mich jemand an: „Also Herr Götz, beim Test lief es ja nicht so super. Wir würden Ihnen daher gerne eine Ausbildung zum Industriemechaniker anbieten. Und wenn bei den Energieanlagenelektronikern keiner besser abschneidet, finden wir dort sicher noch eine Möglichkeit.“
Mir war es egal. Und als mich wenige Tage später ein weiterer Anruf erreichte, die Ausbildung zum Energieanlagenelektroniker würde jetzt doch klappen, konnte ich mich nicht so richtig freuen.
Am 1. September begann ich meine Ausbildung bei der Deutschen Bundesbahn. Meine Großmutter war begeistert und dachte bereits an das „Altersruhegeld“, das ich als verbeamteter Bahnmitarbeiter einmal erhalten würde. Nicht nur sie, meine gesamte Familie schien stolz auf mich. Ich wurde gefeiert, als hätte ich bereits eine beachtliche Karriere gemacht. Dabei war noch nicht einmal klar, ob ich den ersten Arbeitstag überleben würde. Wie sich schnell herausstellte, hatten alle anderen Auszubildenden Mittlere Reife oder Abitur. Ich schien der Einzige mit Hauptschulabschluss.
Falls ich mir vorgestellt hatte, sogleich in einem Betrieb oder irgendwo am Bau eingesetzt zu werden, hatte ich mich gründlich getäuscht. Die Bundesbahn bildete in einem Klassenzimmer aus, mit Gitterboxen für die handwerklichen Arbeiten: dreißig Azubis, täglich acht Stunden. Was hieß, viel lernen und viel Theorie.
Es gab an dieser Ausbildung nichts zu meckern. Wer hier einen hoch qualifizierten Ausbildungsplatz bekommen hatte, konnte froh darüber sein. Nur ich dachte morgens schon: Wie krieg ich bloß den Tag rum?
Ich stand um 4.30 Uhr auf. Nahm den Bus um 5.20 Uhr. Fuhr eine Stunde. Kam im Werk um 6.47 Uhr an. Zog mich um. Fing um 7 Uhr an und hatte um 15.45 Uhr Feierabend.
Obwohl ich keinen Bock auf die Lehre hatte, sie teilweise eine Qual für mich war, hielt ich durch. Ich war mir bewusst, dass mein Hauptschulabschluss eigentlich nicht gereicht hätte und ich Glück gehabt hatte, erkannte die Qualität der Ausbildung und das hohe Niveau. Die Chance wollte ich mir nicht entgehen lassen und ich tat alles, um die Prüfung später zu schaffen. Das war meine Motivation.
Ich verdiente fünfhundert D-Mark netto. Davon gab ich dreihundertfünfzig an meine Oma ab. Blieben mir noch einhundertfünfzig Mark. Ich dachte, dass sie jetzt endlich finanziell klarkäme. Sie bekam den Betrag ja zusätzlich zum Geld vom Sozialamt sowie dem Kindergeld für mich. Doch es reichte hinten und vorne nicht. Sie konnte zwar gut rechnen, gab aber stets mehr aus, als sie einnahm. Ihr fehlte das Fingerspitzengefühl, sich ihr Geld über den Monat hin einzuteilen.
Kurz vor meiner Abschlussprüfung wurde ich nachts von seltsamen Geräuschen geweckt. Ich dachte zuerst an Einbrecher, aber wer bricht schon in eine Sozialwohnung ein? Wir hatten ja nichts. Jedenfalls nichts, was sich gelohnt hätte mitzunehmen. Ich rieb mir die Augen, versuchte, mich an das Dunkel zu gewöhnen und erkannte meine Großmutter, direkt vor meinem Bett.
Ich richtete mich auf: „Oma, was ist los?“
„Du Bub, pass mal auf. Ich hab das Finanzielle mal nachgerechnet und ich glaub, du schuldest mir noch Geld.“
„Ich schulde dir … was? Lass gut sein, darüber sprechen wir morgen.“ Ich wollte mich auf die andere Seite drehen und weiterschlafen, doch Oma wurde bissig, fast aggressiv. Es kam eine Seite von ihr zum Vorschein, über die sich meine Onkel bei mir oft beschwert hatten. Eine Seite, die nichts mehr mit Fürsorge und großmütterlicher Liebe zu tun hatte, sondern nur noch den finanziellen Vorteil sah. Ich war nicht mehr der kleine Junge, den es zu umsorgen galt. Ich schien zu einem Goldesel geworden.
Am nächsten Tag wollte ich den nächtlichen Vorgang nicht gleich zum Thema machen. Auch Oma sprach ihn nicht sofort an. Ich spürte jedoch, etwas an ihrem Verhalten hatte sich verändert. Sie ging auf Distanz zu mir, beäugte mich, hinterfragte, was ich machte und für was ich mein Geld ausgab. Weil mir die einhundertfünfzig Mark monatlich nicht reichten, die mir noch übrig blieben, hatte ich einen Nebenjob. Doch auch das hinzuverdiente Geld brachte mich irgendwann finanziell ins Minus. Mein Konto war bis zum Anschlag überzogen. Ich erzählte meiner Oma davon, als wir abends in der Küche zusammensaßen. Sie sah mich an, fast so liebevoll wie früher, als ich noch ein Kind war, und dann sagte sie: „Ach Bub, du musst bedenken … Immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her.“ Ob es Zufall war, dass sie das sagte, oder ob Oma bereits wusste, was geschehen würde?
Ich sah sie an, ahnungslos, und dachte: Ey, du mit deinen Sprüchen. Die nutzen mir jetzt gar nichts.
Vollkommen falsch. Denn am nächsten Abend lag ein Umschlag für mich auf dem Tisch, der mit der Post gekommen war, Absender: Jugendamt Fürth.
„Ja, was ist das?“ Ich öffnete das Kuvert, faltete den Brief auseinander und las. Sinngemäß etwa: Sehr geehrter Herr Götz, Sie sind jetzt 18 Jahre alt und haben mit Ihrer Volljährigkeit die Möglichkeit, Unterhaltsansprüche in Höhe von insgesamt ca. 25.000 DM an ihren leiblichen Vater zu stellen.
Neben dem dringend benötigten Geld lieferte diese Tatsache zwei Aspekte für mich: Zum einen, ich kannte meinen Vater nicht. Ich hatte ihn bisher nicht kennengelernt und er schien sich auch nicht nach mir, seinem Sohn, erkundigt zu haben. Zum anderen lag meine Oma mit ihren Sprüchen mal wieder richtig. Immer wenn du denkst … Na ja, ich dachte, dass ich mit meiner Freundin Babsi darüber sprechen sollte. Ihr Onkel war Anwalt, und vielleicht könnte er sich für mich einsetzen.
Er setzte sich für mich ein und erreichte, dass mein Vater begann, die geforderte Summe in monatlich kleinen Raten abzubezahlen.
Es hätte jetzt alles gut sein können, wenn sich die Aggressivität meiner Großmutter mir gegenüber nicht gesteigert hätte. Wir hatten uns gedanklich auseinandergelebt, oder hatte ich all die Jahre nicht bemerkt, dass sie auch eine böse, missgünstige Seite in sich trug. Erst jetzt fiel mir auf, wie sie über meine Onkel und meine Tante schimpfte und an fast jeder Person in ihrem Umfeld etwas auszusetzen hatte. Die Streitigkeiten häuften sich und irgendwann dachte ich: Ich halte das nicht mehr aus!
Ich fragte vorsichtig bei meiner Mutter an, ob ich nicht bei ihr wohnen könnte. Erklärte, dass ich zum Lernen für die recht schwierige Abschlussprüfung Ruhe bräuchte. Die neuerlichen Attacken von Oma seien unerträglich und würden die Atmosphäre zu Hause vergiften.
Meine Mutter schien nicht gerade begeistert, obwohl ihre zweite Ehe mittlerweile wieder geschieden war und sie als Single lebte. Mein behinderter Bruder und meine Schwester wohnten bei ihr, und die Drei-Zimmer-Wohnung war nicht besonders groß.
Ihr grimmiges Schweigen deutete ich als Zustimmung, und eines Abends zog ich bei meiner Großmutter aus. Obwohl … eigentlich trat ich die Flucht an. Ich gab vor, zu Bett zu gehen, verriegelte ganz gegen meine Gewohnheit die Zimmertür, nahm meine Sporttasche, die ich vorher mit dem Nötigsten gepackt hatte, und haute über das Parterrefenster ab.
Während ich durch die dunkle Nacht lief – meine Mutter wohnte nur wenige Straßen entfernt –, holte mich das schlechte Gewissen ein, schließlich hatten sich Oma und Opa all die Jahre liebevoll um mich gekümmert. Doch jetzt war ich kein Kind mehr und Oma sah nur noch den Geldgeber in mir. Ein Verhalten, das ihre leiblichen Kinder an ihr beklagt hatten und einer der Gründe, warum sie so früh ausgezogen waren.
Es tat mir leid, dass meine Schwester ihr Zimmer für mich aufgeben und nachts mit der Couch im Wohnzimmer vorliebnehmen musste. Mein kranker Bruder lag bei meiner Mutter im Schlafzimmer. Ab jetzt würde es eng.
Doch alles hat auch seine guten Seiten oder wie Oma gesagt hätte: Verurteile nicht den Tag schon am Morgen. Eine plötzliche Wende kommt meist dann, wenn du es gerade nicht erwartest.
Na ja, dass ich die Prüfung zum Energieanlagenelektroniker schaffen würde, hatte ich durchaus erwartet. Das schien nicht unbedingt eine Überraschung. Doch meine Mutter fand, während ich bei ihr lebte, eine neue Liebe. Einen zwar erheblich älteren, eigensinnigen, doch zuverlässigen Mann. Sie würde zweiundzwanzig Jahre mit ihm zusammen sein.