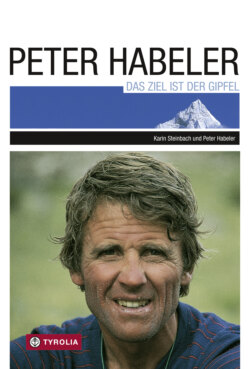Читать книгу Das Ziel ist der Gipfel - Peter Habeler - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеReinhold Messner in der steilen Nordwestwand des Hidden Peak
Ihr seid dann in einem Zug bis ins Lager 1 abgestiegen und wart am nächsten Tag wieder im Basislager. Vier Tage für einen Achttausender – wirklich eine elegante Geschichte.
Ich bin davon ausgegangen, dass wir das schaffen. Ich war sehr motiviert. Und abgesehen von meinen Migräneanfällen in Skardu und im Lager 1 ging es mir ausgezeichnet. Auch Reinhold war in Bestform, außerdem hatte er schon die Erfahrung vom Nanga Parbat und vom Manaslu. Nach unserem Erfolg am Hidden Peak lag es nahe, weitere Achttausender zu besteigen, und Reinhold schlug für 1977 den Dhaulagiri vor.
Warum seid ihr am Dhaulagiri gescheitert?
Das hatte mehrere Gründe. Zum einen das Wetter: Es schneite dauernd, die Verhältnisse waren schlecht. Außerdem hat unser Viererteam mit Otto Wiedmann und Mike Covington nicht ganz harmoniert. Für eine Wand wie die Dhaulagiri-Südwand, die mehr als 4000 Meter hoch ist, muss alles optimal stimmen. Sie wurde erst 1999, mehr als 20 Jahre nach uns, von Tomaž Humar erstbegangen.
Humar hat dem Alpinstil noch eins draufgesetzt, indem er allein ging. Reinhold Messner und du, ihr wart frühe Anhänger des Alpinstils im Himalaja. War das damals schon Strategie? Oder hat sich das einfach aus der Not ergeben, weil ihr euch eine große Expedition mit all diesem Aufwand an Organisation und Trägern gar nicht leisten konntet?
Das war schon Strategie. Wir wollten aus zweierlei Gründen klein bleiben. Erstens ist die Organisation bei einer kleinen Mannschaft leichter und zweitens die menschliche Seite unproblematischer. Wenn du dir die großen Expeditionen aus den Sechziger- und Siebzigerjahren anschaust, bei denen gab es doch fast jedes Mal Zores. Der eine will das, und der andere will das nicht, und der Dritte will überhaupt nicht, und der Vierte möchte es in einem Tag machen. Wir haben uns gesagt: Wir sind zwei, wir sind beide eigenständig, wir sind gut. Wir haben die Möglichkeit, diese hohen Berge zu besteigen, und zwar ohne Sauerstoff. Wir wussten, dass wir uns gegenseitig total aufeinander verlassen können. Die Kleinstexpedition mit Partnern, die ich gut kenne, hat sich als das am besten Machbare gezeigt. Nach dem Everest war ich nur noch in Kleinstexpeditionen unterwegs – außer 1984 am K2, und da hat es auch nicht funktioniert. Eine kleine Expedition ist schlagkräftig, aber die Teilnehmer müssen natürlich harmonieren.
Wieder zurück im Basislager – die Besteigung des Hidden Peak war einer der größten Erfolge von Peter Habeler und Reinhold Messner.
Am Everest wart ihr aber in eine größere Expedition eingebunden?
Ja, denn so schnell hätten wir für ihn gar keine Genehmigung bekommen. Deswegen schlossen wir uns einer bereits genehmigten Expedition an, der des Österreichischen Alpenvereins. Reinhold kannte Wolfgang Nairz, den Leiter, gut, mit ihm war er 1972 am Manaslu gewesen. Reinhold war auch die treibende Kraft bei der Everest-Besteigung ohne Sauerstoff, er war der Stratege. Und er wusste, in mir hat er einen kongenialen Partner, der mitmacht.
Allen Zweifeln zum Trotz: Am 8. Mai 1978 wird der Gipfel des höchsten Berges der Welt erstmals ohne künstlichen Sauerstoff erreicht.
Der aber nicht nur „mitmachte“, sondern, nachdem er seine Zweifel überwunden hatte, genauso zum Gipfel wollte wie er.
Genau. Ich war mir aber bis zum Südgipfel nicht sicher, ob wir es schaffen würden oder nicht. Es war neblig, es hat geweht, und vor allem mussten wir wahnsinnig viel spuren. Das Spuren war die Hölle. Wenn du bei jedem Schritt in diesem windgepressten Schnee bis zum Knie einbrichst, das kostet unheimlich viel Kraft. Vom Südgipfel an war ich dann überzeugt, ja, jetzt werden wir es machen. Reinhold kletterte den Hillary Step als Erster, weil er von oben filmen wollte. Der Grat ist steil, ausgesetzt, es geht sowohl nach Südwesten steil hinunter als auch nach Osten, auf die Kangshungseite. Das sind fast 3000 Meter bis auf den Kangshunggletscher. Wenn du da ausrutschst, bist du weg, und deinen Partner ziehst du mit.
Zu der Zeit war der Hillary Step ja nicht versichert – ihr seid also in Seilschaft geklettert und habt euch gegenseitig gesichert?
Nein, wir waren mit dem Seil verbunden und sind gleichzeitig gegangen. Wenn einer gefallen wäre, hätte der Zweite in die andere Seite des Grates springen müssen. Das wäre die einzige Rettung gewesen. Eine sehr theoretische. Heute ist das am Hillary Step kein Thema mehr, heute gehen da Fixseile hinauf, in die sich jeder einhängt. Wir hatten einen tief verschneiten Grat vor uns, wir wussten nicht, ob rechts eine Lawine abbricht oder links. Das war damals ganz anders. Kein einziges Fixseil. Nichts.
Deine Rutschpartie im Abstieg, Peter, war die wirklich so harmlos, wie du sie darstellst?
In meinen Augen war sie harmlos, weil es ein langsames, kontrolliertes Rutschen war, abgesehen vielleicht vom Schluss, als ich das letzte Stück mit dem kleinen Schneebrett hinaustransportiert wurde. Der Schneekeil, der sich zwischen meinen Beinen gebildet hatte, bremste mich. Ein Kind würde das vermutlich genauso machen.
War das eine bewusste Entscheidung oder eher etwas Instinktives?
Ich glaube, ich habe da ganz instinktiv gehandelt. Ich wollte so schnell wie möglich hinunter ins Lager, und auf diese Weise kam ich am schnellsten und am sichersten nach unten. Ich habe das in den Zillertaler Alpen auch manchmal so gemacht, habe mich einfach hingesetzt und bin langsam abgerutscht. Wichtig war nur, dass ich die Richtung zum Südsattel erwischte und nicht auf die Ostseite abdriftete, wo diese riesigen Mengen verfrachteten Schnees waren. Ich rutschte also in der Falllinie ab, stand auf, querte ein bisschen nach rechts, wo teilweise noch unsere Aufstiegsspuren sichtbar waren, setzte mich wieder hin, fuhr ein paar Meter ab, ging wieder Richtung Spur. Das war dieser einstündige Abstieg, der natürlich schon sehr schnell war.
Was hat euch die Sicherheit gegeben, dass ihr in dieser extremen Höhe ohne künstlichen Sauerstoff keine Schäden davontragen würdet?
Na ja, Sicherheit gab es da keine. Das waren ja genau unsere Bedenken: dass wir ohnmächtig werden, dass es irgendwo im Hirn einen Riegel umlegt und wir den Verstand verlieren. Das wusste man ja nicht, das mussten wir ausprobieren. Reinhold flog 1977, nach unserem Versuch am Dhaulagiri, mit dem Schweizer Piloten Emil Wick über den Everest, bis auf 9000 Meter hinauf, und setzte dabei keine Sauerstoffmaske auf. Das ging, und das machte uns Mut. Und wir wussten – Reinhold vom Nanga Parbat und vom Manaslu, ich vom Hidden Peak –, dass wir auch oberhalb von 8000 Metern noch Reserven hatten.
War der Everest der Beginn deiner Karriere, weil du durch diese Besteigung weltbekannt wurdest, oder war er ihr Höhepunkt?
Der Everest war noch lange nicht mein Höhepunkt. Am Everest war ich längst nicht so leistungsfähig wie bei meinen späteren Expeditionen. Aber natürlich verdanke ich ihm viel. Unsere Besteigung hat mir gezeigt, dass alle anderen Achttausender ohne Sauerstoff zu machen sind. Am Everest war ich durch die Ungewissheit noch gehandicapt, danach war ich freier. Er hat mir sozusagen die Angst vor weiteren Achttausender-Besteigungen genommen. Auf der anderen Seite hat er meine Karriere, wenn man das so sagen will, für etwa sechs Jahre unterbrochen. Ich war bis 1984 auf keinem Achttausender mehr. Ich habe sehr viele Vorträge gehalten, ich habe mein Buch „Der einsame Sieg“ geschrieben, ich habe meine Alpinschule ausgebaut, mein privates Leben orientiert – habe ein Haus gebaut, war für die Familie da. Reinhold machte nach dem Everest sofort weiter, nutzte seine gute Akklimatisation, um im gleichen Sommer den Alleingang am Nanga Parbat zu machen. Und hatte im Jahr 1986 alle 14 Achttausender bestiegen.
Du dagegen hast das Publikumsinteresse nach eurer Besteigung ohne Sauerstoff genutzt, um mit deinen Vorträgen und dem Buch Geld zu verdienen.
Da darf man natürlich nicht vergessen, dass ich in relativ armen Verhältnissen aufgewachsen bin. Das Geld, das ich verdiente, steckte ich in Alpinausrüstung und Expeditionen. Mein Familienleben mit Regina und Christian begann in einer kleinen Wohnung mit einem Zimmer und einer Wohnküche. Ich habe doch nie geglaubt, dass ich einmal in der Lage bin, in Finkenberg ein Haus zu bauen. Das war dann eben auch wichtig für mich, und das hat der Everest ermöglicht. Ein Haus bauen, einen Buben haben wir, einen Baum pflanzen. Das sind doch letzten Endes wichtigere Dinge als das Bergsteigen. Man macht sich ja auch über die Zukunft Gedanken. Die Nachfrage war da, und ich habe den Leuten gern meine Bilder gezeigt und von unseren Erfahrungen berichtet.
Du bist 1990 noch einmal an den Everest gefahren und hast den Nordgrat probiert. Du warst 2000 mit der Amerikanerin Christine Boskoff auf der Südseite. Was war deine Motivation?
1990 wurde ich von amerikanischen Freunden gebeten, Klienten über die Nordseite auf den Everest zu führen. Schon beim Anmarsch über den Rongbukgletscher stellte sich heraus, dass sie völlig überfordert waren. Wir Bergführer konnten dann schlecht allein die Route machen und die Klienten im Basislager lassen, also brachen wir ab. 2000 war das anders, da wollte ich an meine alten Expeditionen anknüpfen, wollte es vielleicht auch einfach „noch mal wissen“. Nach dem Tod von Scott Fischer während der Everest-Tragödie von 1996 hatte Chris Boskoff dessen Unternehmen Mountain Madness übernommen. Weil eine kommerzielle Expedition zum Everest geplant war, lag es nahe, dass Chris und ich uns anschlossen, um den Gipfel ohne Sauerstoff zu besteigen. Ich hatte im Vorfeld viel trainiert und war gut drauf. Aber wir haben uns wohl durch zu häufiges Auf- und Absteigen beide überfordert. Zuerst wurde Chris krank, hatte ein schweres Höhenlungenödem, und dann hat es mich noch mit einer Lungenentzündung erwischt. Sie erholte sich dann so weit, dass sie zum Gipfel gehen konnte, allerdings mit Sauerstoff. Ich hatte da schon Abstand genommen von einer Besteigung. Ich atmete nicht gut, und Sauerstoff kam für mich nicht in Frage.
Christine Boskoff kam im Dezember 2006 im chinesischen Himalaja ums Leben, zusammen mit ihrem Partner Charlie Fowler. Vermutlich wurden die beiden von einer Lawine verschüttet; bisher wurde nur seine Leiche gefunden. Wie geht es dir, wenn du solche Nachrichten hörst?
Es tut mir furchtbar leid, dass sie gestorben ist. Chris war eine tolle Bergsteigerin, sie hat sich immer wieder überwunden, sprang immer wieder über einen neuen Zaun, suchte sich wieder neue Herausforderungen. Sie hatte einen unwahrscheinlichen Ehrgeiz; vielleicht auch, um sich mit ihren Besteigungen einen Namen zu machen, um letztendlich ihr Geschäft zu pushen. Vielleicht ist ihr das zum Verhängnis geworden.
Nun war Chris ja nicht die Erste aus deinem Freundeskreis, die beim Bergsteigen ums Leben kam. Im Lauf deines Lebens warst du immer wieder damit konfrontiert, dass Leute, die du mal mehr, mal weniger gut kanntest, tödlich verunglückten. Was löst das aus in dir?
So eine Nachricht löst natürlich erst einmal Betroffenheit aus. Du denkst an die Zeit zurück, an die schönen Momente, die du mit dieser Person verbracht hast. Aber ansonsten ändert es dich nicht. Du hörst deshalb nicht auf bergzusteigen, du gehst deshalb nicht weniger schwere Routen. Ich stelle mir halt vor, die Leute sitzen da oben irgendwo alle beieinander auf einer Wolke und lachen uns aus, weil wir da weiß Gott wie herumteufeln. Für mich sind sie irgendwo noch vorhanden, und sei es nur in meiner Erinnerung. Die Chris ist irgendwo vorhanden, der Marcel Rüedi, all jene, die durch dieses oder jenes Ereignis umgekommen sind. Ich persönlich glaube, dass es diesen Leuten gut geht. Ich kann das für mich so sagen.
Peter Habeler mit Christine Boskoff vor dem Start zum Südsattel des Mount Everest
Und du musst dein eigenes Tun deshalb nicht hinterfragen?
Nein, das tue ich mit Sicherheit nicht. Natürlich trifft es mich, wenn wieder so eine Sache passiert wie mit Markus Kronthaler am Broad Peak oder wie mit Andi Orgler, der mit seinem Drachen tödlich abstürzte. Wenn ich Drachenflieger wäre, würde ich in der Folge sicherlich mein Gerät noch genauer checken, würde eruieren, was die Ursache dieses Unfalls war. Bei einem Kletterunfall würde man untersuchen, warum die Sicherungskette versagt hat. Mit Lawinenunfällen befasse ich mich sowieso intensiv, da bin ich als Bergführer immer noch sehr stark gefordert. Aber ich höre deswegen nicht auf, Skitouren zu gehen oder zu klettern. Das stelle ich nicht in Frage. Gut, mittlerweile mache ich natürlich auch keine so extremen Sachen mehr, aber auch früher habe ich das nie in Frage gestellt. Mit dem Tod muss man leben.
Wenn du dir die Situation am Everest heute vergegenwärtigst: Was hat sich gegenüber früher verändert? Und wie kritisch siehst du diese Veränderungen?
Heute steigt ja kein Mensch auf den Everest, bevor er nicht von 6400 Meter bis auf 8850 Meter hinauf versichert ist. Der ganze Berg voller Fixseile, ob vom Nordsattel oder vom Südsattel, bis zum letzten Meter! Wenn dann das Wetter stimmt, der Wind sich gelegt hat, marschieren 20 oder 30 Leute mit ihren Sauerstoffflaschen auf den Gipfel. Fast 500 Bergsteiger waren im Jahr 2006 auf dem Everest, mittlerweile ist er mehr als 3000 Mal bestiegen worden. Das Timing ist mittlerweile anders, sie gehen am Abend weg, damit sie am nächsten Morgen oben sind und den ganzen Tag für den Abstieg haben. Sie gehen natürlich auch viel langsamer als wir damals, der Reinhold und ich, obwohl sie Sauerstoff haben. Nicht alle, die zum Everest gehen, sind Bergsteiger.
Manche haben auch einfach Geld.
Ja, sicher, aber okay, es ist nun mal der höchste Berg der Welt, und sie bilden sich ein, dass sie da hinaufwollen. Sollen sie das machen. Nur hat es mit Bergsteigen nicht mehr viel zu tun. Das, was heute am Everest passiert, passiert eigentlich auf keinem anderen Achttausender, vielleicht noch am Cho Oyu, der als leichtester Achttausender gilt und auch von sehr vielen Leuten angegangen wird. Der Stellenwert einer Everest-Besteigung ist nicht mehr mit früher zu vergleichen. Und wenn jemand behauptet, er hätte einen Alleingang am Everest gemacht – mag sein, dass er ohne Partner unterwegs war, aber er hatte nach wie vor die Fixseile. Dabei gäbe es noch genug Routen, die alpinistisch interessant wären: die Nordwand, den West Buttress, die Südwestwand, die Kangshungwand. Aber so, wie sich jetzt die Everest-Geschichte darstellt, ist sie eigentlich für Bergsteiger nicht mehr interessant.
Als Leiter deiner eigenen Bergschule bist du nun allerdings selbst ein kommerzieller Anbieter.
Das stimmt, wobei es sich bei meinen Nepal-Angeboten um Trekkingtouren handelt, bei denen wir, wenn die Bedingungen stimmen, im äußersten Fall einen Sechstausender besteigen. Ich sehe mich sicherlich nicht als Anbieter von Achttausendern. Aber umgekehrt lehne ich kommerzielle Expeditionen auch nicht rigoros ab. Ich bin zum Beispiel nicht dafür, dass Quoten eingeführt werden, damit nur noch eine bestimmte Anzahl von Leuten zu einem Gipfel aufbrechen darf.
Steckt hinter der Ablehnung von kommerziellen Expeditionen eigentlich nicht auch eine ziemlich elitäre Haltung? Etwa überspitzt ausgedrückt: Wenn jemand gut genug ist, das heißt aber auch, genug Geld hat, um quasi hauptberuflich bergsteigen zu können, genug Zeit hat, um zu trainieren und so gut zu werden, der darf dann in den Himalaja? Alle anderen sind dessen nicht „würdig“?
Das sehe ich nicht so eng. Ich kann das gar nicht so eng sehen, denn ich bin Bergführer und werde unter anderem dafür bezahlt, Leute auf Trekking Peaks im Himalaja zu führen. Da habe ich auch ab und zu mal jemanden dabei, der dem Ganzen – der Höhe, der Anstrengung, den Umständen wie Übernachten im Zelt – nicht ganz gewachsen ist. Da muss man halt dann versuchen, eine Lösung zu finden. Letzten Endes geht es doch darum, den Menschen auf ihrem jeweiligen Niveau ein intensives Erlebnis zu ermöglichen.
Der Reiz des Expeditionsbergsteigens ist für dich also weiterhin gegeben?
Unbedingt. Was ich mir vorstellen könnte, wäre, mit einer kleinen Gruppe von erfahrenen Bergsteigern aus meinem Freundeskreis noch einmal an einen niedrigen Achttausender zu gehen. Also keine allgemein ausgeschriebene Tour, nicht mit klassischen „Kunden“, sondern mit Leuten, die selbst einen großen Teil Eigenverantwortung einbringen. Ich bin Bergführer. Erstens lebe ich davon, zweitens macht es mir Freude, anderen Menschen die Möglichkeit zu bieten, auf einen Gipfel zu kommen, etwas zu erreichen, was sie allein nicht erreichen würden. Ich bin immer noch mit Leib und Seele Bergführer.