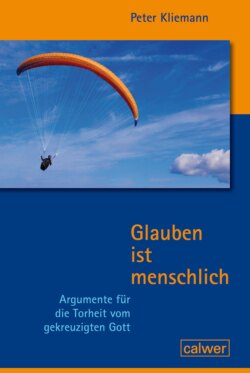Читать книгу Glauben ist menschlich - Peter Kliemann - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel III
Fängt der Glaube da an, wo das Wissen aufhört?
Zum Verhältnis von Glauben, Theologie und Naturwissenschaften
Der Glaube an Gott und die Naturwissenschaften – ein unüberwindlicher Gegensatz?
Viele Zeitgenossen sehen immer noch einen grundsätzlichen Gegensatz zwischen Gottesglauben und Naturwissenschaften. Wie ein Blick auf die Wissenschaftsgeschichte zeigt, beruht diese Annahme auf einem tragischen Missverständnis historischen Ausmaßes und ist deshalb nach Ansicht zahlreicher führender Naturwissenschaftler heute auch überholt:31
Der scheinbare Gegensatz von Gottesglaube und Naturwissenschaft hat seinen Ursprung im 16. und 17. Jahrhundert: Dreht sich die Sonne um die Erde oder umgekehrt?
Entstanden ist der scheinbare Gegensatz zwischen Gottesglauben und Naturwissenschaft im 16. und 17. Jahrhundert, als die katholische Kirche meinte, die astronomischen Forschungen von Männern wie Kopernikus (1473–1543), Giordano Bruno (1548–1600) und Galileo Galilei (1564–1642) als Ketzerei zurückweisen zu müssen – ein absurder Vorgang nicht zuletzt deshalb, weil sich die genannten Wissenschaftler selbst als gläubige Christen verstanden. Der Vatikan sah in der These, die Erde sei nicht der Mittelpunkt des Planetensystems und das ganze Planetensystem vermutlich nur eines von unzählig vielen, nicht nur einen naturwissenschaftlichen Umbruch von ungeheurer Tragweite, sondern vor allem auch einen Angriff auf die Bibel, die kirchliche Lehrautorität und das von Gott gegebene Gesellschaftssystem. Wenn die Erde nicht mehr der Mittelpunkt des Weltalls war, wenn Gott nicht mehr jenseits der Fixsternsphären thronte, dann lag es allzu nahe, auch im Bereich der Kirche und der Gesellschaft die bisher als göttlich angesehenen Ordnungen und Werte in Zweifel zu ziehen und nach vernünftigen Begründungen zu verlangen. Hierbei ist zu bedenken, dass diese Befürchtungen der römischen Kurie angesichts der einschneidenden Veränderungen, die die Reformation Luthers, Zwinglis und Calvins mit sich gebracht hatte, nicht völlig aus der Luft gegriffen waren. Nicht zufällig konnte Kopernikus in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts noch unwidersprochen behaupten, was wenig später, als die Gegenreformation sich voll entfaltet hatte, Giordano Bruno auf den Scheiterhaufen und Galilei vor die Inquisitionsbehörden brachte.
»Damals redete Josua mit dem HERRN […], und er sprach in Gegenwart Israels: Sonne, steh still zu Gibeon, und Mond, im Tal Ajalon! Da stand die Sonne still, und der Mond blieb stehen […]« Jos 10,12f
Auch der Protestantismus weigerte sich lange Zeit, Erkenntnisse wissenschaftlicher Forschung zu akzeptieren. Der Gottesglaube geriet in den Verdacht der Wissenschaftsfeindlichkeit.
Doch auch der Protestantismus zeigte sich nicht immer für neue Gedanken offen. Insbesondere im Zeitalter der Aufklärung, als man anfing, die Bibel wie jedes andere Buch auf ihre historischen Entstehungsbedingungen hin zu untersuchen, betrachteten viele evangelische Theologen und Kirchenbeamte solche Fragestellungen als tabu und gerieten somit auf dem Gebiet der neu entstehenden Geisteswissenschaften in den Verdacht der Rückständigkeit. Der Fortschrittsoptimismus, die Entdeckerfreude und der Erfindergeist des 18. und 19. Jahrhunderts entwickelten sich in der Folge konsequenterweise in Opposition zu Theologie und Kirche, und bis heute existiert das kurzschlüssige Vorurteil, Glaube und Religion stünden prinzipiell im Widerspruch zu den Methoden freier und unvoreingenommener Wissenschaft.
Heute ergibt sich eine völlig neue Gesprächssituation:
Dass es sich hierbei um ein Vorurteil handelt, wird jedoch heute gerade auch von naturwissenschaftlicher Seite immer deutlicher erkannt:
Der Glaube an die Allmacht der Wissenschaft gerät ins Wanken. Insbesondere die ethischen Grenzen naturwissenschaftlicher Forschung werden deutlich.
»Wer sich auf seinen Verstand verlässt, ist ein Tor; wer aber in der Weisheit wandelt, wird entrinnen.« Spr 28,26
• Zum einen wurde der Glaube an Gott von zahlreichen Wissenschaftlern des 19. Jahrhunderts nur allzu offensichtlich durch einen anderen Glauben, nämlich den Glauben an den Fortschritt und die Erforschbarkeit der Welt ersetzt. Alles galt als erforschbar. Die Phänomene der Wirklichkeit, die man sich nicht erklären konnte, könne man sich eben noch nicht erklären. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis der Mensch, endlich von den Fesseln des Aberglaubens befreit, alle Probleme dieser Welt in den Griff bekommen würde. Diese Art von Scientismus (Wissenschaftsgläubigkeit), wie er in extremer Weise z.B. von dem Darwinschüler Ernst Haeckel (1834–1919) vertreten wurde, ist angesichts von Hiroshima und Nagasaki, angesichts von Umweltkatastrophen, unheilbaren Krankheiten oder den mit der modernen Genetik verbundenen Gefahren heute zumindest fragwürdig geworden. Naturwissenschaft kann vieles leisten. Sie kann die Zusammenhänge der Welt erklären und Erfindungen machen, über die wir nur staunen können. Doch ethische Probleme, die Frage, wie und mit welchem Ziel die Forschungsergebnisse und Erfindungen genutzt werden sollen, oder die Frage, ob es vielleicht Bereiche gibt, in denen der Mensch nicht einfach weiterforschen sollte, kann die Naturwissenschaft aus sich selbst heraus nicht beantworten. Versucht sie es dennoch, wird sie selbst zu einer unreflektierten Pseudoreligion, die dazu verurteilt ist, alle Umwege und Irrwege der bisherigen Religionsgeschichte noch einmal zu gehen, und zwar mit all den schwer kalkulierbaren Risiken, die der naturwissenschaftliche Fortschritt heute in sich birgt.
Die Untersuchungen der Atomphysiker Niels Bohr und Werner Heisenberg stellen das herkömmliche Wirklichkeitsverständnis grundsätzlich in Frage.
• Zum anderen führten aber vor knapp 100 Jahren die Untersuchungen der Atomphysiker Niels Bohr (1885–1962) und Werner Heisenberg (1901–1976) zu einer erkenntnistheoretischen Grundlagenkrise der modernen Naturwissenschaften. Bohr entdeckte bei der physikalischen Untersuchung des Lichts, dass Licht je nach Versuchsbedingungen einmal als Strom von Teilchen, dann aber wieder als elektromagnetische Welle erscheint. Diese beiden Ergebnisse sind nach den Grundsätzen der klassischen Physik nicht miteinander vereinbar, und doch kann man das Phänomen des Lichts nur unter Zuhilfenahme beider Sichtweisen physikalisch angemessen erklären. Bohr bezeichnete diese Erscheinung von einander widersprechenden, sich aber ergänzenden Beobachtungen als »Komplementarität«. Heisenberg ist der Entdecker der sogenannten »Unschärferelation«, die besagt, dass sich Ort und Geschwindigkeit eines Elementarteilchens nie gleichzeitig genau bestimmen lassen. Misst man den Ort eines Elektrons, dann ändert sich unter Einwirkung der Messinstrumente bereits die Geschwindigkeit, und umgekehrt.
»Auch den Heiligen des Herrn ist es nicht gegeben, all die Wunder zu erzählen, die der Herr, der Allmächtige, geschaffen hat, damit das All durch seine Herrlichkeit Bestand hat. […] Wie wunderbar sind alle seine Werke, obwohl man kaum einen Funken davon erkennen kann!« Sir 42,17.22(23)
Was aus diesen Untersuchungen Bohrs und Heisenbergs deutlich wird, ist, dass es für die moderne Naturwissenschaft nicht mehr möglich ist, wie im 19. Jahrhundert naiv von der Wirklichkeit und den sie unveränderlich bestimmenden Naturgesetzen zu sprechen. Die Wirklichkeit »an sich« gibt es nicht, immer nur Wirklichkeit, die ein erkennendes Subjekt unter einer bestimmten Fragestellung beschreibt. Das Subjekt gestaltet also durch seine Perspektive, sein Erkenntnisinteresse, seine Beschreibungssprache und die Anordnung der Versuchsbedingungen die Wirklichkeit mit. Wirklichkeit erscheint nicht mehr als eine subjektunabhängige, streng kausal strukturierte und somit genau berechenbare Welt von Objekten, sondern eher als ein Wechselspiel von Subjekt und Objekt, das zwar – ähnlich wie beim Schachspiel – nach bestimmten feststehenden Regeln verläuft, grundsätzlich aber nahezu unendlich viele Spielzüge gestattet und deshalb auch im Hinblick auf zukünftige Entwicklungen nicht eindeutig prognostizierbar ist.
Es gibt mehr als einen Zugang zur Wirklichkeit.
»Habt ihr Augen und seht nicht und habt Ohren und hört nicht?« Mk 8,18
Wenn jedoch schon unter Naturwissenschaftlern nicht mehr naiv von der Wirklichkeit gesprochen werden kann, dann lässt es sich auch leichter akzeptieren, dass die naturwissenschaftliche Beschreibung der Wirklichkeit nur einen möglichen Zugang zur Wirklichkeit darstellt. Ich kann eine Blume biologisch als Stoffwechselsystem beschreiben, ich kann sie aber auch malen oder ein Gedicht über sie schreiben, sie als Futtermittel für Tiere betrachten oder: sie zum Anlass nehmen, über den Sinn des menschlichen Lebens oder die Frage nach Gott nachzudenken. Es ist nicht ausgemacht, welcher Zugang der »richtigere« ist, und die Blume wird auch stets »mehr« sein als die jeweilige Sichtweise, aus der heraus ich mich ihr gerade zuwende. Im Folgenden wird also näher zu bestimmen sein, welchen Zugang zur Wirklichkeit die Naturwissenschaften und welchen Zugang zur Wirklichkeit Glauben und Theologie wählen und was die jeweilige Fragestellung unter welchen Bedingungen leisten kann.
»Die Ros’ ist ohn’ warum, sie blühet, weil sie blühet, / sie acht’ nicht ihrer selbst, fragt nicht, ob man sie siehet.« Angelus Silesius (1624–1677)
Mythos und Logos
»Im Anfang war das Wort (lógos), und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. […] Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns […]« Joh 1,1.14
Die Erkenntnis, dass es unterschiedliche, sich deshalb aber nicht ausschließende Zugangsarten zur Wirklichkeit gibt, hat in der abendländischen Philosophiegeschichte eine lange Tradition. Seit der Antike wird immer wieder zwischen »Mythos« und »Logos« unterschieden. Beide Begriffe meinen im Griechischen zunächst »Rede, Wort«. Darüber, was die beiden Arten, von der Welt zu reden, unterscheidet und wie ihr Verhältnis zueinander genau zu bestimmen ist, wird unter Philosophen und Theologen bis heute gestritten.32 Sehr allgemein lässt sich sagen, dass »Logos« sich auf die rationale, vernünftige, begrifflich klar definierte Weise der Verarbeitung von Wirklichkeit bezieht, »Mythos« hingegen den eher erzählerischen, oft von Bildern und Symbolen geprägten Zugang zur Wirklichkeit meint. Dass der Mythos dabei nicht einfach durch den Logos »entmythologisiert« werden kann, dass der Logos nicht einfach »wahrer« ist als der Mythos, weiß jeder, der sich einmal intensiver auf Literatur und Kunst eingelassen hat, der sich vergeblich bemühte, seine Emotionen unter die Kontrolle der Vernunft zu bekommen oder der im Schlaf die Faszination und auch die Schrecken von Traumbildern erfahren hat.
7 Tage oder 18 Milliarden Jahre? Wie entstand die Welt?
Steht der biblische Schöpfungsglaube im Widerspruch zu naturwissenschaftlichen Erkenntnissen?
Wie wichtig es ist, sich der jeweiligen Fragestellung und ihrer Grenzen bewusst zu sein, belegt die insbesondere in den USA diskutierte Scheinalternative von biblischem Schöpfungsglauben und naturwissenschaftlichen Weltenstehungs- und Evolutionstheorien. Heutige Naturwissenschaftler halten es aufgrund der zu beobachtenden kontinuierlichen Ausdehnung unseres Weltalls für wahrscheinlich, dass dieses vor etwa 18 Milliarden Jahren durch den sogenannten »Urknall«, d.h. eine gewaltige Gasexplosion, entstanden sein könnte. Die ersten einfachen Lebewesen wie Amöben oder Pantoffeltierchen sind nach Ansicht von Biologen vermutlich vor rund drei Milliarden Jahren aufgetreten. Menschenaffen und Menschen gibt es hingegen erst seit einigen Millionen Jahren. So vorsichtig derartige Theorien von Naturwissenschaftlern heute auch formuliert werden mögen – stehen sie nicht in jedem Fall in einem völligen Widerspruch zu der Behauptung der Bibel, die Welt sei von Gott in nur sieben Tagen geschaffen worden, der Mann sei von Gott aus Erde geformt, die Frau später aus der Rippe des Mannes gebildet worden?
Schon das Alte Testament kennt zwei Schöpfungstexte, die in nicht unwesentlichen Punkten voneinander abweichen.
Wer so fragt, verkennt völlig die Aussageabsicht der biblischen Texte.33 Bei genauerer Betrachtung zeigt sich nämlich, dass wir es eigentlich gar nicht mit nur einem biblischen Schöpfungstext, sondern mit deren zwei zu tun haben. Zu unterscheiden ist der priesterschriftliche Schöpfungstext, der Gott immer als »Elohim« (in der deutschen Übersetzung: »Gott«) bezeichnet (1. Mose 1,1–2,4a), und der sogenannte jahwistische Schöpfungstext (1. Mose 2,4b–25), in dem stets der Gottesname »Jahwe« (in der deutschen Übersetzung: »der HERR«) benutzt wird.34 Diese zwei Texte weichen in nicht unwesentlichen Punkten voneinander ab. Um nur einige Beispiele zu nennen:
Während im ersten Text der Mensch nach den Tieren erschaffen wird, ist die Reihenfolge im zweiten umgekehrt. Während im ersten Text Mann und Frau gleichzeitig erschaffen werden, wird die Frau im zweiten Text erst nach und aus dem Mann erschaffen. Während Gott im ersten Text allein durch sein Wort ohne Inanspruchnahme irgendeines Materials schafft, formt er im zweiten den Mann aus Erde. Während der erste Text von sieben Schöpfungstagen ausgeht, kennt der zweite diese Einteilung nicht.
Die biblischen Schöpfungstexte wollen keine naturwissenschaftlichen Theorien über die Entstehung der Welt und der Lebewesen bieten.
Hätten diese beiden Texte den Anspruch, eine naturwissenschaftliche Theorie über die Entstehung der Welt und der Lebewesen zu bieten, so könnte man sich nur wundern, warum der Redaktor des 1. Mosebuches, der die beiden Texte vermutlich um 400 v. Chr. so aufeinander folgen lässt, wie sie uns heute vorliegen, nicht versucht hat, wenigstens die offensichtlichsten Spannungen und Widersprüche auszugleichen (von noch ganz anderen biblischen Vorstellungen über die Entstehung der Welt, etwa vom auch sonst im Alten Orient oft berichteten Kampf Gottes mit einem Meeresdrachen, ganz zu schweigen: vgl. z.B. Ps 74,13f.; Ps 89,10f.; Jes 51,9; Hiob 40,25ff.). Offensichtlich ist die Absicht der Texte jedoch eine ganz andere.
Der priesterschriftliche Schöpfungsbericht ist im babylonischen Exil entstanden und will den israelitischen Glauben von der babylonischen Mardukreligion abgrenzen.
• Der priesterschriftliche Schöpfungstext ist nach Ansicht der heutigen Bibelforschung in der Mitte des 6. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung im babylonischen Exil von israelitischen Priestern verfasst worden. Weil die von Nebukadnezar nach Babylon deportierte Oberschicht in Gefahr war, vom Gott ihrer Väter abzufallen und die scheinbar erfolgreicheren babylonischen Götter anzubeten, versuchen die Verfasser zum einen, die babylonischen Gottheiten polemisch abzuwerten: Während die Gestirne in Babylon als Götter verehrt werden, werden sie im priesterschriftlichen Text als bloße »Lichter« oder »Beleuchtungskörper« bezeichnet, die der Gott Israels geschaffen hat. Auch die Tiere, die in Babylon z.T. kultische Verehrung genossen, sind alle nur Geschöpfe des israelitischen Gottes und dem Menschen untertan. Während der babylonische Hauptgott Marduk die Feste des Himmels, die die Urwasser zurückhält, aus dem Leib der Göttin Tiamat geschaffen haben soll, erschafft der Gott Israels ohne fremde Hilfe ganz allein durch sein Wort, ohne Zuhilfenahme irgendeines Materials.
Es soll den deportierten Israeliten gezeigt werden, dass ihr Gott kein Versager und kein Gott des Chaos ist.
Nicht wie die Welt entstanden ist, ist den Priestern wichtig, sondern dass es der Gott Israels war, der sie geschaffen hat und heute noch erhält.
Zum anderen ist es den Priestern aber wichtig, den zweifelnden Israeliten zu zeigen, dass ihr Gott wider allen Augenschein kein Versager und kein Gott des Chaos ist, sondern ein mächtiger Gott, der sorgfältig, behutsam und planvoll vorgeht. Sie schreiben ihren Text deshalb nach einem ganz bestimmten, nur leicht variierten Schema (»Und Gott sprach … Und es geschah so … Und Gott sah, dass es gut war … Da ward aus Abend und Morgen …«), vergleichbar den Strophen und Refrains unserer Kirchenlieder. Angesichts dieser hymnenartigen Struktur ist es irreführend, 1. Mose 1 als Schöpfungsbericht zu bezeichnen oder den Text gar als Protokoll der Weltentstehung zu verstehen. Die Krone der Schöpfung ist für die Verfasser der siebente Tag der Woche, der im babylonischen Exil eine große Bedeutung gewann, weil man nach dem Verlust des Jerusalemer Tempels vor allem auch an der Einhaltung bzw. Nicht-Einhaltung des Sabbats sehen konnte, ob jemand noch zum alten Gott Israels hielt oder nicht. Insgesamt liegt dem Text also daran zu betonen, dass der Gott Israels und kein anderer Gott die Welt geschaffen hat und auch jetzt noch erhält und dass die Israeliten deshalb keinen Grund haben, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs untreu zu werden. Das Wie der Weltentstehung steht für die Verfasser gar nicht zur Diskussion, wird vielmehr aus der allgemein bekannten, als selbstverständlich vorausgesetzten Vorstellungswelt des damaligen Alten Orients entlehnt (vgl. z.B. die Vorstellung, man müsse über die Erde eine unsichtbare Feste [lateinisch: firmamentum] spannen, um die Urwasser des Himmels zurückzuhalten).
Auch dem »jahwistischen« Schöpfungstext liegt nichts an naturwissenschaftlichen Fragestellungen.
→ Der Sündenfall
• Der sogenannte jahwistische Schöpfungstext ist älter als der priesterschriftliche und vermutlich im davidisch-salomonischen Großreich um 950 v. Chr. entstanden. Er weist den für den »Jahwisten« auch in anderen Kapiteln der Mosebücher typischen anschaulich-plastischen Erzählstil auf und legt den Akzent seiner Erzählung, die in den folgenden Kapiteln des 1. Mosebuches noch fortgesetzt wird, auf anthropologische Fragen. Dem oder den Verfassern ist wichtig, dass der Mensch von Gott als soziales Wesen geschaffen ist (1. Mose 2,18), das die Freiheit hat, sich auch gegen Gott zu entscheiden, und das aufgrund des Sündenfalls dazu verdammt ist, unter Mühsal und Arbeit sein täglich Brot zu verdienen (1. Mose 3). Auch hier ist die Aussageintention alles andere als eine naturwissenschaftliche, und nichts wäre unsinniger, als etwa das spannende Erzählmotiv von der Schaffung der Frau aus der Rippe des Mannes gegen die Erkenntnisse moderner Evolutionstheorien auszuspielen.
Auch solche Fragen kann man stellen …
Man darf die Kontroverse Schöpfungsglauben – Naturwissenschaften also getrost beiseite legen und sich bei der Auseinandersetzung mit den ersten Kapiteln des Alten Testaments vielleicht eher Fragen stellen wie die folgenden35:
Kann ich in einer Welt, die mir oft genauso chaotisch und wirr erscheint wie den Israeliten im babylonischen Exil, auch darauf vertrauen, dass hinter aller Wirklichkeit die ordnende Hand eines Gottes steht und dass dieser Gott der ist, mit dem es auch schon Abraham und Mose zu tun hatten? Oder im Hinblick auf die »jahwistische« Schöpfungserzählung: Welches Bild vom Menschen habe ich eigentlich? Ist mein Mitmensch für mich ein Mitgeschöpf Gottes, »Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch« (1. Mose 2,23), oder sehe ich in ihm nur den Konkurrenten, der mich in einer Welt voller Mühsal und Arbeit nur immer wieder daran hindert, mich selbst zu entfalten? Oder: Können psychologische und biologische Theorien den Ursprung des Bösen und der Aggression in der Welt für mich wirklich besser und befriedigender erklären als der »Jahwist« mit seiner Geschichte vom Sündenfall?
Naturwissenschaftliche Forschung und biblischer Gottesglaube schließen sich nicht gegenseitig aus.
Die Vorstellung und Theorien darüber, wie die Welt und der Mensch entstanden sind, haben sich im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende oft geändert, und auch die uns heute geläufigen naturwissenschaftlichen Erklärungsmodelle werden vermutlich irgendwann modifiziert oder sogar ganz neu formuliert werden müssen. Welche Antworten die Naturwissenschaften aber auch immer geben werden, sie berühren die Antwort auf die Frage, ob die Welt und der Mensch in den Händen eines Gottes liegen oder nur ein Produkt des Zufalls sind, im Grunde nicht.
Wie Naturwissenschaftler arbeiten
Was ist der Gegenstand naturwissenschaftlichen Forschens?
Gegenstand naturwissenschaftlicher Forschung sind Erscheinungen, die gemessen werden können, die kausal erklärbar, wiederholbar und vorhersagbar sind und die deshalb auch unter bestimmten Versuchsbedingungen grundsätzlich von jedermann jederzeit überprüft werden können.
Methodische Schritte:
Methodisch geht die moderne Naturwissenschaft bei der Erforschung ihres Gegenstandes folgendermaßen vor:
– Datensammlung
– Zunächst werden durch gezielte Beobachtungen, Experimente oder Tests Daten gesammelt (also z.B. dass ein Objekt mit dem Gewicht 1 kg zu einem bestimmten Zeitpunkt unter bestimmten Bedingungen in 0,3 Sekunden senkrecht zu Boden gefallen ist …).
– Hypothesenbildung/Induktion
– Um den Zusammenhang zwischen diesen Daten (also z.B. zwischen dem Gewicht und der Fallgeschwindigkeit des Objekts) zu klären, formuliert der Naturwissenschaftler nun eine Hypothese, d.h. eine begründete Vermutung (also z.B., dass das Gewicht der Objekte sich umgekehrt proportional zur Fallzeit verhält – so die Ansicht des Aristoteles). Diesen Schluss vom Einzelfall auf eine allgemeine Gesetzmäßigkeit bezeichnet man als Induktion.
– Überprüfung der Hypothese/Deduktion
– Die Hypothese wird nun in einer großen, aber begrenzten Anzahl von Versuchen überprüft. Diese Anwendung einer allgemeinen Behauptung auf Einzelfälle nennt man Deduktion.
– Falsifikation
– Erweist sich die zu überprüfende Hypothese auch nur in einem Fall als falsch (sogenannte Falsifikation; also z.B., wenn zwei Körper trotz gleichen Gewichts in ein und demselben Medium unterschiedlich schnell fallen – so die Beobachtung Galileo Galileis), dann muss die Hypothese zurückgenommen, modifiziert oder auch eine ganz neue Hypothese aufgestellt werden (so z.B. die Hypothese des Galilei, dass alle Körper unabhängig von ihrem Gewicht im Vakuum gleich schnell fallen). Die Hypothese muss dann ihrerseits auf dem Wege der Deduktion wieder experimentell überprüft werden.
– Verifikation
– Erweist sich die zu überprüfende Hypothese hingegen immer wieder als richtig (sogenannte Verifikation), dann kann sie in den Status eines Naturgesetzes erhoben werden, wobei es sich natürlich schon oft genug gezeigt hat, dass auch vermeintliche Naturgesetze noch einmal modifiziert werden mussten.
Was wir der naturwissenschaftlichen Forschung verdanken
Dieses Verfahren der modernen Naturwissenschaft hat sich mit seinem kritischen, für neue Erfahrungen offenen Grundansatz als äußerst erfolgreich erwiesen. Ihm verdanken wir vom Kühlschrank bis zum Laptop alle technischen Errungenschaften unserer Industriegesellschaft, und es liegt für uns im Nachhinein auf der Hand, warum die dogmatische, d.h. auf unhinterfragbaren Setzungen beruhende Haltung der katholischen Kirche sich auf Dauer gegen den empirischen, d.h. auf Experimenten und nachprüfbaren Erfahrungen beruhenden Ansatz eines Galilei nicht behaupten konnte.
Grenzen naturwissenschaftlichen Forschens:
Dennoch ist der naturwissenschaftliche Zugang zur Wirklichkeit nur einer von mehreren Zugängen, und dieser Zugang hat auch seine nicht zu übersehenden Grenzen:
– Naturwissenschaftliche Forschung sagt nichts über die Beziehung des Wissenschaftlers zu seinem Gegenstand aus.
– So sagen naturwissenschaftliche Sätze nichts über die Beziehung des Wissenschaftlers zu seinem Gegenstand aus, also z.B., aus welchen biografischen Gründen sich Galilei mit den Fallgesetzen beschäftigte, welche Gefühle die Versuche bei ihm auslösten, welche Folgen seine Forschungen für sein weiteres Leben hatten.
– Naturwissenschaftliche Forschung kann ethische und politische Fragen nicht beantworten.
– Naturwissenschaftliche Erkenntnisse helfen auch bei ethischen und politischen Fragestellungen, die sich aus den Ergebnissen naturwissenschaftlicher Forschung ergeben, nicht weiter: Dürfen und sollen Atomkraftwerke gebaut werden? Ist es erlaubt, biologische und chemische Kampfstoffe herzustellen? Dürfen und sollen Experimente mit menschlichen Genen angestellt werden?
– Naturwissenschaftliche Forschung kann nichts aussagen über Sachverhalte, die einmalig und nicht wiederholbar sind.
– Naturwissenschaftliche Erkenntnisse versagen außerdem bei der Erklärung von Sachverhalten, die einmalig und nicht wiederholbar sind: Der Tod meiner Mutter, der Streit mit meinem Chef, das Herzklopfen beim Lesen eines spannenden Romans, die Hassliebe zu meinem Bruder, meine Freude über den Sonnenaufgang im Hochgebirge – all das ereignet sich natürlich unter Umständen in vergleichbarer Weise in vielen Menschenleben, unterliegt deshalb auch bestimmten, vielleicht sogar statistisch erfassbaren Gesetzmäßigkeiten, letztlich handelt es sich aber doch um jeweils einzigartige menschliche Erfahrungen, die in ihrer Erlebnisqualität nicht messbar sind und auch nicht von jedermann jederzeit überprüft werden können.
– Naturwissenschaftliche Forschung hilft bei Sinn- und Lebensfragen nicht weiter.
– Welchen Sinn mein Leben eigentlich hat, warum ich ehrlich und hilfsbereit sein soll, ob ich heiraten soll, warum gerade mein Kind behindert zur Welt gekommen ist, warum ich hässlich bin, wie ich mit meiner Arbeitslosigkeit fertigwerde, wie ich mit meinem Sprachfehler leben kann – all das sind Probleme und Fragen, die Menschen schlaflose Nächte bereiten können, bei denen der naturwissenschaftliche Zugang zur Wirklichkeit uns jedoch keine Hilfe bietet.
Glaube und Theologie
glauben an = vertrauen auf, sich verlassen auf
→ Woran du dein Herz hängst
Glauben ist eine Lebenshaltung.
Als Nächstes wären nun Gegenstand, methodisches Vorgehen und Grenzen theologischer Erforschung der Wirklichkeit zu bestimmen. Dabei ist es zunächst wichtig, sich den Unterschied von Glauben und Theologie zu verdeutlichen: »Glauben« bedeutet sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen in erster Linie »glauben an« und damit soviel wie »vertrauen auf«, »sich verlassen auf«, »sich mit ganzem Herzen einlassen auf«, »bauen auf«. Diese Art von Glauben, die der Hebräerbrief eine »feste Zuversicht« (Hebr 11,1) nennt, richtet sich in der Bibel auf Gott bzw. auf Jesus von Nazareth (vgl. z.B. 1. Mose 15,1–6; Jes 7,1–9; Mt 8,5–13; Joh 11,25; Joh 20,24–29), kann sich aber – wie schon im Zusammenhang mit Luthers Erklärung zum ersten Gebot erkennbar wurde – auch auf ganz andere Götter und Abgötter richten. Glauben in diesem Sinn meint eine bestimmte Haltung zum Leben und zur Welt, ist in gewisser Weise das Grundmuster, nach dem ein Mensch sein Leben gestaltet. Man kann deshalb diese Art von »Glauben« auch nicht als Gegensatz zum Begriff »Wissen« sehen, sondern allenfalls einen Glauben (z.B. den an Jesus Christus) mit einem anderen (z.B. dem an den Fortschritt, an die Vernunft, an die klassenlose Gesellschaft, an den Zufall, an die Weisheit der Natur) vergleichen.
glauben an / glauben, dass
Nicht verwechselt werden darf der Ausdruck »glauben an« mit dem Ausdruck »glauben, dass«, bei dem »glauben« so viel heißt wie »meinen, dass«, »vermuten, dass«, »nicht sicher wissen, ob«. Das Wort »glauben« ist in der deutschen Sprache doppeldeutig und oft irreführend, zumal aus dem »glauben an jemand oder etwas« oft auch ein »glauben, dass« folgen kann: Der Hauptmann von Kapernaum z.B. glaubt, dass sein Knecht wieder gesund werden wird, weil er an Jesus Christus glaubt, also ihm vertraut, sich auf ihn einlässt. Wer an Jesus Christus glaubt, glaubt auch, dass er wirklich auferstanden ist und dass der Gedanke der Auferstehung nicht nur eine menschliche Projektion ist. Es liegt aber zum Beispiel eine Verwechslung der beiden Verwendungsweisen von »glauben« vor, wenn jemand folgert: »Wenn du an den Gott der Bibel glaubst, musst du eigentlich doch auch glauben, dass Gott die Welt in sieben Tagen geschaffen hat.« Wenn sich jemand verpflichtet fühlt zu glauben, dass der Gott der Bibel die Welt in sieben Tagen geschaffen hat, dann glaubt er an die Behauptung, die Bibel sei eine Sammlung von historischen Tatsachenberichten, aber er glaubt deshalb noch keineswegs unbedingt an den Gott, an den die Verfasser der priesterschriftlichen Schöpfungserzählung geglaubt haben.36
Christlicher Glaube enthält immer schon ein Moment der Erklärung, Begründung und Weitergabe des Glaubens.
»Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter; aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte; aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen.« 1. Kor 12,4–6
Obwohl Glauben als eine Lebenshaltung nicht zwangsläufig sprachlich artikuliert und anderen mitgeteilt werden muss, fordert das Neue Testament doch unüberhörbar, »allezeit (!) bereit« zu sein, »zur Verantwortung vor jedermann (!), der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist« (1. Petr 3,15). Christlicher Glaube enthält also im Unterschied zu vielen anderen Formen des Glaubens immer auch schon ein Moment der Erklärung, der Begründung und Weitergabe des Glaubens. Diese Weitergabe des Glaubens kann heute wie früher in vielfältiger Form erfolgen: durch Predigten, durch diakonisches Handeln, durch geistliche Musik und Kirchenlieder, durch persönliche Gespräche, durch Unterricht, durch theologische Bücher, durch Gemälde und Skulpturen, durch Fernseh- und Rundfunksendungen, durch das Internet, durch Podiumsdiskussionen, durch Vorträge, durch Straßen- und Zeltmission … Die Vielfalt der Verkündigungsformen und -themen signalisiert dabei zum einen, dass christlicher Glaube sich an vielerlei Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen wendet, ist insofern also etwas sehr Positives. Andererseits kam und kommt es aber nicht selten auch zum Streit über die rechte Art und den rechten Inhalt christlicher Verkündigung, z.B. zwischen Katholiken und Protestanten, zwischen Lutheranern und Reformierten, zwischen Pietisten und politisch engagierten Christen, zwischen Christen in Lateinamerika, Asien und Afrika und Christen in Mitteleuropa. Um diesen Streit im Interesse der eigentlichen und ursprünglichen Aussageintention des Evangeliums sachgerecht austragen zu können, bedarf es der christlichen Theologie als einer systematischen und methodisch kontrollierten Reflexion des christlichen Glaubens. Theologie vergleicht unsere heutigen Gedanken und Vorstellungen von Gott sorgfältig und systematisch mit den in der Bibel dokumentierten Gedanken und Vorstellungen von Gott und ist somit eine Art wissenschaftliches Korrektiv für Glauben und Verkündigung, mit dem verhindert werden soll, dass wir unsere menschlichen Vorstellungen und Gedanken von Gott mit Gott selbst verwechseln.
Theologie ist die systematische und methodisch kontrollierte Reflexion des Glaubens.
»Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind; denn viele falsche Propheten sind hinausgegangen in die Welt.« 1. Joh 4,1
Christliche Theologie ist die wissenschaftliche Reflexion des christlichen Glaubens und verhält sich deshalb zum Glauben ähnlich wie die Politikwissenschaft zur Politik oder die Musikwissenschaft zur Musik. Daraus ergibt sich unter anderem, dass man keineswegs Theologe sein muss, um gläubiger Christ sein zu können.
Wie gläubig müssen Theologen sein?
Ob umgekehrt ein Theologe auch ein gläubiger Christ sein muss, ist eine Frage, die mit dem Unterschied zwischen Theologie und vergleichender Religionswissenschaft zusammenhängt. Beide Universitätsdisziplinen beschäftigen sich mit derselben Thematik: mit der Interpretation religiöser Schriften, mit der Entstehung und Entwicklung von Religionen, mit der Geschichte philosophischen und theologischen Gedankenguts, mit der Geschichte der Institution Kirche, mit Fragen der Religionspsychologie und Religionssoziologie, mit der Frage nach dem Stellenwert von Religion und Kirche in unserer heutigen Welt. Doch Religionswissenschaft und Theologie gehen an denselben Gegenstand in unterschiedlicher Weise heran: Während Religionswissenschaftler versuchen, ihren Gegenstand möglichst »objektiv« und »neutral« zu beschreiben, machen Theologen inhaltliche Vorgaben und sind parteiisch. Christliche Theologinnen und Theologen gehen davon aus, dass Jesus Christus Ursprung, Mitte und Ziel aller Wirklichkeit ist, und sie beschreiben ihren Gegenstand folglich auch aus dieser Perspektive. In diesem Sinn wird der christliche Theologe in der Tat ein gläubiger Christ sein müssen, was natürlich – wie bei jedem anderen Christen auch – gelegentliche Zweifel und Glaubenskrisen keineswegs ausschließt.
Theologie unterscheidet sich von der Religionswissenschaft durch ihre Parteilichkeit.
Theologie unterscheidet sich von der Religionswissenschaft durch die Bindung an eine konkrete Glaubenspraxis.
Sie will nicht nur analysieren, sondern mitgestalten.
Ein weiterer Unterschied zwischen Theologie und Religionswissenschaft besteht darin, dass Theologie auf eine konkrete Glaubenspraxis und die Institution Kirche bezogen ist und ein erklärtes Interesse hat, diese Glaubenspraxis und die Institution Kirche nicht nur aus einer unbeteiligten Distanz heraus zu analysieren, sondern sie im Sinne des Evangeliums mitzugestalten, zu kritisieren und zu verbessern. Der Bezug zwischen der Institution Kirche und der wissenschaftlichen Theologie kann dabei sehr unterschiedlich aussehen: In der römisch-katholischen Kirche kommt es z.B. nach wie vor nicht selten vor, dass kritische und unbequeme Theologen von der Kirchenleitung zur Ordnung gerufen werden, in den Landeskirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland hingegen wird heute auf die nahezu uneingeschränkte Freiheit theologischer Forschung großer Wert gelegt.
Erkenntnis und Interesse sind nicht voneinander zu trennen. Objektivität und Neutralität gibt es nicht.
Macht man sich diese zwei Unterschiede zwischen Theologie und vergleichender Religionswissenschaft klar, dann ist der Studienanfänger nicht selten geneigt, der Religionswissenschaft wegen ihres Anspruchs auf Objektivität und Neutralität mehr Sympathie entgegenzubringen. Diesem verständlichen Wunsch nach intellektueller Ungebundenheit und Unbefangenheit muss man als Ergebnis der neueren wissenschaftstheoretischen Diskussion allerdings entgegenhalten, dass es objektive und neutrale Wissenschaft gar nicht gibt. Jeder Wissenschaftler, vor allem auch der sogenannte Geisteswissenschaftler, beschreibt seinen Untersuchungsgegenstand aus einer bestimmten Perspektive und einem bestimmten Erkenntnisinteresse heraus. Wissenschaftliche Erkenntnis und subjektives Interesse gehören untrennbar zusammen. Man kann sich dies z.B. gut veranschaulichen, wenn man vergleicht, wie Goethes »Faust« oder Schillers »Don Carlos« von einem Germanisten des 19. Jahrhunderts, von einem DDR-Germanisten und einem heutigen Germanisten ganz unterschiedlich interpretiert wurden.
Wie kritisch reflektiere ich meine eigenen Forschungsinteressen?
Wenn es jedoch »Objektivität« und »Neutralität« gar nicht gibt, dann liegt der große Vorteil der Theologie gegenüber der Religionswissenschaft darin, dass sie ständig gezwungen ist, den eigenen Standpunkt, die eigenen Vorgaben und die eigene Perspektive offenzulegen, zu benennen und zu reflektieren. Welche Interessen sich hinter der Fassade angeblicher Objektivität und Neutralität verbergen, ist hingegen oft nur mit Mühe auszumachen und zu durchschauen.
Theologie – eine Wissenschaft?
Ist Theologie aber überhaupt eine Wissenschaft? Wenn man Wissenschaftlichkeit wie in den Naturwissenschaften durch Messbarkeit, Wiederholbarkeit, Vorhersagbarkeit und ähnliche Kriterien zu bestimmen versucht, dann sicher nicht; denn weder der biblische Gott noch die religiösen Erfahrungen von Menschen lassen sich messen, experimentell wiederholen oder mit Exaktheit voraussagen. Doch wenn man die genannten Kriterien anlegt, dann wären auch alle anderen geisteswissenschaftlichen Disziplinen wie z.B. die Literaturwissenschaft, die Philosophie oder die Geschichtswissenschaft kaum als Wissenschaft zu bezeichnen. Man wird für die Geisteswissenschaften also andere Kriterien von Wissenschaftlichkeit ansetzen müssen, und das ist auch legitim, denn dass das, was man als Wissenschaft bezeichnet, keineswegs ein für allemal festgelegt ist, zeigt die Wissenschaftsgeschichte ebenso wie z.B. ein Vergleich des Wissenschaftsverständnisses westlicher Wirtschaftswissenschaftler mit dem, was bis vor einiger Zeit in den sozialistischen Staaten als Wirtschaftswissenschaft bezeichnet wurde.
Theologie ist keine Naturwissenschaft, sondern eine Geisteswissenschaft. Sie kann deshalb auch nicht nach den Kriterien naturwissenschaftlicher Forschung beurteilt werden.
Fragt man nach dem Forschungsgegenstand der Theologie, so kann man zunächst einmal von der etymologischen Herkunft des Begriffs ausgehen. Das Wort »Theologie« stammt aus dem Griechischen, setzt sich aus den Begriffen théos (»Gott«) und lógos (»Vernunft«, »Verstand«, »Wort«, »Begriff«) zusammen und bedeutet »reflektierte Rede/Lehre von Gott«. Da zumindest der biblische Gott sich jedoch aufgrund seiner Unverfügbarkeit und Nichtabbildbarkeit dem unmittelbaren Zugriff menschlicher Beschreibungen und Definitionen entzieht, wird man präzisieren müssen: Theologie ist reflektierte Rede/ Lehre von Erfahrungen, die Menschen mit Gott gemacht haben, und zwar in der Absicht, die Erfahrungen vergangener Zeiten auf unsere heutigen Erfahrungen und Lebensprobleme zu beziehen.
Theologie ist reflektierte Rede von Erfahrungen, die Menschen mit Gott gemacht haben und machen.
Betrachtet man Gott als alles umfassende, allem zugrunde liegende und »alles bestimmende Wirklichkeit«37, dann könnte man weiter sagen, Theologie – und ähnliches gilt für die Philosophie – untersuche menschliche Erfahrungen im Hinblick auf die Möglichkeit einer alles umfassenden, allem zugrunde liegenden und »alles bestimmenden Wirklichkeit«. Dass diese auf das Ganze der Wirklichkeit zielende Fragestellung ganz anders ist als die eines Naturwissenschaftlers, dem u.a. daran gelegen sein muss, seinen Untersuchungsgegenstand möglichst genau einzugrenzen und zu definieren, liegt auf der Hand.
Theologie fragt nach dem Ganzen der Wirklichkeit.
Theologie ist in folgendem Sinn Wissenschaft:
Ganz allgemein und den Unterschied von Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften übergreifend, ließe sich Wissenschaft als systematische und methodisch reflektierte Erforschung der Wirklichkeit bezeichnen. Dann könnte man christliche Theologie u.a. aus folgenden Gründen als Wissenschaft ansehen:
– Sie bemüht sich, den Inhalt des Glaubens gegenüber jedermann mit vernünftigen Argumenten zu erläutern.
• Christliche Theologie bemüht sich gemäß 1. Petr 3,15 jedermann gegenüber, also auch dem, der nicht Christ ist, den Inhalt des christlichen Glaubens zu erläutern und auf alle Fragen und Einwände gewissenhaft einzugehen.
– Sie bemüht sich, argumentative und logische Widersprüche zu vermeiden.
• Christliche Theologie versucht dabei, für jede und jeden einsichtig und nachvollziehbar zu argumentieren, also argumentative und logische Widersprüche zu vermeiden. Hierbei ist allerdings anzumerken, dass diese Widersprüche nicht mit in der Sache des christlichen Glaubens begründeten Paradoxien (also z.B., dass der allmächtige Gott am Kreuz hingerichtet wird oder dass Jesus Gott und Mensch zugleich ist …) verwechselt werden dürfen.
– Sie legt ihre Voraussetzungen und Methoden offen.
• Christliche Theologie legt ihre eigenen Voraussetzungen und Methoden offen und lässt ihre Arbeit jederzeit von jeder und jedem auf die Beachtung und Einhaltung dieser Voraussetzungen und Methoden hin überprüfen.
Die historisch-kritische Methode
Wenn christliche Theologie von »Gott« spricht, meint sie den Gott, von dem in der Bibel die Rede ist. Ein wichtiger, vielleicht der wichtigste Teil theologischer Arbeit besteht deshalb in einer sachgerechten Auslegung der biblischen Schriften.38
Die historisch-kritische Methode fragt nach der ursprünglichen Aussageabsicht eines Textes.
Nun kann man die Bibel sehr unterschiedlich lesen. Man kann sie – ungeachtet des historischen Abstands, der zwischen ihrer Abfassung und unserer heutigen Zeit liegt – ganz unmittelbar und meditativ auf sich wirken lassen, und es ist immer wieder verblüffend, wie bereichernd gerade diese Art der Lektüre sein kann. Theologie als Wissenschaft wird sich mit einem solch intuitiven und unreflektierten Verfahren nicht begnügen können. Sie hat im Laufe der letzten zwei Jahrhunderte deshalb ein methodisches Instrumentarium entwickelt, das man als historisch-kritische Methode bezeichnet und das zum Ziel hat, die Entstehung und die ursprüngliche Aussageabsicht der biblischen Texte zu erklären. Historisch-kritische Bibelforschung untersucht die Bibel zunächst einmal nicht anders als jedes andere alte Buch (also z.B. Platons Schriften, den Koran, die Upanishaden), und sie erhebt deshalb den Anspruch, dass ihr Vorgehen auch von nicht-christlichen Geisteswissenschaftlern Schritt für Schritt, Argument für Argument überprüft und nachvollzogen werden kann.
Untermethoden der historisch-kritischen Methode:
Im Einzelnen bedient sich historisch-kritische Bibelforschung dabei einer Reihe von Untermethoden, von denen hier zumindest die wichtigsten kurz skizziert werden sollen.39
– Die Textkritik fragt nach dem ursprünglichen Wortlaut eines Textes.
• Da uns – wie bei den meisten Schriften der Antike – von keinem einzigen biblischen Buch das Original erhalten geblieben ist, ist es zunächst Aufgabe der Textkritik, aus den zahlreichen vorhandenen Abschriften den wahrscheinlichsten Urtext zu rekonstruieren. Insgesamt enthält die Bibel viele tausend Textvarianten, von denen sich die meisten jedoch relativ leicht und eindeutig als Abschreibfehler oder bewusste Korrekturen erklären lassen. In einer kleineren Zahl von etwa 3000 Fällen ist und bleibt der ursprüngliche Wortlaut umstritten, wobei in wissenschaftlichen Bibelausgaben die möglichen Varianten jeweils in einem Apparat von Fußnoten vermerkt sind. Als Beispiel für ein textkritisches Problem, das auch Leserinnen und Leser ohne Hebräisch- oder Griechischkenntnisse nachvollziehen können, sei der Schluss des Markusevangeliums angeführt, der in vielen deutschen Bibelübersetzungen kleingedruckt oder in Klammern gesetzt ist. Das Problem, das sich hinter dieser Kennzeichnung verbirgt, liegt darin, dass Mk 16,9–20 in alten und sonst zuverlässigen Handschriften nicht enthalten ist. Entweder hat also ein späterer Abschreiber des Markusevangeliums diesen Schluss, in dem es um die Erscheinungen des auferstandenen Christus geht, hinzugefügt, vielleicht um das Markusevangelium nicht allzu deprimierend und unversöhnlich enden zu lassen, oder aber Mk 16,9–20 gehörte zum ursprünglichen Markusevangelium, ist dann aber, vielleicht, weil die Enden einer Schriftrolle besonders anfällig waren, verloren gegangen.
– Die Literarkritik fragt nach den Quellen, aus denen ein Text zusammengesetzt ist.
→ priesterschriftlicher und „jahwistischer“ Schöpfungstext
• Die Literarkritik untersucht den Text eines biblischen Buches anhand von Gliederungssignalen, Wiederholungen, Einschüben, Unebenheiten, inhaltlichen Spannungen u.Ä. auf die ihm zugrunde liegenden Quellen, betreibt also Quellenscheidung. Dies ist notwendig, weil die biblischen Schriften in der Regel nicht aus einem Guss am Schreibtisch nur eines Menschen entstanden sind, sondern meist auf kleineren mündlich oder schriftlich überlieferten Teilquellen unterschiedlicher Herkunft aufbauen. Ein Beispiel für literarkritisches Arbeiten ist die schon besprochene Unterscheidung von priesterschriftlicher und »jahwistischer« Schöpfungserzählung im 1. Mosebuch, ein anderes wäre z.B. die Frage, aus welchen zunächst selbständigen Einzelbausteinen (Gleichnissen, Wundergeschichten, Streitgesprächen, Jesusworten) die synoptischen Evangelien zusammengesetzt sind.
→ Jesus von Nazareth - Quellenlage
– Die Formkritik fragt nach der Gattung eines Textes.
• Die Formkritik betrachtet biblische Texte unter dem Gesichtspunkt der Textsorte. So ist es z.B. wichtig zu erkennen, dass es sich bei 1. Mose 1,1–2,4a nicht um eine naturwissenschaftliche Theorie der Weltentstehung, sondern um einen hymnenartigen Bekenntnistext handelt. Ein anderes Beispiel: Wer die Geschichte von Isaaks (möglicher) Opferung durch seinen Vater Abraham (1. Mose 22,1–19) als eine Sage liest, die die Ablösung des damals weit verbreiteten Kindsopfers (vgl. 2. Kön 3,27; 3. Mose 18,21) durch ein Tieropfer erklären will,40 wird den Text anders verstehen als jemand, der den Text als Kapitel einer Biografie Abrahams und damit als Beispiel für ein besonders sadistisches Gottesbild liest.
– Die religionsgeschichtliche Methode vergleicht biblische Texte mit Texten aus anderen Religionen des Alten Orients.
• Die religionsgeschichtliche Methode sieht die biblischen Texte im Zusammenhang mit den Nachbarreligionen Israels. So ist es zu einem sachgerechten Verständnis von 1. Mose 1,1–2,4a unerlässlich, sich die polemische Abgrenzung zur babylonischen Religion vor Augen zu führen.
– Die redaktionsgeschichtliche Methode fragt nach der Konzeption des Redaktors, der die einzelnen Quellen eines Textes zusammengefügt hat.
• Die redaktionsgeschichtliche Methode beschäftigt sich im Unterschied zur Literarkritik nicht mit Quellenscheidung, sondern sozusagen mit »Quellenfügung«. Sie fragt nach der Konzeption des Redaktors, also etwa des Evangelisten Matthäus, der – vergleichbar der Arbeit eines Zeitungsredakteurs – aus vielen kleinen Einzeltexten durch Auswahl, Anordnung, Kürzungen, Einschübe, Überleitungen, Zusammenfassungen u.Ä. das uns heute vorliegende Matthäusevangelium zusammengestellt hat. Wie typisch die »Handschrift« eines solchen Redaktors sein kann, lässt sich z.B. gut daran ablesen, dass Matthäus im Unterschied zu Markus und Lukas fast nie vom »Reich Gottes«, sondern fast immer vom »Himmelreich« spricht. Beide Begriffe beziehen sich auf dasselbe, Matthäus ist jedoch Judenchrist und will deshalb – wie damals im Judentum üblich – aus Ehrfurcht den Gottesnamen vermeiden.
Theologie als Hermeneutik
»Was bringt mir das eigentlich, wenn man die Bibeltexte so in ihre Einzelteile zerhackt? Das bringt mir doch nichts für mein Leben.« Kerstin, 17 Jahre
Bliebe Theologie bei der historisch-kritischen Analyse der biblischen Schriften stehen, käme sie über die bloße Beschreibung von historischen Sachverhalten nicht hinaus. Sie wäre – vielleicht ähnlich wie die Ägyptologie oder Assyriologie – eine interessante Forschungsdisziplin für einige Spezialisten, hätte aber nur sehr wenig Relevanz für die Gestaltung unserer heutigen Lebenswelt.
Hermeneutik = Lehre vom Verstehen von Texten
Von einem wirklichen Verstehen der biblischen, aber auch anderer Texte lässt sich jedoch erst dann sprechen, wenn wir versuchen, die Aussagen dieser Texte auf uns selbst zu beziehen und den Anspruch der Texte auch als Herausforderung für unser eigenes Leben zu sehen. Die theoretische Reflexion dieses Verstehensprozesses bezeichnet man als Hermeneutik (Lehre vom Verstehen; Auslegekunst; von griech. hermēneúein = »auslegen«, »erklären«).
Verstehen ist ein offener, nie ganz abgeschlossener Prozess.
Jeder Leser geht mit einem bestimmten Vorverständnis an einen Text heran.
Typisch für den Vorgang des Verstehens ist zunächst, dass Verstehen ein offener, nie ganz abgeschlossener Prozess ist. Ich kann noch so viel Zeit und Mühe auf die Interpretation eines Textes verwenden, er wird nie endgültig interpretiert sein, sondern wird einem anderen Interpreten oder auch mir selbst zu einem anderen Zeitpunkt in einem völlig anderen Licht erscheinen. In der Hermeneutik verwendet man in diesem Zusammenhang die Begriffe »Vorverständnis« und »Horizontverschmelzung«. Ich, der ich im Horizont einer reichen Industriegesellschaft am Beginn des dritten Jahrtausends nach Christus lebe, gehe mit einem ganz bestimmten Vorverständnis, das u.a. auch durch meinen persönlichen biographischen Hintergrund geprägt ist, an einen Text heran, der in einem ganz anderen Lebenshorizont, z.B. zur Zeit Jesu in einer Agrargesellschaft, entstanden ist, und nehme ihn natürlich auch nur unter dem Blickwinkel dieses Vorverständnisses wahr.
Leserhorizont und Texthorizont müssen »verschmelzen«. Dadurch wird der Leserhorizont verändert.
Meine ich, die Aussage des alten Textes verstanden zu haben, »sagt er mir etwas«, dann kommt es zu einer »Verschmelzung« von Leserhorizont und Texthorizont. Durch diese Auseinandersetzung mit dem alten Text verändern sich aber das Vorverständnis und der Horizont des Lesers – sei es auf dramatische Art wie bei Luthers Studium des Römerbriefs, sei es fast unmerklich –, und wenn der Leser den Text nun noch einmal liest, dann liest er ihn nicht mehr so wie beim ersten Mal, und es kommt somit zu einer neuen Horizontverschmelzung, die wiederum das Vorverständnis und den Lebenshorizont des Lesers verändert. Es handelt sich beim Verstehen also – ganz anders als bei der naturwissenschaftlichen Erkenntnis – um einen zirkulären Vorgang, der aber durchaus produktiv ist und keineswegs den Charakter eines Teufelskreises haben muss. Man spricht deshalb auch von »hermeneutischen Zirkeln«, denen das Verstehen unterliegt. So besteht z.B. eine Wechselbeziehung zwischen dem Teil und dem Ganzen eines Textes. Ich kann die Bedeutung eines Bibelverses einerseits erst dann verstehen, wenn ich den Textzusammenhang, in dem der Vers steht, verstanden habe (weshalb es auch den Regeln der Hermeneutik widerspricht, einzelne Bibelstellen, aus ihrem Zusammenhang gerissen, als Argumente zu benutzen!), andererseits kann ich den Text als Ganzes doch auch nur dann begreifen, wenn ich jeden einzelnen Satz des Textes verstanden habe.
Hermeneutische Zirkel sind notwendige Zirkel.
»Erst jetzt, wo ich mich fürs mündliche Abi mit dem ganzen Stoff intensiver beschäftigt habe, verstehe ich, was das alles soll …« Annette, 19 Jahre
→ „jahwistischer“ Schöpfungstext
Ein weiterer hermeneutischer Zirkel zeigt sich darin, dass ich einen biblischen Text (z.B. 1. Mose 1,1–2,4a) oft erst dann richtig verstehen kann, wenn ich mich in die Zeit, in der er entstanden ist (also das babylonische Exil) hineinversetzen kann. Andererseits
Die Bibel: Gottes Wort oder Menschenwort?41
Vier Arten des Bibelverständnisses:
Eine Frage des Vorverständnisses im hermeneutischen Sinn ist es auch, welchen Stellenwert und welche Bedeutung man der Bibel überhaupt beimessen will. Um dieses Thema, um das nicht selten höchst emotional unter der Alternative »Gottes Wort oder Menschenwort?« gestritten wird, sachlich diskutieren zu können, empfiehlt es sich, zwischen vier verschiedenen Arten des Bibelverständnisses zu unterscheiden:
– Die Bibel ist eine Sammlung von alten Schriften, die uns heute nichts mehr zu sagen hat.
• Man kann, erstens, die Bibel ähnlich wie Texte aus dem alten Ägypten als eine Sammlung von alten Schriften betrachten, deren Vorstellungswelt von den Fragen und Problemen unserer Zeit so weit entfernt ist, dass sie uns heute kaum mehr etwas zu sagen haben.
– Die Bibel ist untrennbar mit unserer Kultur- und Geistesgeschichte verbunden. Es lohnt sich deshalb, sich auch heute noch mit ihr zu beschäftigen.
• Man kann, zweitens, – vermutlich mit wesentlich besseren Argumenten – die Bibel als eine Sammlung von alten Schriften betrachten, von der kultur- und geistesgeschichtlich solch intensive und nachhaltige Impulse ausgegangen sind und die so viele interessante Gedanken enthält, dass es sich zumindest für einen gebildeten Mitteleuropäer auch heute noch lohnt, sich mit ihr, vielleicht ähnlich wie mit den Schriften griechischer Philosophen, zu beschäftigen.
Während für diese beiden Arten des Bibelverständnisses die biblischen Texte recht eindeutig »Menschenwort« sind, gehen Christinnen und Christen davon aus, dass die Bibel mehr für sie ist als andere Schriften des Altertums. Christinnen und Christen betrachten die Bibel als ein Dokument von Glaubenserfahrungen, das auch für heutige Menschen noch unaufgebbare und einmalige Wahrheit enthält und für die Gestaltung des christlichen Glaubenslebens unerlässlich ist. Sie bezeichnen es deshalb auch als »Heilige Schrift« oder »Gottes Wort«. Was dies im Einzelnen bedeutet, ist nun allerdings sehr umstritten:
– Die Bibel ist »Gottes Wort« an uns, und zwar in einem ganz unmittelbaren und wörtlichen Sinn. Als »Gottes Wort« ist sie unfehlbar.
»Was ich an den Pietisten toll finde, ist, dass sie ihren Glauben ganz ernst nehmen und auch versuchen, im Alltag danach zu handeln …« Matthias, 20 Jahre
• Eine besonders im Pietismus beheimatete Lesart der Bibel möchte diese in dem Sinn als »Gottes Wort« verstanden wissen, dass aus jedem Satz, aus jedem Kapitel der Bibel ganz unmittelbar und ungebrochen Gott zu uns spricht. Zwar wird nur selten davon ausgegangen, dass Gott selbst die biblischen Bücher verfasst hat, aber es wird doch – und zwar ohne dass man das letztlich begründen könnte – behauptet, die Menschen, die die biblischen Schriften verfasst haben, seien von Gott »inspiriert« gewesen, und es könnten ihnen deshalb auch keine Fehler, Irrtümer, Ungereimtheiten oder gar Widersprüche unterlaufen sein. Wer die Bibel so liest, neigt dazu, historisch-kritischer Bibelforschung sehr skeptisch gegenüberzustehen und in ihr eher eine Bedrohung als eine Bereicherung des Glaubenslebens zu sehen. Die Problematik eines solchen, »fundamentalistisch« genannten Bibelverständnisses,42 das durch seine existentielle Ernsthaftigkeit, sein persönliches Engagement und seine große Konsequenz oft sehr beeindruckend sein kann, liegt darin, dass man viele Aussagen der Bibel nur mit Mühe unmittelbar auf unsere heutige Gegenwart übertragen kann. Welcher Christ möchte heute noch die Speisegesetze des Alten Testaments (vgl. 5. Mose 14,3–21) zum Maßstab seiner Ernährung machen? Wer wollte Spr 13,24 (»Wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn; wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn beizeiten.«) ernsthaft zum Grundsatz christlicher Erziehung erheben? Welche Christin kann im Zeitalter der Gleichberechtigung 1. Kor 14,33f. (»Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen schweigen in den Gemeindeversammlungen; denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen […]«) einfach so hinnehmen?
»Manchmal habe ich den Eindruck, jeder liest in die Bibel hinein, was er gerade braucht …« Sonja, 18 Jahre
Nicht, dass der biblische Glaube nicht auch Zumutungen und Ansprüche enthielte – nur, wäre es gerade um der Sache des christlichen Glaubens willen dann nicht wichtig, zwischen dem wirklichen Kern des christlichen Glaubens, der heute genauso Gültigkeit hat wie vor 2000 Jahren, und seiner zeit- und kulturbedingten Ausprägung und Einkleidung zu unterscheiden? Tatsächlich versuchen auch die allerwenigsten, die die Forderung erheben, die Bibel müsse »wörtlich« ausgelegt werden, diese Forderung auch tatsächlich in Lebenspraxis umzusetzen – von ein paar extremen, sektiererischen Gruppierungen abgesehen. Die meisten Fundamentalisten werden zugestehen, die angeführten Bibelstellen seien so doch nicht gemeint und man müsse sie im übertragenen Sinne verstehen. Genau dann interpretiert man jedoch die Bibel bereits von seinem persönlichen Vorverständnis aus, und es erscheint dann – will man nicht ganz persönliche, nicht hinterfragbare Erleuchtungen für sich in Anspruch nehmen – geradezu notwendig, die Kriterien dieser Interpretation nicht der subjektiven Willkür zu überlassen, sondern sie vom kritischen Maßstab wissenschaftlicher Untersuchungsmethoden überprüfen zu lassen. Natürlich hat auch der historisch-kritische Theologe sein Vorverständnis, mit dem er an die Texte herangeht, und sein Vorverständnis beeinflusst auch zweifellos seine Untersuchungsergebnisse. Im Unterschied zu einer naiv-unhistorischen Deutung der Bibel erhebt er aber den Anspruch, dass seine Argumentationen auch von anderen Menschen anderen Vorverständnisses Schritt für Schritt nachgeprüft und rational nachvollzogen werden können müssen. Historisch-kritische Bibelforschung setzt auf die Kraft des besseren Arguments und wird ihre Untersuchungsergebnisse deshalb gegebenenfalls auch immer wieder revidieren.
»Also, dass der Gott die Frau aus der Rippe vom Mann gemacht hat, das kann mir keiner erzählen …« Lothar, 11 Jahre
Wer an die Bibel aber mit den Augen des Historikers herangeht, wird nicht umhinkönnen, in den biblischen Schriften aufgrund ihrer sehr unterschiedlichen Abfassungssituationen und Aussageintentionen auch inhaltliche Spannungen und Widersprüche zu erkennen, in »Gottes Wort« also »Menschenwort« wahrzunehmen. Auf die inhaltlichen Unterschiede zwischen priesterschriftlichem und »jahwistischem« Schöpfungstext wurde schon hingewiesen.
→ „jahwistischer“ Schöpfungstext
Ein anderes, auch von fundamentalistischer Seite wohl kaum zu bestreitendes Dilemma wäre z.B., wie Mose als angeblicher Verfasser der fünf Mosebücher im 5. Mosebuch, Kapitel 34 eigentlich über seinen eigenen Tod berichten kann. (Die historische Erklärung besteht einfach darin, dass Mose nicht der Verfasser der Mosebücher ist und dass die Überschriften dieser Texte erst aus nachexilischer Zeit stammen.) Im Neuen Testament wäre etwa ein Vergleich der sehr widersprüchlichen Angaben über die Entdeckung des leeren Grabes Jesu ein lohnendes Beispiel, an dem man sich klarmachen kann, dass die Evangelien etwas anderes sein wollen als historische Tatsachenprotokolle.
→ Auferstehung Jesu
– Die Bibel ist von fehlbaren Menschen geschrieben, die ihre Erfahrungen mit Gott weitergeben wollten. Diese Erfahrungen können auch die unseren werden. Dann wird für den, der glaubt, Menschenwort zu »Gottes Wort«.
»Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid […], geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln der Herzen […] Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig.« 2. Kor 3,3.6
• Eine vierte Art der Bibellektüre, die auch der Verfasser dieses Buches für die richtige hält, sieht die Bibel deshalb als ein Buch, das von fehlbaren Menschen geschrieben wurde, das all die Widersprüche und inhaltlichen Spannungen enthält, die von Menschen verfasste Schriften nun einmal enthalten, und das deshalb auch vorbehaltlos historisch-kritisch analysiert werden darf. Weiter geht diese Art der Bibellektüre allerdings davon aus – und das ist eine bewusste Setzung des Glaubens –, dass die Erfahrungen, die die Verfasser der biblischen Schriften mit ihrem Gott gemacht haben, auch unsere Erfahrungen sein können und dass der Gott, von dessen Wirken die Verfasser der Bibel überzeugt waren, auch heute noch wirkt und auch in unserem Leben wirksam werden will. Die Bibel als »Menschenwort« kann so für den, der glaubt, lebensverändernd und lebensentscheidend und auf diese Weise »Gottes Wort« werden.
Zugespitzt formuliert: Christinnen und Christen wollen und sollen an den Gott glauben, der sich in Jesus von Nazareth offenbart hat, nicht aber an eine Sammlung von heiligen Schriften und erst recht nicht an eine bestimmte, angeblich allein selig machende Auslegung dieser Schriften.
Vom Nebeneinander zum Miteinander von Naturwissenschaft und Theologie: Gemeinsame Schritte ethischer Urteilsfindung
»Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand: Ich brauche dich nicht; oder wiederum das Haupt zu den Füßen: Ich brauche euch nicht.« 1. Kor 12,20f..
Naturwissenschaftler und Theologen haben eine gemeinsame Verantwortung und müssen deshalb zusammenarbeiten.
Nachdem deutlich geworden ist, dass es sich bei Naturwissenschaft und Theologie um ganz unterschiedliche Forschungsdisziplinen mit ganz unterschiedlichen Zugriffen zur Wirklichkeit handelt, wäre am Ende dieses Kapitels nun noch abschließend zu überlegen, ob und wie Naturwissenschaft und Theologie sich in ihrer Arbeit auf sinnvolle und unser aller Lebensqualität verbessernde Art und Weise ergänzen können. Denn wissenschaftliche Forschung – naturwissenschaftliche wie geisteswissenschaftliche – darf niemals zum Selbstzweck werden, sondern muss stets den Interessen der Menschen dienen – das ist eine Einsicht, die angesichts von Umweltkatastrophen, vergifteten Nahrungsmitteln und den Möglichkeiten moderner Gentechnik heute wohl kaum mehr jemand bestreitet. Eine Zusammenarbeit von Naturwissenschaft und Theologie (bzw. auch Philosophie und Ethik) ist vor allem überall dort geboten, wo im Zusammenhang mit naturwissenschaftlichen Forschungen und Entdeckungen ethisch zu verantwortende Entscheidungen anstehen: in der Genetik, bei der friedlichen und militärischen Nutzung von Atomenergie, bei Tierversuchen, in Fragen des Umweltschutzes, beim Problem des Schwangerschaftsabbruchs, auf dem Gebiet der Intensivmedizin, beim Thema Aids, bei Fragen des Datenschutzes und des Umgangs mit dem Internet, bei Chancen und Gefahren der sogenannten Künstlichen Intelligenz … Sollen ethische Urteile nicht unbedacht und willkürlich oder aufgrund von bloßen Machtinteressen gefällt werden, ist es nützlich, verschiedene Schritte ethischer Urteilsfindung zu unterscheiden.43
Schritte ethischer Urteilsfindung:
– Problembestimmung
• In einem ersten Schritt, der sowohl bei individuellen als auch bei kollektiven Entscheidungsprozessen oft vernachlässigt wird, ist zunächst einmal präzise zu bestimmen, um welches Problem es eigentlich gehen soll. Geschieht dies nicht, kann es passieren, dass man ständig von einem Thema zum anderen springt, verschiedene Problemstellungen vermischt oder auch nach kurzer Zeit schon gar nicht mehr weiß, welche Frage man eigentlich klären wollte. Außerdem ist zu bedenken, dass die Formulierung eines Problems oft schon ganz bestimmte Vorentscheidungen im Hinblick auf seine Lösung impliziert. So ist es z.B. ein Unterschied, ob ich formuliere: »Soll Schwangerschaftsabbruch gesetzlich erlaubt sein?«, oder ob ich sage: »Ich bin schwanger und bin unsicher, ob ich eine gute Mutter sein werde. Was kann und soll ich tun?«
– Situationsanalyse
• In einem zweiten Schritt, der Situationsanalyse, sollten dann alle verfügbaren und in irgendeiner Weise relevanten Sachinformationen, die das zur Diskussion stehende Problem betreffen könnten, zusammengetragen, sachgerecht zueinander in Beziehung gesetzt und ausgewertet werden. Stellt man sich eine Expertenkomission vor, die über die Frage berät, ob Forschung an embryonalen Stammzellen erlaubt sein soll oder nicht, so wäre hier vor allem die Kompetenz von Naturwissenschaftlern, aber z.B. auch von Juristen und Politikern gefragt. Der Theologe wird in dieser Phase der ethischen Urteilsbildung sozusagen als Vertreter der gebildeten Laien vor allem zuhören, um allgemeinverständliche Erklärungen bitten und Rückfragen formulieren.
– Sichtung von Handlungsalternativen
• In einem dritten Schritt wären im Hinblick auf das anstehende Problem sodann alle denkbaren Handlungsalternativen zu sichten, und zwar ohne sofort zu bewerten. Oft wird diese Phase der ethischen Urteilsfindung allzu schnell übersprungen, was zur Folge hat, dass mögliche und vielleicht sinnvolle Handlungsmöglichkeiten vorschnell als »unrealistisch«, »undurchführbar«, »unverantwortlich« u.Ä. abqualifiziert werden. So wäre z.B. vor 30 Jahren in einer Diskussion über Energiefragen dem Vorschlag, größere Forschungsmittel für die Konstruktion sich selbst steuernder Kraftfahrzeuge bereitzustellen, vermutlich überhaupt kein Gehör geschenkt worden.
– Normenprüfung »Und es trat zu ihm einer der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus antwortete: Das höchste Gebot ist das: ›Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft‹ (5. Mose 6,4.5). Das andre ist dies: ›Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst‹ (3. Mose 19,18). Es ist kein anderes Gebot größer als diese.« Mk 12,28–31
• In der nächsten Phase der ethischen Urteilsfindung, der Normenprüfung, muss es nun darum gehen, welche Maßstäbe, Normen und Werte wir eigentlich an das zur Entscheidung stehende Problem anlegen wollen. Dies wäre in einer Expertenkomission nun sicher die Stunde der Theologen und Philosophen, wobei es allerdings sehr kurzschlüssig wäre zu meinen, Naturwissenschaftler könnten Fragen der Moral und der Ethik einfach an dafür zuständige Fachleute delegieren. Sicherlich werden Naturwissenschaftler in Fragen der Begründung von Normen und Werten zunächst einmal beim Geisteswissenschaftler lernen können – ebenso wie der Geisteswissenschaftler in Fragen der Sach- und Situationsanalyse von Naturwissenschaftlern –, entscheiden und ihre Entscheidung verantworten müssen letztlich aber alle an der Entscheidungsfindung Beteiligten. Theologen und Philosophen können sich nicht in den Elfenbeinturm abstrakter theologisch-philosophischer Gedankenakrobatik zurückziehen, und Naturwissenschaftler können sich in Fragen der Ethik nicht einfach für nicht zuständig erklären.
Welche Werte, Normen und Maßstäbe gelten sollen, ist in unserer pluralistischen Demokratie umstrittener denn je. Soll bei der Frage, ob der Arzt einem Todkranken sogenannte »Sterbehilfe« leisten darf, das fünfte Gebot gelten oder der Grundsatz der Vermeidung von unnötigen Schmerzen oder der Eid des Hippokrates oder das Recht des Einzelnen, über sein Leben selbst zu bestimmen? Oder kann nicht z.B. auch die Kostenfrage (blockiert der Kranke nicht unnötig Bettenkapazitäten?) ein Kriterium sein? Ist der Zustand, in dem sich der Kranke befindet, noch als »Leben« zu bezeichnen? Was ist eigentlich »Leben« – biologisch, philosophisch, theologisch? Soll »Leben« um jeden Preis erhalten und verlängert werden? Wenn nicht, wer ist dann befugt, aufgrund welcher Kriterien zu entscheiden? Diese und viele andere Fragen sind nicht leicht zu beantworten. Aber eine Gesellschaft, die ethische Entscheidungen nicht dem Zufall oder den Gesetzen der Technokratie überlassen will, wird sich an diesem Punkt nicht einfach durch Verdrängung oder Delegation an Experten aus der Verantworung stehlen dürfen.
– Entscheidung
Entscheidungen erweisen sich im Nachhinein immer wieder als falsch. Sie müssen deshalb möglichst »reversibel« bleiben.
• Hat sich eine Gruppe von Entscheidungsträgern, die sich je nach Umständen und Gegebenheiten sehr unterschiedlich zusammensetzen kann, auf eine gemeinsame ethische Grundlage verständigt (womit mehr gemeint ist als ein formelhaftes Zitieren einiger Formulierungen aus dem Grundgesetz!), dann müssen so oder so Entscheidungen getroffen werden. Da Menschen fehlbar sind und die Folgen von Entscheidungen immer nur bis zu einem gewissen Grad prognostizierbar sind, lässt sich nie ausschließen, dass trotz aller Bemühungen und trotz guten Willens auch Entscheidungen getroffen werden, die sich möglicherweise später als falsch und verhängnisvoll erweisen und die die Entscheidungsträger im Nachhinein bereuen. Ein ganz zentraler Gesichtspunkt im Hinblick auf eine Ethik naturwissenschaftlicher Forschung ist deshalb, dass Entscheidungen »reversibel«, d.h. umkehrbar und revidierbar sein müssen, falls sich im Laufe der Zeit nämlich Erkenntnisse einstellen, die zum Zeitpunkt der Entscheidung noch niemand vorhersehen und mitbedenken konnte. Genetische Eingriffe in das menschliche Erbgut z.B. sind beim jetzigen Stand der Genetik nicht umkehrbar und werden zumindest von den großen Kirchen schon aus diesem Grund grundsätzlich abgelehnt.
Ethische Urteilsfindung ist ein hermeneutischer Prozess.
→ Hermeneutik
Anzumerken bleibt schließlich noch, dass es sich beim Prozess ethischer Urteilsbildung wie beim Verstehen um einen hermeneutischen Prozess handelt. Dieser Prozess ist – wie alle hermeneutischen Prozesse – zirkulär, nie endgültig abschließbar und von Interessen geleitet. Wer über Werte und Normen nachgedacht hat oder wer gar die Folgen seiner Entscheidung sieht, wird auch das Problem schon wieder anders definieren und bei der Situationsanalyse, da sich inzwischen ja auch die Situation geändert hat, andere und neue Faktoren miteinbeziehen. Und wer an ein Problem mit dem Vorverständnis herangeht, dass er und alle Kreaturen Geschöpfe eines Gottes sind, wird das Problem anders angehen als jemand, der die Welt und das Leben insgesamt nur als einen Reflex physikalischer und biochemischer Vorgänge wahrnimmt, oder als jemand, dessen oberste Maxime es ist, dass seine Partei unbedingt die nächste Landtags- oder Bundestagswahl gewinnen muss.