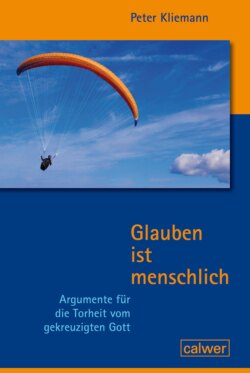Читать книгу Glauben ist menschlich - Peter Kliemann - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVorwort
Wir unterscheiden in unserem Sprachgebrauch manchmal zwischen »gläubigen« und »ungläubigen« Menschen, so, als gäbe es Menschen, die an gar nichts glauben. Doch gibt es das wirklich? Glaubt nicht jeder Mensch tagein, tagaus an etwas oder jemanden? Glaube ich, wenn ich mit meinem Auto über eine Brücke fahre, nicht fest daran, dass die Brücke nicht unter mir zusammenbricht? Glaube ich, wenn ich einem Freund ein Geheimnis anvertraue, nicht fest daran, dass er es nicht weitererzählt? Glauben Schülerinnen und Schüler, die sich um gute Noten bemühen, nicht daran, dass diese Noten ihnen einmal bessere Ausbildungs- und Berufschancen eröffnen werden?
Insofern gilt zweifellos: Glauben ist menschlich. Oder wie Jörg Zink und Rainer Röhricht es in einem gemeinsam verfassten Gedicht formuliert haben:1
Es geht nicht ohne Glauben
Jeder Mensch glaubt irgend etwas,
auch wenn er meint, er glaube nichts.
Er kann nicht von dem leben,
was er sehen und beweisen kann.
Niemand kann einen Menschen lieben,
wenn er nicht glauben will,
denn der andere kann nicht ständig beweisen,
dass er es ernst meint.
Niemand kann einem anderen vertrauen,
wenn er nicht glauben will,
denn der andere kann ihm nicht beweisen,
dass er Vertrauen verdient.
Niemand kann etwas planen oder tun,
wenn er nicht glauben will,
denn er kann nicht wissen,
was die Zukunft bringt.
»Glauben« kann sich in unserer Sprache aber nicht nur auf einzelne Dinge, Personen oder Sachverhalte beziehen, sondern auch auf das Ganze des Lebens und das Ganze der Wirklichkeit. In diesem Sinn bekennen Christinnen und Christen, dass sie an Jesus Christus glauben. Der gekreuzigte Gott ist für sie Ursprung, Mitte und Ziel allen Lebens und aller Wirklichkeit. Andere Menschen vertrauen auf eine andere Sicht der Welt. Sie glauben zum Beispiel an die Kräfte des Marktes, an den Unterhaltungswert des Lebens, an Marx, an Freud, an den Zufall, an das Gesetz des Stärkeren oder einfach an sich selbst. Auch Paulus, der christliche Missionar des ersten Jahrhunderts, hatte wohl schon eine ähnlich plurale Situation vor Augen, wenn er in seinem ersten Brief an die Gemeinde der Hafenstadt Korinth schrieb, für andere Menschen sei »das Wort vom Kreuz« »ein Ärgernis« oder »eine Torheit«, für Christinnen und Christen jedoch »Gottes Weisheit« und »eine Gotteskraft« (vgl. 1. Kor 1,18–25).2
Im vorliegenden Buch soll nun versucht werden, den christlichen Glauben zu durchdenken, und zwar so, dass deutlich wird, was er mit anderen Arten des Glaubens gemeinsam hat und was ihn von anderem Glauben unterscheidet.
Dabei kann man sich sicher darüber streiten, wie wichtig es ist, den christlichen Glauben ausgerechnet zu denken. Ist es nicht viel wichtiger, dass wir an Jesus Christus glauben, und das mit ganzem Herzen und nicht so sehr mit dem Kopf? Und sollten wir unseren Glauben nicht viel mehr leben als lange über ihn nachzudenken? Wie immer man die Gewichte setzt: Dass der christliche Glaube auch gedacht und mit vernünftigen Argumenten begründet sein will, ist schon für das Neue Testament keine Frage. Im 1. Petrusbrief heißt es ganz unmissverständlich: »Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist!« (1. Petr 3,15) So war es schon in neutestamentlichen Zeiten unerlässlich, vielen Mitmenschen überhaupt erst einmal zu erklären, worum es im christlichen Glauben inhaltlich geht. Und bereits damals kamen Christen um das Durchdenken ihres Glaubens auch schon deshalb nicht herum, weil sie untereinander keineswegs immer einig waren, wie der gemeinsame christliche Glaube denn nun konkret in Lebenspraxis umgesetzt werden sollte.
An der Notwendigkeit, den christlichen Glauben auch zu denken, hat sich bis heute kaum etwas verändert. In einem Zeitalter zunehmender Säkularisierung und Differenzierung des gesellschaftlichen Lebens ist sie nach 2000 Jahren Christentumsgeschichte eher noch dringlicher geworden.
Nun ist an theologischen Büchern sicherlich kein Mangel. Kaum ein Teilaspekt des christlichen Glaubens ist nicht gründlich untersucht worden, und auch an meditativen und erbaulichen Veröffentlichungen, an mehrbändigen Dogmatiken und detaillierten Nachschlagewerken ist die Auswahl groß. Was weitgehend fehlt, sind jedoch relativ knappe, aber doch umfassende, allgemein verständliche und doch begrifflich möglichst klare Gesamtdarstellungen für die »gebildete Laiin« und den »gebildeten Laien«.3 Dies wurde mir als Oberstufenlehrer an einem Gymnasium in Baden-Württemberg deutlich, und so entstanden die vorliegenden »Argumente«, die zunächst einmal für den internen Gebrauch gedacht waren und für mich selbst und meine Schülerinnen und Schüler eine thesenartige Zusammenfassung des Abiturstoffes im Fach Evangelische Religion bieten wollten.4 In überarbeiteter Form wenden sie sich jetzt nicht nur an Schüler und Lehrer5 der gymnasialen Oberstufe, sondern auch an interessierte Gemeindemitglieder, an Kolleginnen und Kollegen in anderen Schultypen, in der Erwachsenenbildung und in der Gemeindearbeit, an Studienanfänger sowie an all diejenigen, die sich nicht oder nicht mehr Christen nennen, die sich aber dennoch mit den Inhalten des christlichen Glaubens kritisch auseinandersetzen wollen.