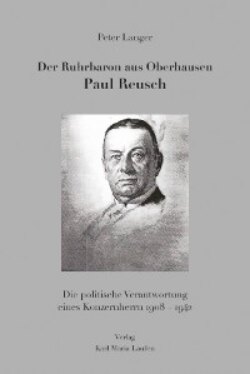Читать книгу Der Ruhrbaron aus Oberhausen Paul Reusch - Peter Langer - Страница 23
Reuschs Beiträge zur Kriegszieldebatte im weiteren Verlauf des Krieges
ОглавлениеDie Abtretung der Erzgruben in der Normandie war natürlich nur – in Reuschs Diktion – für den äußersten Fall vorgesehen, also für den Fall, dass Deutschland die Friedensbedingungen nicht vollständig diktieren konnte. Auch während des Krieges ließ der Generaldirektor der GHH sich deshalb über den Erzvorrat in der Normandie auf dem Laufenden halten. Sein Rohstoff-Fachmann Kipper legte ihm im November 1914 eine detaillierte Berechnung vor, wonach in den drei Minen Barbery, Urville und Estrées mehr als 305 Millionen Tonnen abbaufähigen Eisenerzes lagerten.30 Ein Jahr später ergänzte er diese Informationen durch genaue Zeichnungen.31 Kippers Gutachten dienten Reusch im folgenden Jahr als Grundlage für seine nächste Eingabe an die Reichsregierung.
Die nationalistischen Verbände und die führenden Vertreter der Schwerindustrie ließen sich von den militärischen Rückschlägen im Spätsommer und Herbst 1914 nicht beirren. Sie kämpften hartnäckig gegen einen „voreiligen“ oder „faulen“ Frieden. Im Mai 1915 flossen ihre Maximalforderungen in eine gemeinsame Denkschrift der Unternehmerverbände und der Verbände der Landwirtschaft ein. Federführend waren wie eh und je Stinnes, Kirdorf, August Thyssen und Hugenberg.32 Es gibt keine Hinweise für eine aktive Beteiligung von Reusch, allerdings auch keinerlei Hinweis, dass er sich distanziert hätte. Im Gegenteil: Er war weiterhin bereit, gemeinsam mit anderen Schwerindustriellen die auf Annexionen ausgerichtete Kriegszielagitation der politischen Rechten mit erheblichen Geldmitteln zu unterstützen.33 Gleichzeitig stand Reusch über einen Mittelsmann in der Schweiz weiterhin im Kontakt mit französischen Behörden in Paris, wo sein Beauftragter sich um die Eintragung von 98 Erzkonzessionen ins Grundbuch bemühte.34
Reusch muss sich in den folgenden Monaten sehr über den unlauteren Wettbewerb, den einzelne seiner Kollegen angeblich praktizierten, geärgert haben. Denn er nahm dies zum Anlass für eine weitere Eingabe an die Reichsregierung, nun an den neuen Staatssekretär Helfferich, erst kurz zuvor ernannt und im Ressort Inneres mit der Zuständigkeit für Wirtschaft beauftragt. Gegen wen sich sein Ärger ganz konkret richtete, sagte er nicht. „Wir haben entgegen der Gepflogenheit anderer Industriellen davon abgesehen, die Öffentlichkeit durch Vermittlung der Presse über unseren bedeutenden Besitz – wohl den größten, über den überhaupt ein deutsches Werk in Frankreich verfügt – zu unterrichten.“ Die GHH sei bewusst zurückhaltend gewesen, weil man annahm, „dass erst bei Friedensschluss sich das Reich um private Interessen würde kümmern können“. Die Vorstöße der Konkurrenz veranlassten ihn jedoch, zu diesem Zeitpunkt die Zurückhaltung aufzugeben. Die Reserven an Eisenerz in den von der GHH seit 1907 erworbenen Gruben in der Normandie listete Reusch im Einzelnen auf. Von den insgesamt 305 Millionen Tonnen befänden sich anteilig 224 Millionen Tonnen im Besitz der GHH: „Daraus geht hervor, dass es sich um einen ganz gewaltigen Erzbesitz handelt, der für die deutsche Volkswirtschaft von hervorragender Bedeutung ist.“ Den Wert veranschlagt er nach Abzug der Aufwendungen der GHH auf ca. 50 Millionen Mark und leitet daraus die Forderung ab, „die bedeutenden Interessen unseres Unternehmens in Frankreich bei Friedensschluss geneigtest im Auge behalten zu wollen, nachdem unser Besitz, ebenso wie der Besitz der übrigen deutschen Werke von der französischen Regierung mit Beschlag belegt worden ist.“35
Wie wichtig ihm die Sache war, geht aus der Tatsache hervor, dass Reusch den Entwurf des Schreibens an die Reichsregierung persönlich korrigierte und Bergassessor Kipper ausdrücklich anwies, diese Korrekturen in die endgültige Fassung der Eingabe aufzunehmen. Dieses Schreiben knapp zwei Jahre nach Kriegsbeginn macht deutlich, wie Reuschs Wunschlösung aussah. Es war nicht mehr die Rede von einer Hinnahme der Enteignung der Gruben in der Normandie im Tausch gegen entsprechenden Besitz in Lothringen. Für die GHH strebte er nach dem Sieg über Frankreich den Zugriff auf das Eisenerz in Lothringen und in der Normandie an.
Intern äußerte sich Reusch schon im Frühjahr 1916 sehr abfällig über Bethmann-Hollwegs Zögern, den uneingeschränkten U-Boot-Krieg wieder zu eröffnen. Der Reichskanzler hatte eine Denkschrift des Admiralstabs, in der diese brutale Form der Seekriegsführung gefordert wurde, wegen der katastrophalen Folgen für die Friedenssondierungen wieder einsammeln lassen. Reusch kommentierte diesen Vorgang in einem Schreiben an den Vorsitzenden der „Deutschen Vereinigung“ Graf Hönsbröch so: „Dem Herrn Reichskanzler war es naturgemäß sehr unangenehm, dass einige Exemplare dieser Denkschrift auch gewöhnlichen Sterblichen zugänglich gemacht wurden.“ Damit sollte nach Reuschs Meinung erreicht werden, dass „den Herrn … in der Wilhelmstraße die Stimmung des Volkes über den U-Boot-Krieg nicht noch mehr zu schaffen macht.“ Von den „Leitsätzen“ des Admiralstabs würden jetzt Abschriften angefertigt, die einem kleinen Kreis von Personen, zu denen Reusch offenbar auch zählte, zugesandt würden. Damit sei der Beweis erbracht, „dass der Admiralstab, mit Ausnahme des Chefs, der wieder umgefallen ist, etwas anderer Ansicht war und wahrscheinlich heute noch ist, als der Herr Reichskanzler.“36 Was den uneingeschränkten U-Boot-Krieg anging, so hatte Reusch anscheinend einen größeren Kreis von Unternehmern angesprochen. Begeisterten Beifall erhielt er von seinem Kollegen Wieland aus Württemberg: „Es ist erfreulich, feststellen zu können, mit welcher Einmütigkeit sämtliche gefragte Herren sich für eine rücksichtslose Führung des U-Boot-Krieges ausgesprochen haben. Wann wird wohl der Zeitpunkt kommen, dass unsere Regierung von dieser Waffe energisch Gebrauch macht?“37
Immerhin zögerte Reusch im Sommer 1916 noch, ob er dem „Unabhängigen Ausschuss für einen Deutschen Frieden“, der ganz auf der extremen Linie des Alldeutschen Verbandes lag, beitreten sollte. Wilhelm Hirsch, der Syndikus der Essener Handelskammer, einer der führenden Interessenvertreter der Industrie im Reichstag und enger Vertrauter von Paul Reusch, hatte dies angeregt. Reusch wollte aber erst die Richtlinien dieses Ausschusses klar festgelegt haben. Er drängte darauf, „beim Friedensschluss Russland möglichst zu schonen und unser Hauptaugenmerk auf die Hinausschiebung der westlichen Grenze zu richten“. Im Osten wollte Reusch vor allem einen von Russland unabhängigen polnischen Staat verhindern. „Wer – wie ich – mehr als ein Jahrzehnt in Österreich-Ungarn gelebt hat, weiß, dass die Polen in Österreich-Ungarn dem Deutschen Reiche niemals freundlich gesinnt sein werden. Auch unsere ganze Politik, die wir in Russisch-Polen treiben, schafft uns dort keine Freunde. Unsere Nachgiebigkeit wird als Schwäche ausgelegt! Die Polen werden niemals aufhören, ihr ganzes Bestreben darauf zu richten, dem neuen polnischen Reiche auch die Preußisch-Polnischen Landesteile anzugliedern.“38 Diese Vorstellungen deckten sich mit denen des extrem nationalistischen, ja rassistisch eingestellten „Deutschen Ostmarkenverbandes“.
Einige Tage später präzisierte Reusch seine Vorstellungen und distanzierte sich in polemischer Form von der Kompromissbereitschaft des Reichskanzlers Bethmann-Hollweg: „Der Herr Reichskanzler und die von ihm beeinflussten Kreise wollen die Wiederherstellung Belgiens, vollständige Schonung Englands und Frankreichs, Errichtung eines Königreiches Polen und Angliederung eines Teiles von Kurland und Livland an Preußen.“ Reusch dagegen reklamierte die Politik Bismarcks für sich, wenn er dafür plädierte, „mit demjenigen Staat auf freundschaftlichen Fuß zu kommen, mit dem Preußen durch Jahrzehnte hindurch gute Beziehungen gehabt hat, und das ist Russland. Dazu veranlasst mich auch die Erkenntnis, dass es in Russland wohl möglich ist, das Volk für uns allmählich wieder freundlicher zu stimmen, während es ganz ausgeschlossen ist, dass in England und Frankreich eine Änderung der feindseligen Stimmung erreicht werden kann. Ob wir Belgien nehmen oder nicht nehmen, ob wir Frankreich das Hochplateau von Briey entreißen oder nicht, bleibt für die Volksstimmung in England und Frankreich ganz gleichgültig! Sie werden uns so oder so hassen! Unser weltfremder Herr Reichskanzler sieht das allerdings nicht ein. Wenn wir Weltpolitik treiben wollen, müssen wir England die Faust auf die Nase setzen und unser Gebiet nach dem Westen erweitern. Auf der anderen Seite aber können wir nicht die ganze Welt dauernd zu Feinden haben und deshalb müssen wir uns mit Russland vertragen.“39
Feldman zieht die beiden letzten Sätze – vom Kontext isoliert – dafür heran, Reusch „relativ nüchterne Ansichten“40 bei den Kriegszielen zu bescheinigen. Dies ist unhaltbar: Reusch offenbart in diesem Brief –
–abwegige Vorurteile über die angebliche Volksstimmung bei den Kriegsgegnern,
–eine arrogante Missachtung der Unabhängigkeitsbestrebungen der Polen,
–eine weltfremde Überschätzung der wirtschaftlichen und militärischen Macht Deutschlands,
–die völlig unrealistische Hoffnung, die Kriegsgegner auseinanderdividieren zu können, und
–die Weigerung anzuerkennen, dass die Räumung Belgiens die Mindestbedingung für eine irgendwie geartete Verständigung mit den Kriegsgegnern war.
Reuschs Ziele waren nur durch einen totalen Sieg im Westen zu erreichen. Verständigung mit Russland auf Kosten Polens, um dadurch den Krieg im Westen zu Land und auf See umso brutaler führen zu können – das war seine Strategie. Was ist an einer derartigen Vorstellung „nüchtern“?
Reuschs Spekulationen über einen Separatfrieden mit Russland waren zudem alles andere als originell. Schon im November 1914 hatte Kriegsminister Falkenhayn eine Verständigung mit Russland vorgeschlagen, weil der Krieg gegen drei Großmächte gleichzeitig nicht zu gewinnen war. Reichskanzler Bethmann-Hollweg stimmte ihm zu.41 Entschieden gegen einen derartigen „faulen“ Frieden opponierten jedoch die nationalistischen Verbände und die Schwerindustrie, letztere in der Regel vertreten durch Stinnes, der jederzeit Zugang zum Reichskanzler hatte.42 In den Akten gibt es nicht den geringsten Hinweis, dass Reusch sich von den extremen Kriegszielen der Alldeutschen, auf deren Linie Stinnes vorbehaltlos eingeschwenkt war, offen distanziert hätte. Weder im „Kriegsausschuss der deutschen Industrie“ noch in anderen Verbandsgremien, weder in Schreiben an die mächtigen Wortführer der Industrie (Stinnes, Kirdorf, August Thyssen, Hugenberg) und der Groß-Landwirtschaft noch in Eingaben oder Denkschriften an die Regierung äußerte er sich kritisch zu den deutschen Kriegszielen im Osten.
Die etwas beleidigt klingende Bitterkeit in einem eher privaten Brief mag auch darauf zurückzuführen sein, dass die alten Platzhirsche der Schwerindustrie Reusch bei ihren Vorstößen gegenüber der Reichsregierung nicht hinzuzogen. Er schrieb diesen Brief an Hirsch, als er gleichzeitig in einen bizarren Streit um seine Unterschrift unter einen öffentlichen Durchhalte-Aufruf verwickelt war und sich fürchterlich darüber aufregte, dass die Regierung mit Zustimmung der Unternehmerverbände den Gewerkschaften im Gegenzug für ihre Unterschrift Zugeständnisse gemacht hatte.43
In der Schwerindustrie wuchs im Herbst 1916 der Unmut über die angeblich zu große Kompromissbereitschaft der Reichsregierung bei den künftigen Friedensverhandlungen. Aus dem Alldeutschen Verband kam das Gerücht, die Regierung habe angeboten, ganz Belgien und Frankreich zu räumen, wenn England vorher seine Truppen aus Frankreich abziehe. Die Industriellen waren empört über soviel „Nachgiebigkeit …, die geradezu unerhört wäre und den schärfsten Widerspruch herausfordern müsste.“44 Reusch sah die Sache noch düsterer. Zunächst brüstete er sich damit, dass er bereits im August 1914 gegenüber dem Reichskanzler gefordert habe, „dass das Hochplateau von Briey beim Friedensschluss an Deutschland fallen soll“.45 Dass er die betreffende Eingabe nicht an den Kanzler, sondern an den Vizekanzler Delbrück adressiert hatte, sei nur am Rande erwähnt. Unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten hohen Beamten listete er dann sechs konkrete Punkte auf, die Teil von Bethmann Hollwegs Friedensangebot seien: „1., Alte Grenzen gegen Frankreich; 2., Herausgabe von Belgien; 3., Errichtung eines Königreichs Polen; 4., Schaffung eines selbständigen Staates Kurland und Litauen; 5., Forderung, dass der Kongostaat an Deutschland fallen soll …; 6., Die Regelung der Balkanfrage soll nach Befriedigung der bulgarischen Wünsche in der Hauptsache der Friedenskonferenz überlassen bleiben.“46 Zwar habe die OHL diesen Bedingungen noch nicht zustimmt, aber Reusch rechnete damit – den Einfluss des Zivilisten Bethmann Hollweg in eigenartiger Weise überschätzend –, dass der Kanzler sich durchsetzen werde. „Sie sehen, wir gehen sehr trüben Zeiten entgegen.“47 Diese Einschätzung von Friedens-Sondierungen – im dritten Kriegsjahr, zu Beginn des „Steckrübenwinters“ – ist bemerkenswert. Es fällt auch auf, dass Reusch nicht mehr von Zugeständnissen gegenüber Russland spricht, sondern sich nur an der Tatsache stört, dass in Polen und im Baltikum unabhängige Staaten entstehen sollten. Zu einem Zeitpunkt, wo im Osten mit einem Zusammenbruch des Zarenreiches gerechnet werden konnte, hielt er anscheinend „Nachgiebigkeit“ auch dort nicht mehr für angebracht.
Reuschs Kollege Wieland in Ulm schrieb sofort am zweiten Weihnachtstag seinen Antwortbrief, „bestürzt“ über den „unbegreiflichen Idealismus“ des Reichskanzlers Bethmann-Hollweg. In dessen Absichten für ein Friedensangebot sei „mit Ausnahme der Forderung, dass der Kongostaat an Deutschland fallen solle, von Realismus nichts zu verspüren“. Der Kommerzienrat aus Ulm ereiferte sich: „Warum sollen … unsere tapferen Heere halb Europa in Besitz genommen, Millionen von Deutschen geblutet haben, dass wir in unserem Idealismus im Osten 2 selbstständige Staaten schaffen, Belgien herausgeben und die alten Grenzen gegen Frankreich bestehen lassen.“ Wieland bot an, einen Bericht über Bethmann-Hollwegs Absichten in die nächste Sitzung des Württembergischen Landesausschusses der Nationalliberalen Partei zu lancieren, um dadurch einen Beschluss gegen diese Pläne herbeizuführen.48 Doch davon hielt Reusch gar nichts: Er könne seinen „Gewährsmann“ nicht namentlich nennen; um ihn „nicht in Verlegenheit [zu] bringen“, verbat er sich auch die Erwähnung seines eigenen Namens in diesem Zusammenhang. In der Öffentlichkeit dürfe man „mit Rücksicht auf unsere Feinde“ sowieso nicht über die Friedensbedingungen sprechen. Ob die Oberste Heeresleitung Bethmann Hollwegs Pläne würde durchkreuzen können, vermochte Reusch nicht einzuschätzen. Er fürchtete aber, dass letztendlich der Reichskanzler sich durchsetzen würde.49
Hatte Reusch wirklich „Gewährsmänner an maßgeblicher Stelle“? Sein erschrockenes Zurückrudern gegenüber Wieland spricht eher dafür, dass er die durch die Berliner Amtsstuben wabernden Gerüchte einfach ungeprüft weiter trug. Bemerkenswert ist auch, dass ein Mann wie Wieland, der zwei Jahre später für die DDP als Abgeordneter in die Weimarer Nationalversammlung einziehen würde, also vermutlich nicht zum rechten Flügel der Nationalliberalen gehörte, derartigen – „realistischen“ – deutschen Weltmachtträumen nachhing. Er schlug vor, auch das katholische Zentrum gegen die Friedenspläne des Kanzlers zu mobilisieren.50 Im Januar 1917 konnte Reusch allerdings schon Entwarnung geben: „Nachdem unsere Feinde – Gott sei Dank, darf ich wohl sagen – die dargebotene Hand zurückgewiesen haben“, seien die Sorgen über die Absichten des Reichskanzlers vorerst gegenstandslos.51
Nach der russischen Februarrevolution wurden Reuschs Äußerungen über die Möglichkeiten eines Friedens im Osten sehr widersprüchlich. Einerseits warnte er vor zu großem Optimismus: „Voraussetzung für einen baldigen Friedensschluss mit diesem Lande [Russland] ist nach meiner Ansicht, dass die gegenwärtigen Machthaber nicht am Ruder bleiben und die Regierung entweder in die Hände der reaktionären oder radikalen Kreise kommt.“52 Wenn diese Äußerung so intendiert war, wie sie vom Leser nur verstanden werden konnte, so wäre dies in der Tat ein unverhohlen zynischer Standpunkt! Zwei Wochen später bekräftigte er seine frühere Meinung, dass mit Russland ein Verständigungsfrieden anzustreben sei, was zwangsläufig die Rückgabe der besetzten Gebiete voraussetze. Dies habe er „schon seit Jahr und Tag“ so vertreten. „Unsere Hauptfeinde sitzen im Westen; diese werden es auch für die nächsten Jahrhunderte bleiben.“53 Die beiden zitierten Briefe allerdings waren an einen Hauptmann der Reserve bzw. an einen Oberleutnant, nicht gerade sehr hochrangige Offiziere, gerichtet. Schreiben dieses Inhalts an die politischen Entscheidungsträger sucht man in seinem Nachlass vergebens. Während er bezüglich des Friedensschlusses im Westen gegenüber der Regierung und in den Verbänden sehr nachdrücklich seine Ansichten zur Geltung brachte, hielt er sich völlig zurück, als später die Friedensverhandlungen in Brest-Litowsk anstanden. Auch ist zu fragen, ob die wenig später geschlossenen Verträge mit Georgien, die der deutschen Schwerindustrie (unter Beteiligung der GHH) auf Jahrzehnte hinaus den exklusiven Zugriff auf das Manganerz des Kaukasus sichern sollten, in den Rahmen eines Verständigungsfriedens mit Russland gepasst hätten.54 Von einer wenigstens teilweise verständigungsbereiten („nüchternen“) Einstellung, damit man in der Zukunft nicht die ganze Welt zu Feinden hätte, sondern sich wenigstens mit Russland „vertragen“ könne, bleibt also nichts übrig.
Die Annexionsforderungen der deutschen Rechten, nachdrücklich unterstützt von den Herren der Schwerindustrie, waren das Haupthindernis für alle Versuche, einen Waffenstillstand und einen Verständigungsfrieden zu vermitteln. Das focht aber die Industriellen in keiner Weise an: Noch im Dezember 1917 verfasste der Verein Deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller gemeinsam mit dem Verein der Eisenhüttenleute eine Denkschrift „Zur Einverleibung der französisch-lothringischen Eisenerzbecken in das deutsche Reichsgebiet“. Schon das Inhaltsverzeichnis machte deutlich, dass die beiden Verbände nicht bereit waren, auch nur einen Jota von ihren ursprünglichen Forderungen abzuweichen: „1. Die Abhängigkeit unserer Eisenerzversorgung vom Ausland birgt für Industrie, Staat und Volk die größten Gefahren in sich. 2. Die Vorsorge für die Zukunft macht die Verlegung der lothringischen Grenze unumgänglich notwendig. 3. Der Wert der einzuverleibenden Erzgebiete für unsere Volkswirtschaft und für eine künftige Kriegführung ist unermesslich groß.“55 Im „Schlusswort“ wird – mit vielleicht etwas übertriebenen, gleichwohl entlarvenden Formulierungen – der Wert der Kriegsbeute von 1871 noch einmal hervorgehoben: „Ohne das Eisenland Lothringen hätten wir diesen die größten Eisen- und Stahlmengen verschlingenden Krieg nie und nimmer siegreich führen können. Ohne Lothringen hätten wir aber auch trotz 44 Jahre langer emsiger Friedensarbeit weder im heimischen Wirtschaftsleben, noch auf dem Weltmarkt die gewaltigen Erfolge erzielen können.“ Deshalb trügen „unsere Staatsmänner“ die Verantwortung dafür, dass der kommende Friede alle die für unser Leben, für unsere Volkswirtschaft und Wehrmacht notwendigen fremden Gebiete dem deutschen Reichskörper einfügt“, zumal Lothringen ja „vor Jahrhunderten gewaltsam aus dem alten Deutschen Reich herausgerissen“ worden sei. Auch die Sicherung der Arbeitsplätze in der Industrie erfordere die Annexion dieser Erzgebiete.56 Obwohl die Denkschrift als „streng vertraulich“ gekennzeichnet war, ließ Reusch gedruckte Exemplare in relativ hoher Auflage an die leitenden Herren der GHH und im Rathaus Oberhausen verteilen.57
Sein Unternehmerkollege Wieland aus Ulm, mit dem Reusch sich über Jahre hinweg vertraulich austauschte, stimmte der Denkschrift des VdESI ebenfalls ausdrücklich zu, um dann umso intensiver über die Friedensverhandlungen mit Russland zu lamentieren. Selbst bei Hindenburg und Ludendorff witterte er jetzt die Neigung zu einem „Verzichtfrieden“.58 Reusch war zum Jahreswechsel in ähnlich düsterer Stimmung: „Die Nachrichten aus Brest-Litowsk lauten wenig erfreulich. Wenn man auch bei dem erneuten Friedensangebot an die Westmächte mit einer Ablehnung gerechnet hat, – sie ist inzwischen ja auch tatsächlich erfolgt – so hat man sich doch für die Zukunft in einer Weise festgelegt, die uns auch bei einem siegreichen Ausgang des Kampfes im Westen schweren Schaden zufügen wird. – Von der gegenwärtigen Regierung ist ein deutscher Frieden nicht zu erwarten. Ich fürchte, dass die schlappe Haltung … auf die Kampfesfreudigkeit unserer Truppen einen sehr ungünstigen Einfluss ausüben wird.“59 Also auch die Nachfolgeregierung nach dem Sturz Bethmann-Hollwegs war Reusch noch zu „schlapp“!
Um die Jahreswende müssen ihm andererseits Zweifel an einem von Deutschland zu diktierenden Siegfrieden gekommen sein. Er berichtete seinem württembergischen Kollegen Wieland von der Industrie-Gesellschaft m.b.H., die 1916 von Krupp, Gelsenberg, Phönix, Deutsch-Luxemburgischer Bergwerks- und Hütten-AG und der GHH zu dem alleinigen Zweck gegründet worden war, „die in Belgien zur Liquidation kommenden Industrien aufzukaufen“. Anfang 1918 schienen derartige Käufe aber nur noch wenig lukrativ, weil befürchtet wurde, dass bei einem Friedensschluss alle Firmenkäufe in Belgien wieder rückgängig gemacht werden würden. Deshalb riet Reusch in diesem Stadium des Krieges von Erwerbungen in Belgien dringend ab.60
Als er wenige Wochen später ein Programm für die „Rohstoff-Beschaffung nach dem Kriege“ entwarf, schienen alle Bedenken vom Januar wieder zerstreut. Im Interesse der Industrie und der zukünftigen Schlagfertigkeit des deutschen Heeres müsse die Rohstoffversorgung bei den „bevorstehenden Friedensverhandlungen mit den Westmächten … eine besondere Rolle spielen“. Bei „energischer Haltung unserer Unterhändler“ dürften sich seiner Meinung nach der Durchsetzung von sechs Programmpunkten „keine unüberwindlichen Schwierigkeiten in den Weg stellen“: „1. Unsere Gegner werden im Friedensvertrage verpflichtet, an uns gewisse Mengen von Rohstoffen, wie Kupfer, Nickel, Baumwolle, Wolle, Gummi usw. usw., bis zu einem bestimmten Zeitpunkte franco deutschem Seehafen zu liefern. 2. Die zu liefernden Mengen werden auf ein Mehrfaches unserer Einfuhr im letzten Friedensjahre festzusetzen sein. 3. Die Bezahlung dieser Rohstoffe erfolgt nach Eingang zu den Marktpreisen vom 1. Juli 1914. 4. Belgien und Nordfrankreich wird erst geräumt, wenn diese Rohstoffmengen zur Ablieferung gebracht sind.“ Im fünften und sechsten Punkt war der Verkauf zu den aktuellen, weit über dem Niveau von 1914 liegenden, Marktpreisen vorgesehen. Die riesige Preisdifferenz ließ – so Reusch – einen gewaltigen Gewinn zugunsten der Reichskasse erwarten. Reusch sah in dieser Vorgehensweise eine „mittelbare Kriegsentschädigung, die nach Lage der Verhältnisse zu fordern, wir uns aber nicht scheuen sollten, umsomehr, als eine unmittelbare Kriegsentschädigung im Friedensvertrage kaum zu erreichen sein wird.“ Das Schreiben ging an den Staatssekretär des Reichswirtschaftsamtes Freiherr vom Stein, Abschriften erhielten General Ludendorff für die Oberste Heeresleitung und Reichsschatzsekretär Graf von Roedern.61
In der Geschäftsstelle des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller wurde in diesem Frühjahr noch über viel weiter gehende Forderungen an Frankreich phantasiert. Die GHH erhielt Ende Juni 1918 die Abschrift eines Schreibens des einflussreichen Geschäftsführers des VdESI, Dr. Reichert, in dem allerdings die Adressaten nicht genannt werden. Es dürfte sich vor allem an die OHL gerichtet haben, da ihm eine Anfrage „von militärischer Seite … bezüglich des Friedensschlusses mit Frankreich“ beilag. Neben dem Inhalt selbst ist auch von Interesse, welche Teile des bemerkenswerten Papiers in der GHH, vermutlich von Reusch persönlich, angestrichen wurden. Ausdrücklich auf die Denkschrift über die „Einverleibung“ des Erzbeckens in Lothringen vom Dezember 1917 bezugnehmend, wird die Verlegung der Grenze möglichst weit nach Westen verlangt. In der Abschrift, die der GHH vorlag, war folgender Satz unterstrichen: „Als Mindestforderung käme wohl die Maaslinie mit Verdun in Betracht.“ Reichert fährt fort: „Außerdem wäre von französischen Kolonien mindestens Marocco für uns zu verlangen.“ Der Zugriff auf das Eisenerz reichte dem Verfasser nicht, es ging ihm auch um Mangan und andere wertvolle Nichteisenmetalle: „Es genügt keineswegs, dass wir Briey und Longwy ins Reich einverleiben. Wir müssen vielmehr auch die Ausbeutung der im französischen Mutterlande und in den Kolonien gelegenen Gruben verlangen, und zwar unbeschränkt und ungehemmt, also auch zollfrei.“ Deutschen müsste der Erwerb von Erzgruben überall ermöglicht werden, sie seien wirtschaftlich den französischen Staatsbürgern gleichzustellen. Vor dem Krieg mit deutschen Firmen geschlossene Verträge seien wieder in Kraft zu setzen. Die folgenden Punkte waren in der GHH wieder besonders angestrichen worden: Die früheren billigen Eisenbahntarife und andere Transporterleichterungen seien wieder herzustellen. Die im Krieg „von den feindlichen Ausländern“ erworbenen Rechte an den Erzgruben deutscher Eigentümer seien zu annullieren. „Ferner ist zu erstreben eine zollfreie Einfuhr von Eisen- und Stahlerzeugnissen aus Deutschland, welche zum Wiederaufbau der zerstörten französischen Gegenden … nötig sind.“62
Am 8. Juni 1918 befasste sich der Hauptvorstand des VdESI mit der Problematik des Friedensschlusses mit Frankreich. Diskussionsgrundlage war ganz offensichtlich das Reichert-Papier vom April, denn die Geschäftsstelle forderte danach alle Mitglieder des Hauptvorstandes dazu auf, aufgrund dieses Papiers nun ihrerseits die individuellen Wünsche für den Friedensschluss mit Frankreich zu formulieren.63
Reusch nahm wenige Tage später zu Reicherts Programm ausführlich Stellung. Bei der neuen Grenzziehung empfahl er, sich von wirtschaftlichen, nicht primär von politischen Gesichtspunkten leiten zu lassen. Dass das gesamte lothringische Erzbecken an das Deutsche Reich anzugliedern war, stand für ihn außer Frage. Bergsachverständige Gutachter sollten den Umfang der Erzvorkommen abgrenzen. „Aufgrund dieses Gutachtens hat die Oberste Heeresleitung diejenigen Grenzen zu bestimmen, die ihr für den ausreichenden Schutz dieses Erzvorkommens notwendig erscheinen.“ Deutschlands Grenze sollte also nach seinen Vorstellungen weit über die Erzgebiete Lothringens hinaus nach Westen verschoben werden. Gar nicht einverstanden war er mit der sehr vagen Formulierung über die Erwerbsrechte für Erzgruben und Grundstücke im Allgemeinen durch Deutsche: „Bekanntlich wird und muss Deutschland aber unter allen Umständen französischen Einfluss und französischen Besitz in Elsass-Lothringen ausschalten.“ Diesseits und jenseits der nach Westen verschobenen Grenze müsse ein etwa 150 km breiter Gebietsgürtel geschaffen werden, „in dem auf deutscher Seite kein französischer und auf französischer Seite kein deutscher Besitz erworben und kein Bergbau betrieben werden darf.“ Die formale Einhaltung des Prinzips der Gegenseitigkeit sollte wohl die Tatsache verdecken, dass die gesamten Erzvorkommen auf der deutschen Seite der neuen Grenze liegen würden. Die Forderungen über die Eisenbahntarife gingen Reusch zu weit. Da Frankreich seine Eisenbahnen künftig würde besteuern müssen, reiche für deutsches Gut auf französischen Bahnen das Prinzip der Meistbegünstigung. Reusch dachte hier offensichtlich an die finanziellen Lasten, die der Sieger dem unterlegenen Frankreich aufdrücken würde und die nur durch hohe Steuern würden aufgebracht werden können. Für den Erztransport waren für Reusch, wie er ausführlich erläuterte, ohnehin die Wasserwege wichtiger als die französischen Eisenbahnen. Er verschweigt bei der sehr ausführlichen Argumentation, dass dieses angeblich allgemeine Interesse deutscher Firmen in erster Linie aus der Lage der GHH-Gruben in der Normandie erwuchs. Reusch distanziert sich schließlich von Reicherts Forderung auf zollfreie Einfuhr der für den Wiederaufbau benötigten deutschen Güter nach Frankreich. Eine derartige Vorschrift hielt er für undurchführbar. Der Konzernchef der GHH schloss mit folgendem Appell an die Geschäftsstelle des VdESI: „Im Übrigen möchte ich dringend bitten, dafür Sorge zu tragen, dass die in dem Schreiben vom 27. April 1918 niedergelegten, sehr weitgehenden Forderungen nicht in die Öffentlichkeit gelangen. Es besteht doch die Möglichkeit, dass bei Bekanntwerden derartiger Kriegsziele diejenigen Forderungen, die von der Eisenindustrie mit allem Nachdruck und ernstlich vertreten werden müssen, Gefahr laufen, nicht die nötige Beachtung zu finden.“ So abwegig die Forderungen in dem Reichert-Papier waren, so sehr muss gleichzeitig betont werden, dass auch Reuschs „gemäßigte“ Vorstellungen für alle denkbaren westlichen Verhandlungspartner völlig inakzeptabel gewesen wären. Wie unversöhnlich, objektiv jegliche Verständigung mit den Kriegsgegnern ausschließend, seine Position war, machte er sich wohl nicht bewusst, wenn er ganz am Ende seiner Stellungnahme auf die Fragen „von militärischer Seite“ mit einem klaren, völlig uneingeschränkten „Nein“ reagierte. Es ging um die folgenden beiden Fragen: „Würde man evt. geneigt sein, an Frankreich, wenn das Becken von Longwy-Briey an uns abgetreten wird, die Verwertung eines Teiles dieser Erze zu überlassen? Welche Möglichkeiten liegen vor, den Franzosen für Longwy-Briey Kompensationen zu geben?“64 Reichert bedankte sich prompt bei Reusch für die „besonders eingehende Stellungnahme“, die anscheinend nicht die Regel war.65
Noch wenige Wochen vor Kriegsende, im September 1918, nahm Reusch an einer Besprechung mit Beukenberg, dem Chef des Phönix-Konzerns und Vorsitzenden der wichtigsten Interessenverbände der westlichen Schwerindustrie, teil, um die weitere Aufschließung der gemeinschaftlichen Grube in Lothringen zu planen. Von Seiten der GHH waren neben Reusch sein späterer Stellvertreter Kellermann und Bergrat Mehner anwesend.66 Niemand aus dem Kreis der Industriellen konnte sich offenbar vorstellen, dass Lothringen für Deutschland bald verloren sein würde.
Kennzeichnend für die Mentalität und die wirklichkeitsfremde Sicht der Herren der Schwerindustrie war auch der Vertrag mit der unabhängigen Republik Georgien über den Abbau von Manganerz im Kaukasus. Im Juli 1918, drei Monate vor dem Zusammenbruch der deutschen Armee, schloss ein Konsortium, dem auch die GHH angehörte, mit dem Georgischen Staat einen Vertrag, der den deutschen Firmen die ausschließliche Abbau-Konzession für Manganerz auf 30 Jahre und die Verfügung über den Hafen Poti am Schwarzen Meer auf 60 Jahre zusicherte.67 Nach Kriegsende, im Frühjahr 1919, trafen sich Vertreter der beteiligten Firmen im Industrieclub in Düsseldorf, wo sie aber wenig mehr tun konnten, als sich über die „Unsicherheit der politischen Verhältnisse“ auf dem Gebiet des ehemaligen Zarenreiches zu beklagen.68 Die „politischen Verhältnisse“ hatten offenbar zur Folge, dass dieser „Vertrag“ nie wirklich in Kraft trat.
Die Hartnäckigkeit, mit der Reusch bis zum Sommer 1918 an den imperialistischen Kriegszielen festhielt, mussten zusammenhängend dargestellt werden, denn aus dieser Zielsetzung ergaben sich alle anderen, nach innen gerichteten Entscheidungen und Aktionen der Kriegszeit. Allerdings erscheint es sinnvoll, bei den Problemen der Sozial- und Innenpolitik in der Mitte des Krieges eine Zäsur zu setzen.