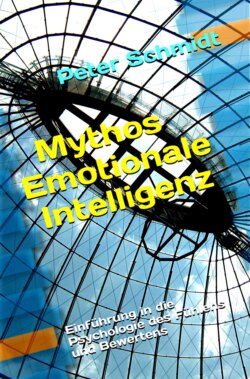Читать книгу Mythos Emotionale Intelligenz - Peter Schmidt - Страница 10
Оглавление4 Eine kritische Bestandsaufnahme unserer mentalen Verfassung
Jeder dritte Deutsche leidet im Laufe eines Jahres mindestens einmal an einer psychischen Störung, so eine Untersuchung, die des Robert-Koch-Instituts Berlin. Acht Millionen Deutsche klagen über akute psychischen Probleme, vor allem Angststörungen, depressive Erkrankungen und Schmerzsyndrome. „Angststörungen gehören zu den verbreitetsten seelischen Störungen in westlichen Ländern und sind die häufigste seelische Störung in den Vereinigten Staaten, wo sie fast vier Prozent der Bevölkerung treffen.“
Dabei werden viele Ängste durchaus sachlich begründet, wie z.B. Flugangst oder die Angst vor dem Terrorismus, sind aber doch auch Ausdruck einer meist uneingestandenen neurotischen Angstbereitschaft, wenn nicht sogar eines Hangs zur Negativität, der rationalen Argumenten nur schwer zugänglich ist. Wie die Statistik zeigt, ist es immer noch sicherer, zu fliegen als ein Duschbad zu nehmen. „Etwa jeder zehnte Patient, der zum Hausarzt kommt, ist so depressiv, dass er deswegen behandeln werden müsste. Fast durchweg geben diese Patienten aber an, somatische Beschwerden wie Schmerzen oder Schlafstörungen zu haben.“
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass psychische Krankheiten heute an dritter Stelle nach Infektionen und Unfällen stehen. Bis zum Jahre 2020 rechnen Experten mit einer deutlichen Zunahme und erwarten, dass Depressionen den zweiten Platz unter den auftretenden Krankheiten einnehmen.
Angst- und Zwangsstörungen, Depressionen und Alkoholabhängigkeit zählen zu den häufigsten Problemen. Fast jeder kennt jemanden, der an Flugangst, Höhenangst, Klaustrophobie, Prüfungsangst oder Lampenfieber leidet. Doch die Liste typischer „Zipperlein“ ließe sich fast beliebig fortsetzen: Marotten, Nervosität, „vegetative Dystonie“, Antriebsarmut, Spielsucht – also auch Störungen, die noch nicht unbedingt als krankhaft eingestuft werden und doch das Leben und Zusammenleben empfindlich behindern: Gereiztheit, Unruhe, leichte Erregbarkeit, Streit- und Kritiksucht, Schüchternheit, Wehleidigkeit, Hypochondrie …
Auf der körperlichen Seite, so die psychosomatische Medizin, schlagen sich mentale Probleme in verschiedenartigsten Entsprechungen nieder wie z.B. Schweißausbrüchen, Tremor, Herz- und Kreislaufstörungen, Schwindelgefühl, leichter Erschöpfbarkeit.
Den Hausärzten wird von den Experten vorgeworfen, sie hielten nur bei einem Prozent ihrer Patienten eine Überweisung zur Behandlung psychischer Störungen für notwendig. Fachleute beklagten anlässlich des Weltkongresses der Psychiatrie in Hamburg 1999, viele Betroffene bekämen keine angemessene Behandlung.
So viel zunächst zur psychischen und somatischen Seite unserer Verfassung. Betrachten wir nun, wie sich unsere mentale Verfassung in Umwelt und Gesellschaft niederschlägt:
Nach Schätzungen haben zwischen 1945 und 2000 weltweit 218 Kriege stattgefunden – trotz fünfzig bis sechzig Millionen Toten während des Zweiten Weltkriegs, trotz Auschwitz und Dachau, trotz systematischem Vergasen, Verhungern und Verbrennen missliebiger Unschuldiger.
Schon eine kleine Liste kriegerischer und gewalttätiger Auseinandersetzungen wirft ein ernüchterndes Bild auf die Friedfertigkeit, Toleranz und Gutwilligkeit der Spezies Homo sapiens nach dem Zweiten Weltkrieg: Vietnam, Tibet, Kambodscha, Tschetschenien, Nordirland, Kurdistan, Irak, Iran, Kosovo, Palästina, Afghanistan – überall starben und sterben Menschen für zweifelhafte politische Ideen. Da werden Minderheiten mit Giftgas ausgerottet, die Intellektuellen des Landes getötet, Religionen unterdrückt, anderen die Freiheitsrechte und das Recht auf einen eigenen Staat oder die freie Wahl der Gesellschaftsordnung verweigert oder rigide religiöse und offenkundig subjektive und willkürliche Wertvorstellungen durchgesetzt.
Nachdem sich der US-Verteidigungshaushalt unter dem früheren Präsidenten George W. Bush fast verdoppelt hatte, ist diese Entwicklung in den USA seit Obama durch die Finanzkrise zwar aufgehalten worden. Aber noch im Jahre 2008 wendeten die USA fast 600 Milliarden Dollar für Rüstungsausgaben auf. Eine unvorstellbar hohe Summe, die, anders eingesetzt – in einer Welt, die ihre Hausaufgaben in emotionaler Klugheit gemacht hat – unsägliches Leid wie Hunger, Dürrekatastrophen, Krankheit und Armut reduzieren könnte. So viel kostet die mächtigste Nation der Welt ihr Misstrauen, ihre Angst vor eingebildeten oder tatsächlichen Feinden und ihr Bedürfnis, ihre Vormachtstellung, den Staus quo der Machtpolitik und ihren Reichtum unter allen Umständen festzuhalten. Es wird in Töten investiert, und andere Nationen versuchen es den USA in möglichst effizienter Weise in dem ihnen möglichen wirtschaftlichen Rahmen gleichzutun.
Das aus der politischen Kontroverse des Kalten Krieges entstandene nukleare Wettrüsten wirft ein klares Licht auf unsere mentale Verfassung: Trauen wir dem anderen zu, dass er eine atomare Vormachtstellung politisch missbrauchen könnte, dann scheuen wir keine Kosten und Anstrengungen, um der vermeintlichen oder tatsächliche Gefahr zu begegnen. Diese Einschätzung ist für sich gesehen sicher nicht unvernünftig, und niemand in politisch verantwortlicher Stellung würde leichten Herzens das Risiko eingehen wollen, einfach optimistisch den Ausgang dieses machtpolitischen Lotteriespiels abzuwarten, einmal abgesehen davon, dass dies im jeweiligen politischen Umwelt auch nur schwer durchzusetzen wäre. Unsere typische und naheliegende Handlungsweise, das Wettrüsten, ist aber auch entlarvend für unser Selbstbild.
Es hat den Anschein, als sei unsere Gewaltbereitschaft so fest verankert in unseren Genen, in unserem Selbstverständnis, in der Geschichte und unserer Auffassung vom eigenen gesellschaftlichen Sein, dass wir sie nicht einmal probeweise in Frage stellen
Die Gewaltkriminalität ist überall hoch. Gewalt findet aber auch innerhalb der Beziehung statt, und zwar im Gegensatz zu einem weit verbreiteten Vorurteil bei beiderlei Geschlecht: Nach Schätzungen zeigte sich, dass in der Bundesrepublik insgesamt etwa 1,59 Millionen Frauen im Alter zwischen 20 und 59 Jahren mindestens einmal Opfer physischer Gewalt in engen sozialen Beziehungen waren. Für Männer betrug die entsprechende Anzahl 1,49 Millionen.
Die Ausplünderung des Planeten durch die Konzerne vor allem über Billiglöhne ist zur globalen Strategie geworden und hat die Skrupellosigkeit der alten Kolonialmächte mehr als ersetzt. Weite Teile des Planeten sind durch Raubbau verkarstet oder von Müll bedeckt, die Luftverschmutzung hat zu einem starken Anstieg von Allergien und Asthma geführt. Wenige Prozent der Menschheit – die Superreichen – leben auf Kosten der Mehrheit, indem sie andere ausbeuten und ihnen durchgreifende Hilfe oder Teilhabe an ihrem Überfluss verweigern. Etwa eine Milliarde Menschen hat keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser.
Nicht zu Unrecht spricht man von einer immer weiter perfektionierten „Abzockgesellschaft“. Verstärkt wird dieser Trend unter anderem dadurch, dass die Möglichkeiten der Kontrolle für den Einzelnen deutlich geringer werden. Das liegt am steigenden Komplexheitsgrad unser Lebensumwelt, der vor allem durch den technischen Fortschritt bedingt ist. In der Lebensmitteltechnologie zum Beispiel kann viel unauffälliger aus Profitgründen manipuliert werden als früher.
Die Folgen für den Verbraucher sind nur schwer oder gar nicht abschätzbar, wie das BSE-Problem zeigt. Technik und Verwaltung haben ein Maß an Undurchschaubarkeit erreicht, das es dem Durchschnittsverbraucher kaum noch erlaubt, seine Steuererklärung oder Stromabrechnung zu verstehen. In Werbung und Technik, in Politik und Kultur, in dem, was man vortäuscht und verschweigt zeigt sich deutlich unsere radikale Orientierung auf Gewinn, unsere grenzenlos anmutende Habgier.
Ob Auschwitz und Hiroshima, Kolonialismus, Kreuzzüge, Ausrottung der Indianer, Hexenverfolgung, Leibeigenschaft, Sklaverei, Fundamentalismus oder Terrorismus – fast immer ist es, vorgeblich, die Kraft, die Gerechtigkeit oder das Beste will, aber dann doch wieder Leiden erzeugt. Religion, die vorgeblich Gottes Willen verwirklicht, schafft nur zu oft größere Übel, als sie dem atheistisch Gesinnten jemals in den Sinn kommen würden. Gottes vorgeblicher Wille wird zum Deckmantel für die eigene Willkür, die aus emotionaler Desorientiertheit entspringt.
In den Medien wie auch im Film dominieren Berichte über Gewalttaten und Gewaltdarstellungen. Kaum ein Experte bestreitet noch, dass hoher Konsum von Gewaltvideos in Einzelfällen und bei ungünstiger Lebenssituation zur Nachahmung animieren kann. Im Durchschnitt vierzigtausend Morde (!) haben amerikanische Jugendliche bis zum ihrem 18. Lebensjahr im Kino und Fernsehen gesehen.
Vandalismus kostet die öffentlichen Verkehrsbetriebe jährlich Millionenbeträge. Das Phänomen „Graffiti“ ist allgegenwärtig an unseren Hauswänden. Wer Wände besprüht, schert sich offensichtlich wenig um das Eigentum und die Gefühle anderer. Graffiti ist selten „Kunst“, sondern meist nur Bild gewordene Aggressivität.
Die Selbstmordquote ist zwar von 1980 (23,56 Prozent) bis 1999 (13,6 Prozent) kontinuierlich heruntergegangen. Trotzdem unternimmt gegenwärtig noch alle vier Minuten in Deutschland jemand einen Selbstmordversuch. Alle 45 Minuten nimmt sich in Deutschland ein Mensch das Leben. Das sind im Jahre 99 11157 Personen.
Ärzten geht es dabei offensichtlich auch nicht besser: „Ausgerechnet die Mediziner, die eigentlich Leben retten sollen, bringen sich doppelt so häufig um wie Angehörige anderer Berufsgruppen; bei Ärztinnen liegt die Selbstmordrate sogar vierfach über dem Durchschnitt.“ „Die Tendenz zum Freitod ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.“
Die wenigsten Staaten orientieren sich konsequent an demokratischen Idealen. Wahlbetrug und Wahlmanipulation sind auch in Ländern, die sich als Demokratien bezeichnen, an der Tagesordnung. In vielen Teilen der Welt wird gefoltert. Der bevölkerungsreichste Staat der Erde, China, verweigert seinen Einwohnern nach wie vor die Grundrechte.
Korruption ist kein Privileg asiatischer Provenienz oder mittelamerikanischer Bananenrepubliken, sondern auch in der Bundesrepublik Alltagsrealität, wie die Spendenskandale der CDU und SPD beweisen. Seine Steuererklärung zu manipulieren, gilt dabei den meisten nur noch als Kavaliersdelikt.
Die Politik denkt überwiegend in Kategorien von Einflusszonen und des Machterhalts und wie sich Rohstoffressourcen und Absatzmärkte sichern lassen.
Der Einzelne setzt ebenfalls klare Prioritäten: Geld und Besitz, Status, Macht, Einfluss, Ruhm, Vergnügen. Nach der Shell-Studie des Jahres 2002 sind Jugendliche selbstbezogener und mehr auf den eigenen Vorteil bedacht als früher. Die eine Hälfte empfindet sich als „selbstbewusste Macher“ und „pragmatische Idealisten“, die andere Hälfte dank schlechterer Voraussetzungen als „Verlierer“.
Oft wird ein großer Teil des Lebens Zielen geopfert, die sich, wenn sie endlich erreicht sind, als nicht annähernd so erstrebenswert erweisen, wie man gehofft hat. Befriedung und Erfüllung bleiben hinter den Erwartungen zurück.
Unser ernüchterndes Resümee lautet leider nur allzu oft: „Wenn ich gewusst hätte, was es heißt Kinder großzuziehen ...“ – „Wenn ich vorausgesehen hätte, was es bedeutet, Arzt zu sein …“ – „Wenn ich geahnt hätte, wie viel Kompromisse die Ehe verlangt …“
Das langersehnte und mit viel Anstrengung erarbeitete Eigenheim entpuppt sich als überraschend hoher Kostenfaktor mit viel mehr Arbeit als jede Mietwohnung. Oder wie sorgen uns ein Leben lang um die Höhe unserer Rente, die viel zitierte „Alterssicherung“, um dann wenige Jahre nach dem Eintritt ins Rentenalter zu sterben.
Selbst Reichtum erweist sich nicht unbedingt als Glücksgarant. Sein dauerhafter Einfluss auf unser seelisches Wohlbefinden ist keineswegs gewährleistet, wie die vielen Beispiele mürrischer und gelangweilter Millionäre zeigen. Auch bei Lotto-Millionären pegelt sich das Glücksempfinden schon bald wieder auf dem alten Stand ein. Sind die Grundbedürfnisse und ein gewisses Max an Bequemlichkeit gesichert, dann lässt sich das Fühlen durch Wohlstand kaum noch beeinflussen.
Geld befreit uns zwar von vielen Beschwernissen und macht das Leben leichter und bequemer. Mit viel Geld müssen wir vielleicht weniger leiden, doch fehlt oft das seelische Äquivalent, das sich in positiven Gefühlen zeigt. Nicht anders verhält es sich mit dem Motiv, eine Familie zu gründen, wie die extrem hohe Scheidungsrate zeigt. Es ist ein offenes Geheimnis, dass den meisten Menschen weder der Arbeitsalltag noch die Zukunft in besonders rosigen Farben erscheinen. Man „wurstelt“ sich so durch. Man muss zufrieden sein. Es geht uns doch gut …
94 Prozent der Bundesbürger schätzten sich nach einer Untersuchung aus dem Jahr 1984 als sehr oder relativ zufrieden mit ihrem Leben ein. Eine Studie aus dem Jahre 1998 ermittelt 71 Prozent „ziemlich glückliche“ und 20 Prozent „sehr glückliche“ Menschen. Nur 9 Prozent bezeichnen sich als „ziemlich oder sehr unglücklich“.
Doch der Selbstauskunft des Menschen über sein Glück ist nicht unbedingt zu trauen. „Glücklich“ ist oft nur ein Äquivalent für „zufrieden“. Und zufrieden meint nicht unbedingt, dass positive Gefühle erfahren werden – die, wie sich noch zeigen wird, entscheidend sind für echte Werterfahrungen. „Zufrieden“ ist man auch bereits dann, wenn man weitgehend leidensfrei ist, d.h. keine Krankheiten, keine Sorgen, keinen ausgeprägten Stress hat.
Die bloße Abwesenheit von Negativität ist jedoch noch nicht mit erlebter Positivität gleichzusetzen. Abwesenheit von Negativität ist zwar „positiv“. Aber positive Erfahrungen gehen weit über das Fehlen negativer Erfahrungen hinaus.
Der Eindruck, Selbstauskünften sei nicht immer zu trauen, wird auch durch die Beobachtung unterstützt, dass viele Patienten, die wegen somatischer Beschwerden in die Arztpraxis kommen, sich nicht als depressiv erkennen können. „Depressive Patienten brauchen die Einsicht, dass sie krank sind.“
Heerscharen amerikanischer Schüler schlucken Ritalin, um ihre Konzentration zu verbessern, oder Paxil, das gegen Schüchternheit hilft. Prozac Fluctin, das bekannte Antidepressivum, wurde zeitweise in amerikanischen Kleinstädten von Hausärzten wie Aspirin verordnet. Zur Leistungssteigerung wird Modafinil eingesetzt, das den Wachheitsgrad erhöht.
Ein weiter Hinweis darauf, wie wenig Selbstauskünfte und Selbsteinschätzungen für bare Münze genommen werden dürfen, ist unserer Trink- und Rauchverhalten. Wenn man unterstellt, dass Alkohol vor allem zur (oft unbewussten) Gefühlsveränderung konsumiert wird, und erst in zweiter Linie wegen des Geschmacks oder um seinen Durst zu löschen, dann dürfte es sehr bezeichnend sein, dass die Deutschen gegenwärtig im Jahr etwa 12 Milliarden Liter Bier trinken. Wo so massiv Gefühle und Stimmungen verändert werden, da kann man wohl zu Recht ein beträchtliches Defizit an Wohlgefühl vermuten.
Ein Großteil der mindestens 19 Millionen regelmäßigen Raucher in Deutschland kann als suchtkrank angesehen werden. Nikotin ist eine der am schnellsten süchtig machenden Drogen. Rauchen vermittelt den begehrten „Erleichterungskick“ und wirkt aktivierend und stimmungsaufhellend.
Der kanadische Pharmakologe Paul B. Clarek wies in Versuchen mit Ratten nach, dass die Tiere ihr Lustzentrum stimulieren konnten, indem sie sich über eine Apparatur per Tastendruck Nikotin in die Blutbahn verabreichten – und vieles spricht dafür, dass Mensch und Ratte sich in ihrem Suchtverhalten gleichen. Wissenschaftler der Howard-Universität in Washington konnten in Versuchen mit Ratten nachweisen, dass das Nervengift sogar als Antidepressivum wirkt. Viele Raucher scheinen mit Nikotin ihre Depressionen zu bekämpfen, vermuten Forscher.
Umgekehrt führt Nikotinentzug zu Stimmungstiefs, die bis zur Depression reichen können. Aufmerksamkeit und Konzentration verschlechtern sich. Langzeitraucher benötigen ihre tägliche Dosis nicht erst, um sich besser, sondern um sich normal zu fühlen (!). Auch neun Tage nach dem Rauchentzug, so konnte der amerikanische Pharmakologe Jack Henningfeld zeigen, war die geistige Leistungsfähigkeit noch nicht wieder auf dem alten Niveau. Nur maximal drei bis vier Prozent der Versuche, mit dem Rauchen aufzuhören, sind erfolgreich.
Die latente, weil oft unbewusste Fadheit des Alltags bei aller kaum zu lösenden Problematik durch Krieg und Terror, durch Gewalt, Hunger und Armut in der Welt zeigt sich auf vielen Ebenen. Populäre Unterhaltungsmusik und Heftchenromane, sofern sie uns die Idylle eine heilen Welt vorspiegeln, wirken auch deshalb so kitschig, weil wir unterschwellig spüren, dass dieses Bild nicht stimmig sein kann.
Unsere Gesellschaft ist, wie man jeden Tag aus den Medien erfährt, sexuell, ja sexistisch orientiert. Doch hier werden öffentlich Ideale vorgespiegelt, die keiner sachlichen Überprüfung standhalten. Tatsächlich regiert vielfach Unlust in den Schlafzimmern. Um nur ein Beispiel zu nennen: „Ungefähr 50 Prozent der Frauen leiden laut einschlägigen Umfragen unter einer Störung ihrer sexuellen Erlebnisfähigkeit. Das heißt im Klartext: Fast die Hälfte der Frauen kommt nie oder nur sehr selten zum Höhepunkt.“
58 Prozent der Männer und 51 Prozent der Frauen bezeichnen Sex sogar als „Stress“, so Umfrage bei 1015 Befragten im Auftrag der Zeitschrift „Fit for Fun“.
Die Lustfeindlichkeit ist zwar seit Oswald Kolle weitgehend aus den Schlafzimmern verschwunden. Lust ist kein Tabu mehr. Das gute Gewissen zum positiven Gefühl hat zugenommen. Aber Erotik und Sexualität sind durch zu viel Offenheit und Leistungsdruck entzaubert.
Versucht man statt aus Befragungsergebnissen Schlüsse aus dem Eindruck zu ziehen, den Menschen im Alltag auf uns machen, dann scheint dieses Bild die Selbstauskünfte eher zu widerlegen oder doch zumindest korrekturbedürftig zu sein: Wir finden selten glückliche Gesichter. Wenn überhaupt, dann vermitteln die meisten Menschen eher den Eindruck mäßiger Begeisterung und verhaltenen Interesses. Lachen ist in diesem Alltag eher die Ausnahme, Freude weder in Gesprächen noch in der Gebärdensprache oft zu entdecken.
Was gut und interessant am Leben ist, wird bevorzugt in die Zukunft verlegt: in den Urlaub, die Beförderung, die Ehe, den Ruhestand. Viele wirken gelangweilt, angespannt, mürrisch, gestresst. Sie gehen einer überwiegend freudlosen Routine nach. Und das ist angesichts der Monotonie und fehlenden Kreativität eines durchschnittlichen Arbeitsalltags auch kaum verwunderlich. Arbeit – das heißt nur allzu oft: kleinliches Vorgesetztengehabe, Mobbing, Intrigen, Jagd nach Pöstchen.
Nach einer Gallup-Umfrage geben nur 15 Prozent aller Arbeitenden an, dass ihnen die Arbeit Spaß mache – doppelt so viel Männer übrigens wie Frauen. 16 Prozent haben die sogenannte „innere Kündigung“ ausgesprochen und identifizieren sich nicht mehr mit den Zielen oder dem Sinn ihrer Arbeit. 69 Prozent machen lediglich Dienst nach Vorschrift. 85 Prozent aller Arbeitnehmer, so der Umkehrschluss, erleben ihre Arbeit demnach als nichtssagend, wenn nicht sogar als langweilig oder emotional belastend. Als verantwortlich dafür wird auch das autoritäre Verhalten deutscher Arbeitgeber angesehen: Ein deutlicher Hinweis darauf, dass es unserer Führungselite an emotionaler Klugheit mangelt.
Doch auch das Umfeld der Arbeit ist selten attraktiv. Der Tag beginnt mit immer gleichen Aufgaben. Arbeitsweg – das bedeutet für viele: Verspätungen, volle Züge, verschmutzte Toiletten, Lärm, Aggressivität, verstopfte Straßen. Auch die schnelle Bereitschaft, bei einer Belastung unfreundlich, aggressiv, frustriert zu reagieren, spricht nicht für eine positive Laune und Grundbefindlichkeit.
Impulsivität gilt als eines der Hauptprobleme, wenn wir „emotional intelligenter“ werden wollen. So auch Daniel Goleman, dem wie einigen amerikanischen Neurologen dafür vor allem die überschnelle Reaktion des Mandelkerns vor allem rationalen Abwägen verantwortlich ist: jenes emotionalen Zentrums im Gehirn, ohne das wir keine Gefühle hätten.
Nur allzu zu gut vertraut ist uns allen unsere Aggressivität im Straßenverkehr. Da wird um Sekunden und Meter gekämpft und dabei nicht selten das eigene und fremde Leben in Gefahr gebracht. Da beweist man seinen sozialen Status mit PS und der Überholgeschwindigkeit, ist genervt und ständig in Eile, straft jeden Regelverstoß im Verkehr mit wütenden Beschimpfungen – und leert dann bei der nächsten Rast seinen Aschenbecher am Straßenrand aus.
Auch Jugendliche sind, zumal in der Pubertät, keineswegs immer die glatt und „cool“ funktionierenden Angepassten, die uns Jugendkultur, Musik und Mode suggerieren. Ein Blick auf (anonyme) Anfragen an eine Beratungsstelle mag das belegen.
Thomas, 15 Jahre:
„Ich frage mich oft, ob das Leben einen Sinn hat für mich. Ich denke oft, dass es für mich am besten wäre, nicht mehr zu leben. Aber ich habe nicht vor, mich umzubringen. Ich hätte auch gar nicht den Mut dazu. Aber was kann ich tun, um das Leben sinnvoll zu finden?“
Anna 13 Jahre:
„Mir ist immer so langweilig. Ich weiß gar nicht, was ich den ganzen Tag machen soll. Was soll ich den ganzen Tag tun?“
Tina, 15 Jahre:
„Ich habe Probleme mit dem Essen. Immer öfter muss ich nach einer Mahlzeit erbrechen. Dann gibt es aber auch Tage, an denen ich richtige Fresssuchtattacken habe. Was kann ich tun?“
Sabine, 14 Jahre:
„Ich leide unter Bulimie, ich habe regelrechte Fresssuchtattacken.“
Sarah, 15 Jahre:
„Ich fühle mich oft deprimiert. Ich habe zu nichts richtig Lust und manchmal finde ich es so schlimm, dass ich mich umbringen möchte. Was soll ich tun?“
Antje, 16 Jahre:
„Meine Freundin schnippelt sich die Haut auf. Ich mache mir Sorgen. Mit wem kann ich darüber reden? Wo gibt es kompetente Gesprächspartner? Soll ich ihre Eltern ansprechen?“
Tim, 13 Jahre:
„Ich bin oft unheimlich wütend. Und ich kann meine Wut nicht beherrschen. Wenn etwas passiert und ich werde wütend, gehe ich auf jeden los, der mir in die Quere kommt. Ich sage dann Dinge, die ich so gar nicht meine, und hinterher bereue ich das dann. Was kann ich tun, um meine Wut besser unter Kontrolle zu halten?“
„Immer mehr Kinder, so scheint es, sind psychisch labil. Bis zu zwei Schüler in jeder Klasse gelten als hyperaktiv oder aufmerksamkeitsgestört. Kinder schlucken 20-mal so viele Psychopillen wie noch vor zehn Jahren; das Therapieangebot kann der Nachfrage kaum folgen. Wächst in Deutschland eine Generation von Neurotikern, Hektikern, Nervensägen und Transusen heran?“, fragt der SPIEGEL.
Die Zahl der verhaltensgestörten Kinder ist in den vergangenen 30 Jahren in Deutschland sprunghaft gestiegen. „Heute leidet jedes fünfte Kind unter Sprachstörungen, motorischen Störungen, Verhaltensstörungen oder Konzentrationsstörungen“, so der Vorsitzende des Forums Jugendmedizin, Edgar Friederichs.
Im Jahr 1970 sei dies erst bei jedem dreißigsten Kind der Fall gewesen. Allein in den letzten zehn Jahren habe sich die Zahl der hyperaktiven Kinder, die den der Betäubungsmittelverordnung unterliegenden Wirkstoff „Methylphenidat“, bekannt als Ritalin, verordnet bekommen, verzehnfacht. Kindliche Entwicklungsstörungen führen laut Friederichs häufig zu frühem Drogenkonsum, Lern- und Leistungsstörungen und höherer Straffälligkeit.
Auffallend ist auch unser hohes Maß an Kritikbereitschaft. Hier zeigt sich ganz klar, dass wir in Politik und Gesellschaft, in Ausbildung, Wohnumfeld und Straßenverkehr wenig in Ordnung finden.
Kritik geht fast immer vor Lob und Zufriedenheit. Die in Befragungen ermittelte Zufriedenheit ist anscheinend weitgehend „private“ Zufriedenheit – Fehlen materieller Sorgen. Dass wir unzufrieden mit unseren Politikern sind, dass ihren Versprechungen nicht zu trauen ist, muss schon beinahe als sprichwörtlich angesehen werden.
Oft hadern wir mehr, als wir gutheißen. „Früher war alles besser“ ist die Standardauskunft älterer Menschen. Am Stammtisch, an der Theke entlädt sich nur allzu leicht der Volkszorn über Renten und Verkehrspolitik, über Genmanipulation uns verseuchte Nahrungsmittel, über Ausländerzuzug und Kriminalitätsraten, über Schulwesen und desinteressierten, auf sein Vergnügen bedachten Nachwuchs.
Solche Äußerungen sind als Werturteile zu verstehen. Fast niemand scheint sich dabei aber jemals die Frage zu stellen, worin sich denn Werturteile und Beschreibungen (von Missständen) unterscheiden (falls sie sich unterscheiden). Was treiben wir eigentlich, wenn wir in dieser Weise urteilen?
Was ist das Ziel, der Maßstab, das Kriterium, das dem Werturteil seine Berechtigung verleiht?
Vielleicht das Glück des Einzelnen oder der größten Zahl, wie die britischen Werttheoretiker Hutcheson und Bentham im achtzehnten Jahrhundert glaubten? Was genau bedeutet dann „Glück“? Ältere, verheiratete, religiöse Menschen z.B. sind nach vielen Studien „glücklicher“ als junge, atheistische Singles. Doch welcher Art ist dieses Glück? Handelt es sich wirklich um emotionale Erfüllung?
Wer sein Glück einschätzt, urteilt zunächst einmal und zwangsläufig intuitiv. Er versucht, der Sprachkonvention gerecht zu werden, die er mit Worten wie „Glück“ und „Zufriedenheit“ verbindet. Solche Auskünfte sind selten ganz falsch, aber sie sind doch oft schief, weil die Bedeutung dieser Ausdrücke keineswegs klar ist. Tatsächlich handelt es sich um extrem verschwommene Begriffe.
Welchen Grad von Exaktheit soll aber eine Selbstauskunft besitzen, die sich auf so unklare Kriterien stützt? Definieren wir zum Beispiel ein Dreieck „als geometrische Figur mit drei untereinander winklig verbundenen Graden, deren Wesen unabhängig von der Art des Materials ist“, so handelt es sich dabei um eine recht präzise Definition. Auf ähnliche Weise erlangen wir in vielen Alltagsbelangen ein hohes und ausreichendes Maß an Eindeutigkeit.
Die Definition von „Zufriedenheit“ und „Glück“ erlangt auch nicht annähernd solche Eindeutigkeit
Ist Zufriedenheit ein Werturteil oder Gefühl? Wie drückt sie sich überhaupt aus? Und welchen Wert sollten wir ihr zumessen? Wird Zufriedenheit gedacht oder gefühlt? Welchen Anteil haben Denken und Fühlen an der Zufriedenheit? Was ist überhaupt ein Gefühl – falls es sich bei Glück und Zufriedenheit um Fühlen handelt? Selbst Psychologen, Psychiater und Philosophen tun sich schwer, darauf eindeutigen Antworten zu geben. In der Atomphysik und im Straßenverkehr würde ein derartiges Maß an Unwissenheit wahrscheinlich schnell ihn einer Katastrophe enden.
Die Frage nach unseren Gefühlen ist deshalb kein nur akademisches Problem, weil der Mensch auch leidet, ohne es – explizit – zu wissen. Emotionale Wirkungen spielen sich oft auf einer halbbewussten Ebene ab. Der Grund dafür liegt unter anderem darin, dass Gefühle meist nur mitbewusst sind, nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Verdrängung des Leidens, Beschönigung, Vergessen, Nicht-auf-den-Begriff-Bringen sind dabei allgegenwärtige (und nur zu verständliche) Alltagsstrategien.
Das Resümee unser Bestandsaufnahme lautet, dass viele, wenn nicht sogar die meisten Menschen, bei weitem nicht jenes Maß an emotionaler Erfüllung erlangen, nach dem sie selbst mit allen Kräften streben würden, wenn sie wüssten, worum es sich handelt
Was sind die Ursachen dieser mangelnden Lebensqualität? Wir suchen ihre Gründe zu oft ausschließlich in den bekannten Lebensumständen. Verfehlte Politik, Armut, das Klima, die Gene, der Kapitalismus, Umweltbelastungen, Ungerechtigkeit, aufgebrauchte Ressourcen, zunehmender Verkehr, Schnelllebigkeit, menschliche Habgier, Hass, Gleichgültigkeit, fehlendes Wohlwollen sollen für unsere emotionale Misere herhalten.
Wir fragen dagegen kaum nach den tieferen weltanschaulichen Hintergründen, nach unser Auffassung vom Leben. Welche Rolle spielen solche Grundeinstellungen? Welche Rolle spielt unsere Unwissenheit? So viel scheint festzustehen, stellten wir bereits fest: Die meisten von uns leben in einem Zustand permanenter Selbstentfremdung und Desorientiertheit. Unsere Motive und Wertvorstellungen sind über weite Strecken Selbsttäuschungen.
Ist die menschliche Geschichte womöglich das Ergebnis von Desorientiertheit und bestenfalls intuitivem Handeln auf Glück?