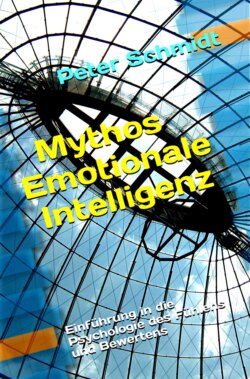Читать книгу Mythos Emotionale Intelligenz - Peter Schmidt - Страница 7
Оглавление1 Emotionale Desorientiertheit
Fast die ganze Welt, so könnte man glauben, ist sich selbst entfremdet. Denn viele Menschen leben in einem Zustand permanenter Desorientiertheit hinsichtlich ihrer allgemeinen Lebensziele und ihres Lebenssinns. Unsere Motive und Wertvorstellungen sind über weite Strecken Selbsttäuschungen.
Wir wissen zwar im Einzelnen recht genau, was wir jeweils wollen. Aber wir wissen nicht oder nur äußerst selten, warum wir wollen, was wir wollen. Folglich mangelt es uns an Klarheit darüber, warum wir eigentlich wollen sollten, was wir nicht so genau wissen. Und warum man nur das aus guten Gründen wollen kann, was wir wollen sollten.
Ein wichtiger Grund für diese Selbstentfremdung, die man durchaus als „emotionale Desorientiertheit“ bezeichnen könnte, liegt in unseren mangelnden Begriffen und in unserer geistigen Trägheit und Bequemlichkeit, auf grundsätzliche Lebensfragen intelligente Antworten zu finden. Was die Frage nach dem Sinn und Wert des Lebens anbelangt, sind wir Dilettanten geblieben. Darin erreicht unsere Intelligenz auch nicht annähernd ein ähnlich hohes Niveau wie bei der Lösung der Aufgaben, ein Garagentor einzubauen, zum Mond zu fliegen oder die Leistung unserer Computerchips zu steigern. Hier steht die Aufklärung bestenfalls am Anfang.
Auch Philosophie und Psychologie, die Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften haben darin versagt, uns zu erklären, was das Ziel des menschlichen Handelns ist – vielleicht, weil sie zu voreilig davon ausgingen, dass es sich um eine Vielzahl höchst unterschiedlicher, individueller Ziele handelt? Offenbar lag es ihnen fern, auch nur die Möglichkeit zu erwägen, in all unseren Wertvorstellungen, Motivationen und Entscheidungen lasse sich ein identisches Prinzip finden.
Hinsichtlich der zentralen Frage nach dem Sinn und Wert des Lebens ist die Geschichte der Philosophie eine Folge blamabelster Fehlschläge, die jeden Philosophiestudenten an der Kompetenz all jener hoch geschätzten Theoretiker der Vergangenheit und Gegenwart zweifeln lassen sollte. Wir finden überall einen Mangel an Grundlagendenken. Bezeichnend für dieses Versäumnis ist die resignative Haltung des Philosophen Ludwig Wittgenstein, wonach Philosophie unsere Lebensprobleme im Kern gar nicht berühre.
Sieht man von – allerdings oft rudimentären und völlig ungenügenden – Ansätzen in der Antike, in der englischen Philosophie des 17. und 18. Jahrhunderts, der deutschen Wertphilosophie, etwa bei Windelband, Rickert, N. Hartmann und Scheler oder der Existenzphilosophie nach dem Ersten Weltkrieg ab, gelang es bisher nie, überzeugend zu bestimmen, worin Wert und Ziel des Lebens bestehen.
Auch die sogenannte Psychologie der „Emotionalen Intelligenz“ geht bei allen Verdiensten als Vorreiter eines neuen Nachdenkens über Gefühl und Intelligenz hinsichtlich der Frage nach dem Wert eher halbherzig zu Werke. Ihr publizistischer Initiator, der amerikanische Psychologe Daniel Goleman, hatte 1995 in Emotionale Intelligenz eine Reihe psychologischer Vorarbeiten und Untersuchungen zusammengefasst, die zeigen sollten, dass unser gewöhnlicher Intelligenzbegriff nicht zureichend ist, um erfolgreiches Handeln zu charakterisieren. Vielmehr bedarf es zu dessen Erklärung eines weiteren Faktors, den man „emotionale Intelligenz“ nannte, der aber vielleicht treffender „emotionale Klugheit“ genannt werden sollte. (Während der Intelligenzbegriff eher starre Fähigkeiten charakterisiert, beinhaltet „emotionale Klugheit“ auch ein gewisses Maß an Erfahrung und wohlüberlegter Intention, sich weiser zu verhalten, als es spontane Intelligenz nahelegen würde.)
Golemans Arbeit fand sowohl Zustimmung wie Kritik. Emotionale Intelligenz wurde zu einem populären Begriff. Eine Fülle von Untersuchungen und Ratgebern bemächtigte sich des neuen Themas. Doch einigen kritischen Köpfen war nicht entgangen, dass seine Theorie auf ziemlich tönernen Füßen steht. So fehlt ihr fast vollständig der geistesgeschichtliche Bezug. Bis auf wenige Ausnahmen vermitteln Golemans Ausführungen den Eindruck, es habe Denker wie Aristippos, Epikur, Hobbes, Hume, Bentham, Kant, Nietzsche, Brentano, Wundt und Scheler nie gegeben – oder was sie zum Thema beizusteuern hätten, sei zumindest recht belanglos gewesen. Aber vor allem mangelte es seinen Ausführungen an grundsätzlichen Bestimmungen.
Was ist eigentlich ein „Gefühl“? Merkwürdigerweise wird diese Frage bei Goleman nirgends hinreichend thematisiert. Unterscheiden sich Gefühle von Emotionen? Welche Funktion haben Gefühle und Emotionen? In welchem Verhältnis stehen sie zu den Stimmungen, Affekten, Neigungen und Leidenschaften? Welche Beziehungen haben Gefühle zu unseren Werterfahrungen und Werturteilen?
Golemans Definition der emotionalen Intelligenz lautet: Es ist „die Fähigkeit, unsere eigenen Gefühle und die anderer zu erkennen, uns selbst zu motivieren und gut mit Emotionen in uns selbst und in unseren Beziehungen umzugehen.“ (Daniel Goleman: EQ2. Der Erfolgsquotient, München 1999, S. 387.)
Dem kann man schwerlich widersprechen. Etwas gut zu tun, war schon immer unser unwidersprochenes Ideal. Selbst der Teufel wird sein Werk in guter Weise tun wollen, also erfolgreich in seinem Sinne; auch wenn das Ergebnis dann weniger wünschenswert für uns ausfällt.
Goleman versäumte es jedoch wie seine amerikanischen Kollegen, den zentralen Faktor seiner Definition zu erläutern, geschweige, ihn hinreichend zu analysieren. Was heißt es eigentlich, „gut“ mit Emotionen umzugehen? Emotionale Intelligenz bleibt so lediglich ein Mythos.
Erst durch eine genauere Analyse des Gefühlsbegriffs war es möglich, zu bestimmen, was als das alleinige Ziel unseres Handelns anzusehen ist.
Die Bestimmung des Begriffs „Gefühl“ ist nun allerdings ein sehr altes, fast schon ehrwürdiges Problem. Es gilt vielen Theoretikern offensichtlich als unlösbar wegen des schillernden und schwer greifbaren Charakters der Gefühle. Man kann die Gefühle anderer Menschen nicht direkt mit den eigenen vergleichen, sondern nur mittels Beschreibung und Analogieschluss. Wir verfügen nur über eine intuitive Bestimmung des Begriffs. Wir wissen zum Beispiel, dass Sorgen und Schmerzen zu den „negativen“ Gefühlen gehören, Glück und Wohlbehagen dagegen zu den „positiven“.
Der Begriff des Gefühls wurde in der Antike vornehmlich unter den Begriffen „Lust“ und „Unlust“ oder auch, je nach Übersetzung, „Freude“ abgehandelt. Später sprach man von „Leidenschaften“, aber erst seit dem siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert wird die Bedeutung des Begriffs umfassender thematisiert. (Adolf Hitler: Mein Kampf, Band zwei, 14. Kapitel, „Ostorientierung oder Ostpolitik“). Dabei betraf die Kontroverse vor allem die Rolle von Lust und Unlust, wie zum Beispiel in Thomas Hobbes sehr einflussreichem „Leviathan“.
Dieser Streit scheint nun im Wesentlichen durch neuere Analysen und Definitionen geklärt, auf die später ausführlich eingegangen wird. Möglich war dies erst, nachdem auf befriedigende Weise der Zusammenhang der Begriffe Gefühl und Wert entwickelt wurde. Klarere Begriffe öffnen uns oft die Augen für Sachverhalte, die sonst durch die zu weiten Maschen unserer von der gerade geltenden Sprachkonvention geprägten Wahrnehmung fallen.
Das Ergebnis dieses neuen Blicks auf das Leben stimmt allerdings alles andere als optimistisch:
Wir sind Opfer unserer allgegenwärtigen emotionalen Desorientiertheit
Es erscheint nicht übertrieben, uns eher als „emotionale Irrläufer“ denn als zielstrebig auf Lebenssinn und Werte orientierte intelligente Lebewesen zu verstehen.
Bei einigen Menschen handelt es sich dank angeborener emotionaler Intelligenz oder erworbener emotionaler Klugheit eher um milde Formen von Irrläufertum, insofern sie nicht oder nur sehr vage wissen, wozu sie leben. Allerdings führt auch diese Desorientiertheit in Krisensituationen leicht zu Fehlern und Irrwegen.
In anderen, schwereren Fällen finden wir alle nur denkbaren negativen Folgen wie Nihilismus, Despotismus, Zynismus, Egozentrik, Zerstörung und Gewalt, die sich nicht selten in Selbstmord, Amokläufen, Kriegen und Terrorismus, fundamentalistischen Werteinstellungen und Gewaltherrschaft äußern. Oder solche emotionale Desorientiertheit führt zu Depressionen und wahnhaften psychotischen Reaktionen als Fehleinschätzungen der Realität.
Vom Nachweis dieses Sachverhalts, seiner genaueren Bestimmung und von möglichen Auswegen aus unserem emotionalen Desaster handelt diese kritische Untersuchung
Krieg und Terrorismus, Verbrechen, Unterdrückung, Ausbeutung und Fundamentalismus, aber auch Depression und Sinnleere, erscheinen nach dieser Bewertung als in gewissem Sinne folgerichtige Verhaltensweisen, die zu einem erheblichen Teil aus unserer allgegenwärtigen Desorientiertheit resultieren. Es mag daher Anlass zu der Hoffnung geben, dass Aufklärung hinsichtlich der wahren Rolle unserer Gefühle hier gegenzusteuern vermag – dass schon ein Fünkchen mehr emotionale Klugheit, wie sie aus einem besseren Grundverständnis unseres Fühlens – nennen wir es die „Grammatik der Gefühle“ – entstehen könnte, zu weniger Leiden führt. Solche Analysen erfordern allerdings eine fast schon kopernikanische Wende unseres Selbstverständnisses.
Wenn wir uns als Erdenbewohner nicht mehr heliozentrisch verstehen, wenn wir uns als durch Evolution aus dem Tierreich entstanden erkennen, wenn wir uns als das Ergebnis von unbewussten Prozessen begreifen, wie es die Psychoanalyse und Untersuchungen des amerikanischen Neurophysiologen B. Libet nahelegen – dann sind dies Veränderungen unseres Selbstbildes, denen zunächst verständlicherweise beträchtlicher Widerstand entgegengesetzt wurde, weil man sich so nicht sehen wollte; weil es unangenehm war, diesen Wahrheiten ins Auge zu blicken.
Die längst fällige kopernikanische Wende in unserem Selbstverständnis der Motivationen ist womöglich ein Schritt, der unser Selbstbild noch radikaler entzaubert. Denn hier geht es darum, viele Tausend Jahre alte, selbstverständlich gewordene Wertvorstellungen als Illusionen zu entlarven. Unsere Kultur lebt von solchen Selbsttäuschungen, wie sich noch zeigen wird. Sie sind ein allgegenwärtiges Agens der Geschichte – aber sie sind auch ein klares Zeichen der Selbstentfremdung.
Selbstentfremdung wird hier als ein mentaler Zustand definiert, in dem wir gar nicht oder nur eingeschränkt unsere persönlichen Ziele und Motive verwirklichen können
Selbstentfremdet zu sein, bedeutet, mehr als nötig zu leiden. Und zwar aus Gründen zu leiden, die weniger in widrigen Umständen und im gewöhnlichen Lebenskampf liegen als in unserem mangelnden Verständnis allgemeiner Lebensprinzipien. Selbstentfremdung bedeutet, in Krisensituationen (wie zum Beispiel bei einem Suizid) nicht angemessen reagieren zu können, weil uns die Grundorientierung fehlt.
Selbstentfremdung zeigt sich aber auch in unseren versäumten Lebensmöglichkeiten, in der Lebensqualität, die uns entgeht, weil wir nicht wissen, wozu wir eigentlich da sind und welchen für alle Menschen identischen Sinn das Leben über den individuellen Sinn hinaus hat, den jeder für sich selbst entdecken kann.
Der Begriff der Selbstentfremdung wird hier also umfassender verwendet als im üblichen Sprachgebrauch:
1) Selbstentfremdung ist nicht wie bei Marx beschränkt auf die fehlende Kontrolle des Arbeitenden über die Arbeit, weil er keine Produktionsmittel besitzt.
2) Oder im weiteren Sinne als selbstentfremdeter Zustand des Menschen durch die ihm von den Herrschenden aufoktroyierte Massenkultur, insofern sie der Emanzipation und Aufklärung im Wege steht, wie bei Horkheimer und Adorno. Oder auch, ähnlich, als Nicht-bei-sich-selbst-Sein, sondern stattdessen der Alltagsroutine und Oberflächlichkeit in der Masse verfallen wie bei Heidegger.
3) Selbstentfremdung wird hier auch nicht begrenzt auf den seelischen Zustand, bei dem bewusste und unbewusste Bereiche nicht auf dasselbe Lebensziel hinarbeiten, weil sie sich widersprechen oder ihnen der Einklang fehlt, wie bei Freud.
Sondern alle diese Faktoren – aber auch völlig andere – können je nachdem mehr oder weniger ursächlich sein für jenen allgemeineren – ja allgemeinsten – Begriff der Selbstentfremdung, die darin besteht, dass wir das, was wir insgeheim wollen, nicht erreichen, weil wir gar nicht wissen, was wir wollen sollen.
Wenn wir selbstentfremdet sind, wird Konventionen und Bräuchen mehr Gewicht beigelegt als nötig. Dann sind wir nicht selbstbestimmt, sondern zu unserem eigenen Nachteil außengeleitet, und neigen dazu, in kleinlicher Regelbefolgung zu erstarren. Oft fehlt es uns dabei an Lebendigkeit und Entdeckerfreude, an Kreativität und Vitalität, an Freude und Optimismus.
Im Zustand der Selbstentfremdung tendiert unsere Stimmung dahin, gedrückt oder doch wenigstens nichtssagend und unattraktiv zu sein. Denn die Frage „Wozu das alles?“ steht unausgesprochen oder ausgesprochen im Raume. Das gilt erst recht, wenn wir Belastungssituationen ausgesetzt sind. Wir spüren, dass wir nicht genau wissen, wozu wir leben. Und leider reagieren unsere Gefühle auf „Sinnleere“ und oberflächliche Vergnügen nur all zu oft mit Frustration und Aggression, mit psychosomatischen Beschwerden, mit Zynismus und übertriebener Kritik oder dem Bedürfnis nach Exzessen, gleichgültig, ob solche Eskapaden unsere Gesundheit schädigen oder das gesellschaftliche Klima vergiften.
Unsere Äußerungen sind dann oft blass und einfallslos oder auch auf manische Weise rechthaberisch. Denn wir spüren, dass wir etwas ändern müssen, wissen aber nicht genau, wo wir den Hebel ansetzen sollen. Hier liegt das objektivistische Missverständnis der Werte besonders nahe: Die anderen machen irgendetwas falsch. Und wo sonst sollte dieser Fehler liegen, wenn nicht in den objektiven Verhältnissen und Verhaltensweisen? Der andere wird dabei oft als Langweiler wahrgenommen, als manischer Egomane oder Narziss, wenn nicht sogar als rücksichtsloser Egoist und Ausbeuter, der allerdings alles daran setzt, seinen Egoismus zu rationalisieren und zu bemänteln. Ist man unter solchen gesellschaftlichen Bedingungen nicht gezwungen, es den anderen gleichzutun?
Selbstentfremdung bedeutet darüber hinaus, für den anderen, die Gemeinschaft und das gesellschaftliche Umfeld ein Faktor zu sein, der Negativität erzeugt. Der Politiker, der Lehrer, der Diktatur, der Geschäftsmann, der Feldherr, der sich selbst entfremdet ist und der seine eigenen mentalen Hauptprinzipien nicht erkannt hat, d.h. jene Prinzipien, die ihn ein positives, erfülltes Leben anstreben lassen:
Wer selbst nicht intakt ist, droht seine Negativität auch auf andere zu übertragen
Was unsere wahren Ziele und Motive sind, braucht dabei nicht immer genau bekannt sein. Wir können vordergründige Ziele verfolgen, die uns sehr plausibel erscheinen, deren genauere Analyse dann aber zeigt, dass wir uns selbst nicht verstanden haben. Auch darin – in dieser Desorientiertheit – liegt unsere Selbstentfremdung. Und die Folge dieses Mangels ist, dass wir wegen unserer Desorientiertheit unsere eigentlichen Lebensziele nicht realisieren.
Selbstentfremdung kann als allgegenwärtiges Problem unserer Kultur angesehen werden
Hier könnte man einwenden: Aber wie ist denn überhaupt generelle Kritik möglich angesichts der großen Verschiedenheit der Menschen, ihrer unterschiedlichen Wünsche, Motivationen und Ansichten? Setzt Gesellschaftskritik nicht voraus, über die persönlichen Ziele anderer besser Bescheid wissen als der Betroffene selbst? Wäre es nicht vermessen, über die „wahren“ Lebensziele anderer urteilen zu wollen?
Unsere Legitimation, auch die Individualität des anderen in die Analyse einzubeziehen, leitet sich daraus ab, dass wir eben nicht nur Individuen mit ganz unterschiedlich Gefühlen, Motivationen und Interessen sind, sondern darüber hinaus trotz aller Verschiedenheit identischen mentalen Prinzipien gehorchen. Unser Werterleben lässt sich auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Jedes Werturteil und jede Werterfahrung, die mit recht so genannt werden könnte, folgt einem immer gleichen Schema. Dies ist allerdings eine der am wenigstens bekannten und dabei doch offensichtlich wichtigsten Einsichten, die man im Leben haben kann.