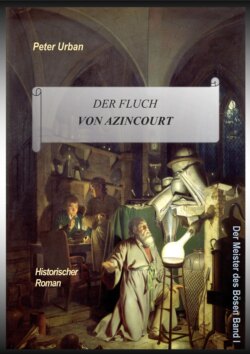Читать книгу Der Fluch von Azincourt Gesamtausgabe - Peter Urban - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Prolog Das Manuskript des Abraham Eleazar
ОглавлениеI
Irgendwo in den Haselsträuchern am Ufer sang eine Lerche. Die Luft war süß und schwer mit dem Geruch von blühendem Holunder. Für einen kurzen Augenblick legte Guy de Chaulliac den Kopf in den Nacken und blinzelte zum Himmel hinauf, der sich im hellsten Frühlingsblau über ihnen wölbte. Er genoss die Wärme der Sonne auf seiner Haut. „Meine Reise war erfolgreich“, sagte er schließlich bedächtig, während sie sich anschickten Seite an Seite den engen Pfad von der Anlegestelle den Hügel hinauf, zu gehen.
Hinter ihnen keuchten zwei Kriegsknechte, denen die undankbare Aufgabe zugefallen war, Chaulliac auf dem Wasserweg von Concarneau bis nach Carnöet zu begleiten. Die Männer schwitzten in ihren schweren Kettenhemden und den doppelt genähten, wattierten Surcotten aus grün gefärbtem Leder. Auf ihren übereinandergelegten Schilden balancierten sie mühselig Guys Gepäck; zwei große, prall gefüllten Satteltaschen und eine solide Holzkiste, in der sich die Werkzeuge seiner Zunft und ein paar Schriftstücke befanden.
„Es tut mir leid“, erwiderte der Herzog von Cornouailles, “der berittene Bote ist schon vor zwei Tagen hier eingetroffen. Mein Hauptmann auf Concarneau ist misstrauisch und argwöhnisch. Er wollte zuerst sicher gehen, dass Du auch willkommen bist. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, Dich schon so kurze Zeit nach unserer letzten Zusammenkunft wiederzusehen. Es wäre einfacher gewesen mir vorab Nachricht aus Paris zu schicken. Du hättest Dir einen weiten und mühsamen Umweg erspart.“
Chaulliac schmunzelte. Dann schüttelte er den Kopf: „Ambrosius, wenn es nur darum gegangen wäre, Dir zu berichten, wie unsere gemeinsame Freundin Valentina ohne große Mühe ihren Gemahl Louis überzeugen konnte. Ein zuverlässiger Mann und ein schnelles Pferd hätten ausgereicht, Dir zu berichten, dass er endlich einsieht, wie vorteilhaft es ist, den Cadwalladr mit Truppen gegen Lancaster zu unterstützen.“
Der Herzog vertrieb mit einer lässigen Handbewegung drei Knaben, die sich ihnen bereits unten am Bootssteg, wie Kletten an die Fersen geheftet hatten. Das heikle Thema der Unterstützung des walisischen Aufstands durch französische Kriegsknechte und Ritter im Beisein seiner beiden Söhne und ihres Freundes zu besprechen, schien ihm wenig weise. Noch bevor sie das erste Sonnwendfeuer entzünden würden, wären schon allerlei haarsträubende Gerüchte auf dem Weg nach Quimperlé, Pont Aven und Rennes und er konnte davon ausgehen, dass bereits vor dem nächsten Neumond einer von Lancasters Spionen an Bord eines Schiffes nach England segelte. Er schmunzelte. Es würde noch ein paar Jahre dauern, bevor er seinen Söhnen oder dem jungen Arzhur in dieser Hinsicht Vertrauen schenken konnte. Für die drei Jungen war das ganze Leben noch Spiel und Abenteuer und sie verstanden kaum, wie wichtig es war, ihre Zungen im Zaum zu halten, wenn sie überleben wollten. Erst als er ganz sicher war, das sich die drei jugendlichen Tunichtgute auch wirklich außer Hörweite befanden, wandte er sich wieder Guy de Chaulliac zu.
Seine Augen hatten einen seltsamen Glanz bekommen: „Sind die Franzosen ebenfalls bereit, die Rechtmäßigkeit des Anspruchs von Owain ap Gruffydd auf die Krone von Wales anzuerkennen“, fragte er skeptisch.
Chaulliac verzog die dünnen Lippen zu einem zynischen Lächeln: „Mesire Louis d'Orléans hat nicht lange gezögert, bevor er Dein Angebot annahm. Die Kassen seines Bruders sind leer. Ich nehme an, dass Iolo Goch, Owain Glendowers Barde bereits morgen früh zur ersten Stunde aufbrechen wird, um seinem Herren in Sycharth Castle die gute Nachricht zu überbringen. Ihr steht jetzt nicht mehr alleine gegen den englischen Thronräuber und seine Schergen…“, er hielt inne. Dann deutete der Okzitanier kurz mit dem Kopf in Richtung auf die drei Knaben. Sie waren zwischenzeitlich zurück zum Fluss gerannt und hatten ihre völlig verdreckten Kniehosen abgestreift, um sich nackt, wie am Tage ihrer Geburt mit lautem Jauchzen und Gejohle in die kalten Wasser zu stürzen.
„Der stämmige, breitschultrige Bursche mit den strohblonden Haaren. Das ist doch der jüngste Bruder von Yann de Montforzh, nicht wahr?“
Ambrosius schmunzelte: „Arzhur! Ja! Es tut dem Jungen gut, die schwere Zeit zu vergessen, die sie alle hinter sich haben.“
„Ich habe bei Hof zu Paris das Gerücht aufgeschnappt, dass Yann endgültig mit Olivier de Clisson gebrochen und dem Cadwalladr ebenfalls Truppen versprochen hat.“
Das sonnengebräunte, scharf geschnittene Gesicht des Herzogs von Cornouailles verzog sich zu einem hinterlistigen Grinsen, das seinen Zügen nicht besonders schmeichelte. Er ähnelte mehr denn je einem hungrigen Raubvogel. Doch er fasste sich sofort wieder und wurde ernst und geschäftsmäßig: „Genug von diesem heiklen Thema, Guy“, flüsterte er mit einer leichten Kopfbewegung in Richtung auf die Männer, die weiter hinter ihnen den Hang hinauf ächzten, „doch wenn Louis d’Orléans nicht der Grund ist. Du hast diesen weiten Weg aus der französischen Hauptstadt doch gewiss nicht nur deswegen auf Dich genommen, um mit einem alten Freund gemütlich bei einem Glas Rotwein zu plaudern. Was führt Dich wirklich nach Cornouailles?“
Auch Chaulliac warf einen kurzen, prüfenden Blick über die Schulter. Die beiden Kriegsknechte mit ihrer schweren Last waren außer Hörweite und die neugierigen Kinder aalten sich immer noch, wie Fische im Fluss: „Wir müssen uns zu einem wesentlich heikleren Thema besprechen, als der Aufstand des Cadwalladr, Ambrosius. Und dann müssen wir gemeinsam eine Entscheidung treffen“, erklärte er anstelle einer Einleitung, „eine schwerwiegende Entscheidung, wie ich befürchte…“
Der Herzog nickte nur, dann führte er Chaulliac über eine kleine, in den Stein gehauene Treppe zu einem abgeschiedenen Garten, der auf einem überhängenden Felsen, direkt über den Wassern der Laïta angelegt worden war. Der Ort schien menschenleer und wirkte seltsam unwirklich, fast verzaubert. In einem Meer aus blühenden Blumen, direkt neben einer kleinen Quelle, die aus dem Berg in ein moosbewachsenes, großes Natursteinbecken sprudelte setzten die beiden Männer sich auf eine mit vielen, bunten Kissen bequem ausgestattete Bank. Aus dem Nichts tauchte hinter ihnen plötzlich ein junger Mann auf. Er trug ein einfaches, altertümlich anmutendes, ärmelloses, schwarzes Gewand. Das lange, dunkle Haar fiel ihm in weichen Wellen offen über die breiten Schultern und wurde nur von einem hauchdünnen, silbernen Reif gebändigt. Die fein geschnittenen Linien seines bartlosen Gesichtes ähnelten entfernt denen des Herzogs von Cornouailles, dachte Chaulliac. Aber seine Augen waren anders: von dunkler, beinahe schwarzer Farbe und nicht lebendig und lebhaft, wie die seines Freundes sondern furchteinflößend, erbarmungslos und kalt, wie Eis. Er seufzte leise und schüttelte kaum merklich den Kopf.
II
Maeliennyd Glyn Dwyr freute sich über den frischen Blütenduft. Sie liebte es, alleine und ungestört durch den lichten Laubwald zu spazieren, der sich um die Festung von Carnöet in alle vier Himmelsrichtungen erstreckte. Insbesondere ein kleiner Weg hatte es ihr angetan; dieser folgte eine Weile dem Flusslauf in Richtung auf die Mündung der Laïta und auf den Atlantik zu und bog dann zu einem der Nebenarme der Laïta ab, der einen Waldsee speiste. Ein leiser Windhauch, der durch die Zweige strich, lies fein, wie Schnee weiße Blütenblättchen von wilden Apfelbäumen und Holundersträuchern auf sie herabregnen, während ihre nackten Füße auf einem leuchtend grünen Bett aus Moos voranschritten, das so weich war, wie der neue, bunte, orientalische Teppich in ihrem Gemach, den ihr Gemahl von seiner letzten Reise nach Al Andalus mitgebracht hatte.
Langsam ging sie ihren Lieblingsweg entlang in Richtung auf den Waldsee. In dieser Jahreszeit waren die Ufer des Sees über und über mit violetten und zart rosa Anemonen übersät. Und man fand dort ebenfalls einen kleinen Flecken Erde, auf dem Erdbeerspinat wuchs, einer seltsamen kleinen Pflanze, die saftige, leicht säuerlich schmeckende Früchte trieb, die in ihrem Aussehen und in ihrer dunkelroten Farbe in der Tat an richtige Erdbeeren erinnerten. Die Herzogin von Cornouailles schmunzelte und strich sich mit der Hand etwas verschämt über den prallen Leib, der sich unter ihrem luftigen Gewand wölbte. Denn ungezügelten Appetit auf süße und saure Dinge verdankte sie ihm.
Ganz so, als ob er sie dazu ermuntern wollte, endlich ihren Schritt zu beschleunigen, damit sie ans Ziel ihrer Wünsche gelangten, trat der Kleine kräftig zu. Aus Maeliennyds Schmunzeln wurde ein Lächeln: Er war noch nicht auf der Welt, aber er wusste bereits, wie man seinen Willen durchsetzt.
Zuerst hatte sie eine Weile den Frauen Gesellschaft geleistet, die dabei waren, alles für das Fest vorzubereiten. Sie kochten, brieten, räucherten und backten schon seit Tagen eifrig, ganz so, als ob sie sicherstellen wollten, das in diesem Jahr die langen Holztische in der Nacht der Sonnwendfeuer von Bealltainn vor lauter Überfluss zusammenbrachen.
Maeliennyd schämte sich immer noch ein bisschen, weil sie von allen guten Speisen genascht hatte, wie eine ungezogene Göre. Natürlich hatten die Frauen gelacht und Späße gemacht. Sie hatten auf Maeliennyds dicken Bauch gezeigt und prophezeit, dass es bei einem so heftigen Appetit der Mutter auch dieses Mal wieder ein kräftiger Junge werden würde. Die Herzogin schüttelte den Kopf. Als sie ihre Töchter getragen hatte, war sie genauso hungrig gewesen, wie jetzt und als sie mit ihren beiden Söhnen schwanger gewesen war, hatte es ihr den Appetit verschlagen. Niemand konnte vor der Geburt sagen, ob ein Junge oder ein Mädchen das Licht der Welt erblicken würde, ungeachtet dessen, was eine werdende Mutter in sich hineinstopfte oder nicht...
Endlich sah sie das Wasser des kleinen Sees durch das Blätterwerk hindurch aufblitzen. Mit der Rechten fasste Maeliennyd den Saum ihres Gewandes, um schneller laufen zu können, denn nun hatte sie auch die kleinen, leuchtendroten Früchte ausgemacht, für die sie den weiten Weg auf sich genommen hatte. Sie war alleine. Niemand beobachtete sie. Ohne zu zögern, kniete Maeliennyd Glyn Dwyr sich hin, pickte gierig Hände voller Beeren und schob sie sich genüsslich in den Mund. Das kleine Wesen schien zufrieden. Munter kugelte es sich in ihrem Bauch.
III
Guy beglückwünschte sich kurz dazu, dass der Hauptmann von Concarneau für seine Begleitung nur zwei einfache Kriegsknechte ausgewählt hatte und keines dieser sonderbaren Geschöpfe, ähnlich jenen, die er damals auf dem Gipfel des Mézenec in seiner eigenen Heimat kennengelernt hatte. Sie wachten dort, von Generation zu Generation, von Vater zu Sohn, seit den Tagen der Keltenkönige des Velay über den Tombarel.
Der junge, dunkle Mann stand regungslos, wie eine Statue vor ihnen. Um seine sonnengebräunten, muskulösen Arme wanden sich von den Handgelenken bis hinauf zu den breiten Schultern dunkelblaue, in die Haut tätowierte, geflügelte Drachen. Als er für einen kurzen Augenblick den prüfenden, kalkulierenden Blick des Wächter von Barc'h Hé Lan auf sich ruhen spürte, lief Guy ein eisiger Schauer den Rücken hinunter. Endlich senkte der junge Mann die Augen und neigte ganz leicht das Haupt vor dem Herzog von Cornouailles. Dann stellte er wortlos das Tablette mit dem Weinkrug und den zwei Bechern vor ihnen ins Gras und verschwand wieder auf die gleiche rätselhafte Weise aus dem Garten, wie er zuvor gekommen war.
Chaulliac trank dankbar einen Schluck des angebotenen Weins, vertrieb die Gedanken an den unheimlichen, dunklen Krieger und schloss die Augen. Er fühlte sich ein wenig wie jener Fischer in dem orientalischen Märchen, der eine Flasche entkorkte und einen Geist herausließ, der um ein Vielfaches stärker war, als er selbst: „Ambrosius“, sagte er leise, „ich habe es wiedergefunden.“
„Dann hat der Orden sich damals also doch geirrt“, erwiderte der Herzog. In seinen Augen funkelte plötzlich so etwas, wie Gier. Selbst die langersehnte Unterstützung und Anerkennung für seinen hart bedrängten Schwiegervater durch den unerbittlichsten Feind der Engländer schien mit einem Mal unwichtig und belanglos geworden zu sein.
Chaulliac genoss sichtlich den kurzen Augenblick der Hochspannung. Sie hatten Zeit, sie waren alleine und niemand drängte sie. Er konnte sich den Luxus gönnen und die ganze Geschichte von Anfang bis Ende zu erzählen. Natürlich würden sie hinterher sehr ernst miteinander beraten müssen. Er fuhr sich mit der Zunge über die Lippen und stellte seinen Becher zurück ins Gras. „Später“, sagte er zu sich selbst, „später. Jetzt erzähle ihm erst einmal von Meister Nicolas Flamel und der Handschrift.“
„Du hast doch gewiss schon einmal von diesem Notarius des Collegium Sorbonianum gehört, der vor ein paar Jahren über Nacht sagenhaft reich wurde und dann überall in Paris und in Boulogne-sur-Mer Armenhäuser und Spitäler stiftete!“
Ambrosius nickte. Natürlich hatte er von dem Mann gehört. Aodrén hatte öfter von diesem Notarius erzählt und von den wilden Gerüchten, die über ihn im Quartier Latin kursierten: ein rätselhaftes Grimoarium, uralte, mächtige Zauber und das Geheimnis der Umwandlung unedler Metalle in Gold.
Damals, als er sie zum ersten Mal gehört hatte, da hatte er die Geschichte ausgesprochen amüsant gefunden. Er war kaum älter gewesen, als sein älterer Sohn Aorélian. Er hatte sich sehr bildhaft vorgestellt, wie der weise Aodrén ohne seinen langen, weißen Bart, mit faltenlosem Gesicht und jugendlichem Eifer gemeinsam mit dem hochgelehrten Medicus Guy de Chaulliac, Großvater seines eigenen Freundes Guy, Autor der berühmten Chirurgia Magna, Leibarzt dreier Päpste und Arzt des Königs von Frankreich gemeinsam nächtelang im Dunklen vor einem Skriptorium in der Rue de Marivaux auf der Lauer gelegen hatte, nur um herauszufinden, was es denn nun wirklich mit dem Grimoarium von Nicolas Flamel und den haarsträubenden Gerüchten auf sich hatte.
Etwa zur gleichen Zeit, in der diese beiden sehr gelehrten Männer sich aufgemacht hatten, einen selbsternannten Alchimisten und Hexenmeister zu bespitzeln, war nämlich auch der französische König Charles V. auf eine ähnliche Idee gekommen. Diese höchste Einmischung hatte der Geschichte ihren besonderen Reiz gegeben: König Charles V. hatte zu jener Zeit unter der Führung seines Staatsrates de Cramoisi eine Untersuchungskommission gegen den Notarius Flamel eingesetzt. Für gewöhnlich endeten Männer, die Bekanntschaft mit königlichem Interesse und solchen Kommissionen machten entweder wegen Ketzerei und Hexerei auf dem Scheiterhaufen, oder sie verschwanden in irgendeinem finsteren, unzugänglichen und schwer bewachten Verließ. Doch Meister Flamel hatte alles vollkommen unbeschadet überstanden. Und er erfreute sich offensichtlich trotz des königlichen Interesses an seiner Person bis zum heutigen Tage immer noch allerbester Gesundheit und lebte völlig unbehelligt dort, wo er schon damals gelebt hatte.
IV
Aodrén Jaouen Kréc'h Elis streunte gemütlich durch den Wald. Der Tag der Sonnwende war strahlend und schön angebrochen und er war, von den ersten Sonnenstrahlen bereits sehr früh geweckt worden. Er konstatierte mit großer Zufriedenheit und erheblichem Stolz, dass die Fülle des anbrechenden Sommers immer noch in seinen alten Knochen strömte, obwohl er sich wegen seines ansehnlichen Alters gelegentlich einzureden versuchte, den Gezeitenstrom von Sonne und Mond nicht mehr spüren zu können. Aodrén war nach dem Ermessen aller ein außergewöhnlich betagter Mann. Er selbst leugnete nicht einmal, dass er inzwischen auch schon vergessen hatte, wie viele Sommer er wirklich zählte…und trotzdem hatte er im Augenblick des Sonnenaufgangs an diesem Morgen doch wieder die volle Kraft der schönen Jahreszeit in sich gespürt.
Andächtig strich er mit den dürren, langen Fingern über den schlohweißen Bart, der bis hinab zum Gürtel seines Gewandes reichte. Dann hielt er kurz inne und sah sich um. Viele der Bäume hatten knorrige Äste, die tief bis auf den Boden hinab hingen. Er betrachtete sie alle eine Weile mit prüfendem Blick. Schließlich machte er den aus, der ihm für eine kleine Ruhepause am See am Bequemsten erschien.
Auch sein Weib war wirklich nicht mehr die Jüngste. Aodrén überlegte kurz, murmelte etwas vor sich hin und zählte an den Fingern ab. Ja. Er hatte sie zum ersten Mal unter den Feuern von Bealltainn erblickt, nachdem er damals aus Paris zurückgekehrt war. Dort hatten sie zusammen mit dem alten Guy de Chaulliac und ein paar anderen angesehenen Gelehrten im Auftrag des französischen Königs dieses Gutachten über den schwarzen Tod erstellt. Er erinnerte sich noch genau daran, wie sie damals nach einer vierwöchigen, hitzigen Debatte am Ende einstimmig zu dem Schluss gekommen waren, dass es die ungünstige Konjunktion von Jupiter, Saturn und Mars am 24.März des Jahres 1345 gewesen sein musste - nur drei Tage nach der Frühjahres-Tag-und-Nacht-Gleiche. Diese Konstellation der Gestirne hatte jene schwerwiegende atmosphärische Veränderung verursacht, die letztendlich für den Ausbruch der großen Pest verantwortlich gewesen war. Also musste sein braves Weib in dem Jahr auf die Welt gekommen sein, in dem der erbärmliche Pietro Rainalducci gestorben war, der als Papst Nikolaus V. eine zweifelhafte Bekanntheit errungen hatte.
Und trotzdem hatte er beim Frühstück das Gefühl gehabt, das sie von ihrer gemeinsamen frühmorgendlichen Anstrengung doch weitaus weniger mitgenommen schien, als er selbst es in diesem Augenblick war. Aodrén kicherte und seine haselnussbraunen Augen leuchteten, als er die Gedanken in die Vergangenheit zurückschweifen ließ. Ein bisschen mehr als ein halbes Jahrhundert war also seit jener Nacht von Bealltainn vergangen, als diese gertenschlanke, rothaarige und glutäugige Schönheit - kaum mehr als ein Mädchen - fordernd ihre kleine, schmale Hand nach ihm ausgestreckt hatte, um mit ihm durch das Sonnwendfeuer zu springen. Er erinnerte sich noch ganz genau daran, wie er zuerst gezögert und sich geziert hatte. Er hatte sich vor den anderen fast ein wenig geschämt. Damals war er noch so sehr auf seinen Ruf als Gelehrter bedacht gewesen, dass es ihm Angst eingejagt hatte, zugeben zu müssen, dass er eben auch nur ein ganz normaler Mann war.
Obwohl es ihnen nicht verboten war, entschlossen sich doch nur ganz wenige der Weiße Brüder dazu, ein Weib zu nehmen und eine Familie zu gründen. Die Art und Weise, wie sie lebten eignete sich nicht sonderlich gut für eine solche Verantwortung. Vielleicht war es ja dieses sprühende Leben in ihr gewesen, das ihm schließlich die Angst vor der Verantwortung und der gemeinsamen Zukunft genommen hatte. Er hatte sie angelächelt, seine ganze Scheu und alle seine Bedenken in den Wind geschlagen und zugegriffen und dann war er ihr in den Wald gefolgt und sie hatte ihn eingefangen und nie wieder losgelassen. Es war die weiseste und klügste Entscheidung seines ganzen langen Lebens gewesen.
„Vielleicht“, sagte Aodrén erwartungsfroh zu sich selbst. Wenn er sich jetzt weitab des ganzen Trubels ein paar Stunden ausruhen würde... Er schmunzelte beim Gedanken an die verwirrten Blicke, die sie ihm alle heute Nacht zuwerfen würden. Dieses Mal würde er es sein, der die Hand fordernd nach ihr ausstreckte, um noch einmal gemeinsam durch das Feuer zu springen.
Er beugte sich hinunter und strich kurz prüfend mit der Hand über das weiche Moos. Gelegentlich machten ihm steife Knochen zu schaffen.
„Ja“, dachte er schließlich, „ das sieht immer noch recht gemütlich aus.“ Natürlich würden sie ihn alle für vollkommen verrückt halten, in seinem fortgeschrittenen Alter noch einen solchen jugendlichen Unfug mitzumachen. Aber wenn er sich jetzt ein paar Stunden ausruhte, dann war er vielleicht immer noch für einen kleinen nächtlichen Ausflug in den Wald gut, auch wenn er gewiss kein zweites Mal am selben Tag ein kleines Wunder, wie am Morgen vollbringen konnte. Aber sie würden sich Arm in Arm miteinander ins Moos legen und die Sterne betrachten und sich dabei gemeinsam daran zurückerinnern, wie überschwänglich sie in ihren jüngeren Jahren immer den Sommer willkommen geheißen hatten…und nicht nur den Sommer.
„Neun hübsche Töchter“, sagte Aodrén ausgesprochen gutgelaunt und munter zu den süß duftenden Holundersträuchern, die am Ufer des Sees in voller Blüte standen, „und drei Dutzend fröhlicher Enkelkinder. Das ist doch gar nicht so übel für einen knorrigen, alten Baum!“
Maeliennyd hatte eigentlich vorgehabt sich umdrehen und so leise, wie möglich davonschleichen, denn sie wollte nicht, das der weise Mann sich irgendwie verletzt fühlte, weil sie ihn unbeabsichtigt bei seinem kleinen Selbstgespräch belauscht hatte. Aber Aodrén musste ihre leichten Schritte wahrgenommen haben, denn er drehte sich um.
„Ach, Du bist es, Herzogin von Cornouailles“, rief er munter und winkte ihr vergnügt zu. Seine Mundwinkel zuckten amüsiert und seine haselnussbraunen Augen lachten, als er mit der knochigen Rechten einladend auf den Ast klopfte, auf dem er es sich bequem gemacht hatte.
Maeliennyd holte tief Luft, fuhr sich rasch mit einem Taschentuch über die Lippen, die vom Genuss der fruchtigen, säuerlichen Spinaterdbeeren rot und klebrig war und streckte ihm schließlich ihre Hand entgegen, um sich schwerfällig auf den angewiesenen Platz helfen zu lassen. Der unförmige, geschwollene Leib machte es ihr nicht leicht, auf dem schmalen Ast das Gleichgewicht zu halten und dabei ihre Würde zu wahren. Gutmütig legte Aodrén den Arm um sie.
„Ich habe mich eine Weile mit den Frauen unterhalten…“, erklärte sie, sozusagen als Entschuldigung für ihre einsame Wanderung im Wald.
„Und da diese sich im Augenblick mehr für das Kochen, das Braten, das Backen und das Kinderkriegen interessieren, hast Du beschlossen die Flucht zu ergreifen, bevor es Dir von dem vielen Durcheinandernaschen wieder einmal speiübel geworden wäre“, spottete der alte Mann und tätschelte in einer vertraulichen Geste sanft den schwangeren Leib der Herzogin.
„ Interessieren diese Dinge Dich im Augenblick wirklich nicht, mein Kind“, fragte er mit leisem Spott in der Stimme, „oder bedauerst Du etwa doch Deine waghalsige Entscheidung, meinen Trank abzulehnen.“ Das Lachen hatte sich aus seinen haselnussbraunen Augen davongeschlichen und einem prüfenden, besorgten Blick Platz gemacht. Aodrén war der ständige Heißhunger der Herzogin von Cornouailles im Verlauf der letzten Wochen natürlich nicht entgangen, genauso wenig, wie die Tatsache, dass sie trotzdem ständig an Gewicht zu verlieren schien. Und unter ihren Augen zeichneten sich kaum merklich feine, dunkle Ringe ab, die darauf hindeuteten, dass sie nachts nur wenig Ruhe fand. Obwohl ihre Haut von der Sonne bereits zart braun gefärbt war, entging es seinem erfahrenen Blick nicht, dass sich unter dieser frühsommerlichen Bräune eine leise Blässe der Anstrengung verbarg. Maeliennyd Glyn Dwyr schien schwer an ihrem sechsten Kind zu tragen.
Sie war bereits fünfunddreißig Jahre alt gewesen, als sie zu ihrer eigenen großen Überraschung und dem Entsetzten ihres Gemahls festgestellt hatte, wieder schwanger zu sein…sieben lange Jahre nach der Geburt ihres jüngsten Sohnes Glaoda.
Ambrosius Arzhur hatte an jenem Tag seine Herzogin angefleht, das Kind abzustoßen, denn er erinnerte sich immer noch voller Grauen an jenen anderen Tag, an dem sein jüngster Sohn auf die Welt gekommen war…genauso, wie Aodrén selbst sich natürlich daran erinnerte. Glaoda hatte Maeliennyd damals beinahe umgebracht. Doch die Herzogin war aus irgendeinem undurchschaubaren Grund ungewöhnlich stur geblieben und hatte dickschädelig darauf beharrt, entgegen alle Vernunft dieses Kind auszutragen.
Während der Geburt ihres jüngsten Sohnes, als die Schmerzen der Herzogin kein Ende genommen hatten, hatte Ambrosius Arzhur seine gepeinigte Gemahlin gar für eine kurze Zeit aus ihrem Körper geholt. Aodrén nahm an, dass sie damals gemeinsam einen Augenblick lang voller Entsetzen auf Maeliennyds geschundene Hülle hinuntergeblickt haben mussten, denn sie hatte ihrem Gemahl ein paar Tage später, als sie sich wieder etwas besser gefühlt hatte, hoch und heilig geschworen, niemals mehr ein solches Risiko auf sich zu nehmen. Cornouailles hatte zwei gesunde Söhne. Die Zukunft und das Überleben des kleinen Landes waren gesichert.
„Ich habe alles vergessen, Aodrén“, sagte die Herzogin von Cornouailles fast entschuldigend und mit leiser Stimme, „ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern. Und nein…ich bedauere es nicht“, fügte sie ein wenig lauter und sehr bestimmt hinzu, „ ich bin froh, nicht auf Dich gehört zu haben.“
Aodrén blickte sie verwundert an. Die Art und Weise, wie sie diese letzten Worte ausgesprochen hatte, hatten ihn ein wenig erschreckt. Er erinnerte sich noch sehr gut: Er hatte damals drei endlos lange Tage und drei grauenvolle Nächte an ihrer Seite verbracht; Ihr ganzer Körper hatte im Fieber geglüht. Keiner seiner Heiltränke hatte dieses Kindbettfieber zu Anfang senken können. Sein ganzes Wissen, seine ganze Kunst und die Erfahrung von Jahrzehnten schienen nutzlos. Und dann hatte die Gluthitze abwechselnden Hitze-und Kälteschauern Platz gemacht, die Aodrén vorgekommen waren, wie Wochen, Jahre, Jahrhunderte. Er konnte heute nicht einmal mehr sagen, wer damals vor sieben Jahren wirklich den Sieg über den Tod davongetragen hatte…er und seine Heilkunst und seine Zauber oder ihr walisischer Dickschädel und die legendäre Sturheit, die Maeliennyd Glyn Dwyr von ihrem Vater König Owain geerbt hatte. Vielleicht war es ja auch unwichtig.
Er schluckte kurz und trocken. In den Augen der Herzogin von Cornouailles bemerkte er eine unnachgiebige Härte und eine trotzige, geradezu kindische Entschlossenheit, die ihm furchtbare Angst einjagte. „Herzogin“, versuchte er sie zur Vernunft zu bringen, doch sie schnitt ihm barsch das Wort ab.
„Nein, Aodrén. Ich bereue es wirklich nicht und außerdem vertraue ich darauf, dass Du auch dieses Mal wieder alles tun wirst, was in Deiner Macht steht, um das Kleine gesund und sicher auf die Welt zu bringen“, sagte sie bestimmt. Ihre schlanke, feingliedrige Hand löste sich von dem Ast, an dem sie Halt gesucht hatte und legte sich in einer Geste tiefer Vertrautheit und großer Zuneigung auf die bärtige Wange des alten Mannes. „Es ist der Wille der höheren Mächte. Sie haben mir dieses letzte Kind geschenkt“, dann erhob sie sich schwerfällig und ging, ohne sich noch einmal umzudrehen zurück in Richtung der Festung von Carnöet.
V
Ich erinnere mich ganz genau“, antwortete Ambrosius von Cornouailles seinem Freund trocken. Die dunklen Augen des Herzogs blickten in eine weit entfernt zurückliegende Vergangenheit, während er mit seinem Bericht fortfuhr.
„Alles hat sich damals einfach in Luft aufgelöst: die königliche Kommission wurde über Nacht entlassen, de Cramoisi wurde hinausgelobt und mit einem Sack Gold und einem Landsitz irgendwo in der Nähe von Aulnay abgefunden. Sein Sekretär verschwand in die Provinz, wo er sich im Handumdrehen eine gutbetuchte Witwe und einen Titel erschleichen konnte. Flamel erklärte alle seine großzügigen Stiftungen ohne Probleme. Sein Weib hatte von ihrem Vater, dem Zunftmeister der Buchbinder, ein ansehnliches Vermögen geerbt, das sie sehr gewinnbringend angelegt hatten. Schließlich hatten sie die Buchbinderei verkauft und damit noch einmal einen guten Gewinn erwirtschaftet. Er selbst verdiente mit seinem Skriptorium auch nicht schlecht und der Gehalt, den das Collegium Sorbonianum ihm auszahlte war beachtlich. Soweit ich mich erinnere hat niemand jemals dieses berüchtigte Grimoarium zu Gesicht bekommen….nicht Aodrén und nicht Dein Großvater, die beide wochenlang ihre Nasen an den Butzenglasscheiben des Skriptoriums plattgedrückt hatten, ja nicht einmal de Cramoisi, obwohl dieser mehrfach Flamels Haus und sein Skriptorium von oben bis unten durchsuchen hatte lassen.“
„Ich habe das Grimoarium gesehen“, sagte Guy de Chaulliac und in seiner Stimme schwangen Triumph und auch ein klein bisschen Selbstgefälligkeit. „Und nicht nur das, Ambrosius. Meister Nicolas Flamel hat mir die ganze Geschichte erzählt: Wie er das Grimoarium in die Finger bekam, seine Suche nach dem Sinn der Handschrift, seine Forschungen und schließlich seinen Erfolg. Alles, von Anfang bis Ende…ohne jeden Zwang, einfach so…vor einem warmen Herdfeuer, bei einem guten Glas Rotwein. Mein Freund, es ist in der Tat die Übersetzung, die Bernard de Clairvaux für Hugues de Payns angefertigt hat und die damals gestohlen wurde…ich bin mir ganz sicher…es ist die Übersetzung der Handschrift des Abraham Eleazar.“
„Die Bude war ein Kuriosum“, wiederholte Chaulliac die Worte von Nicolas Flamel, „Auf dem Pont-de-Change halten eigentlich nur die Goldschmiede und die Geldwechsler ihre Geschäfte. Doch der Alte, der dem Notarius damals für den reinen Metallpreis der Messingbeschläge das Manuskript verkaufte, schien ein Pfandleiher, dem es irgendwie gelungen war, sein schmieriges Gewerbe unbemerkt von den königlichen Aufsehern und den Zunftherren auf die Brücke zu schmuggeln. Die Handschrift war einfach achtlos in einen Korb voll alter Metallteile geschmissen worden. Die Beschläge, die den Einband verschlossen hielten, waren völlig verkanntet und ließen sich nur noch mit Gewalt öffnen.“
„Das ist unglaublich“, erwiderte Ambrosius leicht schockiert. „Offensichtlich hat der Mann, den der Großmeister beauftragte, die Templer-Dokumente sicher ins Ausland zu bringen, die Übersetzung doch wieder nach Frankreich zurückgebracht. Aodrén hegte diesen Verdacht ja schon von Anfang an. Ich kann Dir nicht sagen warum, aber er misstraute Diniz von Portugal. Der König schien ihm in dieser ganzen sonderbaren Intrige irgendwie zu hilfsbereit und zu uneigennützig. Ich für meinen Teil würde den Mann, der dafür gesorgt hat, dass das Manuskript unterschlagen wurde allerdings eher im engsten Umfeld der Vertrauten von de Molay selbst suchen. Vielleicht war es ja Sinclair, der Schotte. Er brachte damals nicht nur die Hälfte der Kriegsflotte des Ordens in Sicherheit, sondern auch den größten Teil ihres Schatzes: das Silbers und das Gold, das sie kaum eine Woche bevor Phillipe, de Molay und de Charnay festnehmen ließ übers Meer geschickt haben. Sinclair ist hinterher niemals wieder irgendwo in der bekannten Welt aufgetaucht. Mein Großvater hat sogar Spione nach Schottland geschickt, als Robert the Bruce allen Templern, die es wünschten ohne irgendwelche Bedingungen an sie zu stellen Zuflucht in seinem Reich gewährte.“
„Wenn ich mich richtig erinnere, dann war es doch genau diese portugiesische Hypothese gewesen, um deren Willen sich mein Großvater und Aodrén damals zerstritten hatten. Und auch mein Vater glaubte nicht daran und der Streit, den Aodrén vom Zaun gebrochen hatte, ging mit ihm ohne Unterlass munter weiter“, sagte Chaulliac lakonisch, „ denn sowohl mein Vater, als auch mein Großvater vertraten die Auffassung, dass es der Vertrauensmann von Jacques de Molay selbst gewesen war, der die Übersetzung des Abraham-Manuskriptes entwendet hat. Aodrén jedoch, tat ihn nur als einen unwichtigen Handlanger ab, unwissend und dumm; ein paar breiter Schultern und ein scharfes Schwert, weiter nichts. Ein Kriegshund, den de Molay zur Bewachung seiner Unterlagen abkommandiert hatte. Doch dieser Mann alleine hatte jede Gelegenheit, die Truhe unbeobachtet zu öffnen und das Manuskript zu entnehmen. Lediglich de Molays Testament hat versiegelt in der Kiste gelegen; alle anderen Dokumente wurden Villanova in gebundener Form übergeben, mit soliden Umschlägen aus Leder und genauen Inhaltsverzeichnissen. Der Kerl ging kein besonders großes Risiko ein, nur weil er den Inhalt von de Molays Testament nicht kannte. Er muss im Auftrag einer Splittergruppe im Inneren des Templerordens selbst gehandelt haben. Er stammte aus Okzitanien, aus dem Pays d'Oc...so viel ist sicher, auch wenn niemand je herausfand, wie er wirklich hieß oder zu welcher Familie er gehörte hat. Wir haben aber stichhaltige Beweise dafür gefunden, dass diese Splittergruppe der Templer nicht nur real existiert hat, sondern ebenfalls einen Plan vorbereitete, sich ganz Südfrankreichs zu bemächtigen und es zu einem unabhängigen Reich zu erheben, genauso, wie die Ritter des Deutschen Ordens es im Osten getan hatten, oder die Hospitaler auf der Insel Rhodos. Der Templerorden ist in den Jahren gleich nach seiner Gründung in den Provinzen von der Garonne bis an die Rhone schnell gewachsen und er war gründlich von Parteigängern der Reinen und von Credentes unterwandert worden…bis ganz nach oben in die höchsten Ämter und Würden…Männer aus den Familien Tranceval, de Montreal, Foix, Blanchefort, Verwandte der Grafen von Toulouse…’
VI
Maeliennyd seufzte zufrieden, als sie endlich wieder vor der Tür zu ihrem Gemach stand. Der lange Spaziergang im Wald hatte ihr gut getan und nicht einmal der Gedanke an die Unterhaltung mit Aodrén vermochte ihre wunderbare Laune zu beeinflussen. Ihre Kammerfrau döste auf der Bank am Fenster, fest in ihren Umhang gewickelt, obwohl es selbst hinter den dicken Mauern der Festung überhaupt nicht mehr kalt war. Die anderen Dienstleute waren bereits verschwunden, um sich im Innenhof der umtriebigen Festung oder in der kleinen, bunten Zeltstadt, die sich für ein paar kurze Frühlingstage vor den Mauern von Carnöet eingerichtet hatte mit Freunden, Verwandten und Bekannten zu treffen, die aus der ganzen Umgebung und aus den grenznahen Dörfern der Bretagne gekommen waren. Ihr Gemahl verbrachte die Stunden bis zum Einbruch der Dunkelheit vermutlich mit seinem alten Freund Guy de Chaulliac, der inzwischen aus Concarneau eingetroffen war und ihre Frauen mussten sich bereits hinunter auf die große Wiese begeben haben, wo Ambrosius Arzhur in wenigen Stunden seine Gefolgsleute und Vasallen zu einem großen Festschmaus einladen würde. Maeliennyd blickte noch einmal auf ihre Kammerfrau: Hatte sie etwa den ganzen schönen Tag hier verschlafen, während sie auf die Rückkehr ihrer Herrin gewartet hatte?
Die Herzogin zuckte die Schultern. Sie würde Bran’wen heute nicht mehr brauchen und ankleiden konnte sie sich auch ohne fremde Hilfe. Sie weckte die Alte, die sich mürrisch aufrappelte und dann auf den Weg zu ihrer eigenen Kammer am Ende des Flures machte. Dann ging sie in ihr Gemach. Dort zog Maeliennyd sich einen gemütlichen Lehnstuhl neben einen kleinen Tisch, auf dem in einer großen Schale getrocknetes Obst und ein paar kandierte Süßigkeiten aus Al Andalus für sie hergerichtet worden waren. Zufrieden seufzend legte sie die Füße auf einen Hocker und schloss die Augen. Sie wollte sich ein wenig ausruhen, bevor sie sich für das Fest vorbereitete.
VII
Ambrosius verzog leicht das Gesicht, doch er beherrschte sich. Sie hatten den Felsengarten zwischenzeitlich verlassen und lediglich der leere Krug Wein und die beiden benutzten Becher auf der Bank neben der Quelle erinnerten noch daran, dass sie sich lange dort unterhalten hatten. Es machte keinen Sinn den alten Streit wieder aufleben zu lassen…nicht einmal um den Preis eines solch außergewöhnlichen Geheimnisses. Die verschwundene Übersetzung der Templer hatte innerhalb der weißen Bruderschaft während der letzten einhundert Jahre für zu viel Zwist und Streit gesorgt.
„Die Theorien Deines Vaters und Deines Großvaters in Ehren, Guy“, erwiderte der Herzog darum sehr vorsichtig, während sie Seite an Seite über den Innenhof der Festung zum Wohngebäude schritten. Hier bestand keine Gefahr von irgendjemandem versehentlich belauscht zu werden. Carnöet und die grasbewachsene, freie Fläche, die sich auf einer Seite der Festung bis hinab zum Fluss erstreckte glichen einem Bienenschwarm. Alles war aufgrund der Vorbereitungen für das Fest nur Aufruhr und ein ständiges Kommen und Gehen, “…doch aus welchem Grunde hätten sich Bernard Délicieux und die Carcassoner damals um Beistand ausgerechnet an den schwachen König Ferdinand von Mallorca wenden sollen, wenn sie doch den mächtigen Orden des Tempels zum Verbündeten gehabt hätten. Außerdem; die Reinen des Languedoc waren zur Zeit des Falles der Templer bereits im Wesentlichen ausgerottet…die Inquisition…“
Ambrosius hielt mit einer kurzen Handbewegung eine vorbeieilende Magd auf, die einen riesigen Korb mit kleinen, ofenfrischen Broten balancierte. Lächelnd stibitzte er dem Mädchen ein Gebäck, brach es und streckte die eine Hälfte Chaulliac hin. Dabei blitzte am Handgelenk seines sehnigen, dunklen Armes kurz ein quadratisch geschliffener, blutroter Stein in der Sonne auf, der die Mitte eines schmalen, silbernen Reifes mit scheußlichen Totenköpfen und merkwürdigen Schriftzeichen schmückte.
Guy bedankte sich, biss genüsslich von der harten, duftenden Kruste ab, kaute eine Weile und nickte schließlich. „Was Du sagst ist natürlich richtig, Ambrosius. Und trotzdem wissen wir immer noch nicht, was in den fünfzig Jahren zwischen dem Diebstahl und dem erneuten Auftauchen des Manuskriptes wirklich geschehen ist. Auch Nicolas Flamel konnte mir dazu keine Auskunft geben. Er hat das Grimoarium erst im Frühsommer des Jahres 1357 von diesem Pfandleiher gekauft. Er erzählte mir, dass ihm zuerst lediglich die Reliefs auf dem kupferbeschlagenen Einband ins Auge gesprungen waren. Nicolas öffnete den Schutzeinband noch in der Bude des Verkäufers und als er feststellte, dass es sich um ein unbeschädigtes Manuskript in allerbestem Zustand handelte, zögerte er nicht es zu kaufen...allerdings ohne dem Mann anzuvertrauen, welcher wahre Schatz sich da zufällig unter lauter Abfall und wertlosen Metallteilen versteckt hatte. Er bezahlte gerade einmal 2 Deniers für die Handschrift…ein lächerlicher Preis.“
„Und Du bist Dir wirklich ganz sicher, dass es unsere verschwundene Übersetzung ist und nicht nur“, Ambrosius zögerte kurz, „...irgendeines dieser verrückten Werke, die schlaue Fälscher eins ums andere in Al Andalus herstellen, damit sie dann für schweres Gold an irgendwelche Leichtgläubige auf der anderen Seite der Pyrenäen verkaufen werden können.“
Chaulliac schüttelte den Kopf. Er hatte das frische Brot gegessen. Ihm wurde bewusst, wie sehr seine Kehle vom vielen Reden und von der Wärme des Tages ausgetrocknet war. Als Ambrosius von Cornouailles an ein paar müßig herumlungernden Wachleuten vorbei den Weg hinauf in die herzoglichen Gemächer einschlug, folgte Guy ihm bereitwillig. „Nein“, erwiderte er bestimmt und dachte, dass ihm jetzt selbst einer der unheimlichen Wächter von Barc'h Hé Lan willkommen wäre, wenn er nur neuen Wein oder einen großen Krug kalten Apfelmostes mitbrächte, „bei dem Grimoarium von Nicolas Flamel muss es sich um die echte Templer-Handschrift handeln. Jedes Detail entspricht der Beschreibung aus dem Testament von Jacques de Molay. Ich habe sogar den Fluch von Abraham Eleazar gelesen und auch diese seltsame Miniatur entdeckt, von der de Molay spricht und die Bernard de Clairvaux zusätzlich in die Übersetzung eingefügt hat.“
Der Okzitanier schloss kurz die Augen, „Ich bin Abraham Eleazar der Jude, ein Fürst, Priester und Leviter, ein Astrologe und Philosoph. Ich entstamme einem alten Geschlecht, denn meine Wurzeln gehen zurück auf Abraham, Isaac und Jakob. Meine Brüder, die ihr durch den Zorn des Großen Gottes in alle Winde zerstreut leben müsst, in Unterdrückung und Sklaverei: Ich wünsche Euch im Namen des Messias, der bald kommen wird und im Namen des großen Propheten Elias, der all seine Brüder auf diese Ankunft vorbereitet hat Erfolg und Glück. Deni, Adonai, Bocitto, Ochysche 60 F. Darum erwartet geduldig das Kommen des Helden“, zitierte er auswendig.
„Der Text scheint nicht vollständig“, sagte Cornouailles leise zu ihm, “ denn im Original.....“
Chaulliac hob die Hand und gebot dem Herzog zu schweigen. „Der Text ist vollständig. Sie haben auch den Fluch übersetzt, Ambrosius. Doch er steht nicht auf der ersten Seite, wie im Original der Handschrift. Bernard hat ihn auf die Rückseite des Deckblattes geschrieben und dort auch jene seltsame Miniatur eingefügt, die ich zuvor erwähnt habe. Was allerdings Abraham Eleazars Erklärungen über die Herkunft des niedergelegten Wissens und den wahren Zweck des großen Werkes angeht; das steht nirgendwo. Ich hatte den Eindruck, dass diejenigen, die hinter dieser Übersetzung steckten, beschlossen hatten, man könne denjenigen, denen dieser Text ursprünglich zugedacht worden war, nicht die volle Wahrheit über den Fund von Hugues de Payns und seiner acht Gefährten unter den Ställen Salomons im alten Tempel von Jerusalem anvertrauen. Wenn ich mich richtig entsinne: Molay sagt dazu Garnichts in seinem Testament... oder vielleicht wusste er es auch einfach nicht.“
„Und Flamel“, fragte Ambrosius ein wenig misstrauisch. In seiner Stimme spiegelte sich Sorge und gespannte Erwartung wieder.
Chaulliac schüttelte den Kopf und lächelte. “Meister Flamel ist ein weiser, alter Mann. Auch ohne die Erklärungen, die im aramäischen Original stehen, ist er dem wahren Geheimnis der Handschrift des Abraham Eleazar mit den Jahren auf die Spur gekommen.“
Der Herzog hob leicht eine dünne, hochgeschwungene Augenbraue und fixierte seinen Freund. „Und...“, ein kleines Lächeln umspielte seine Lippen, doch dieses Lächeln hatte nichts Freundliches. Es erinnerte mehr an den Ausdruck auf dem Gesicht einer Katze, die sich anschickte einen Sprung zu wagen, um ihre Beute zu schlagen.
„Als Meister Flamel begriff, was sich wirklich hinter dem Grimoarium versteckte –abgesehen von der ganzen Goldmacherei und Reichtum ohne Ende und Blablabla – da ist ihm angst und bange geworden. Er sagt, dass er den weißen Stein wieder zerstört und seine Splitter in alle Himmelsrichtungen zerstreut hat. Und alles Blei, das er mithilfe des Steines in Gold verwandeln konnte ist bis zur letzten Unze in seine gottgefälligen Werke geflossen. Er hat nicht einmal ein einziges Körnchen davon behalten, um es für eigennützige Zwecke zu verwenden.“
„Gut“, erwiderte Ambrosius. „Dieses Geständnis des Notarius dürfte uns beiden die Entscheidung wesentlich leichter machen. Du glaubst dem alten Mann? Nicht wahr, Guy?“
Der Okzitanier überlegte einen Augenblick. Als er an die eiskalten, harten und leblosen Augen des dunklen Wächters von Barc'h Hé Lan zurückdachte, nickte er nur stumm.
VIII
Maeliennyd blinzelte heftig und schüttelte sich. Sie musste sich bei ihrem Spaziergang hinunter zum See mehr angestrengt haben, als sie geglaubt hatte. Oder sie hatte einfach zu viele Dinge durcheinander in sich hineingestopft, wogegen ihr Magen jetzt rebellierte, genauso, wie Aodrén es am See prophezeit hatte. Sie spürte wieder dieses dumpfe, unangenehme Ziehen in der Leiste. Im Reflex legten sich ihre Hände beschützend über den gewölbten Leib, obwohl ihr Verstand ihr sagte, dass dieser kurze Schmerz unmöglich mit dem Kleinen in Zusammenhang stehen konnte. Noch mindestens zwei volle Monate trennten sie vom Augenblick der Geburt. Seit der Wintersonnwende wusste sie sicher, dass sie wieder schwanger war. Sie hatte das Kind vermutlich in der Zeit um Samhain empfangen. Maeliennyd atmete tief durch, presste die Hände fester auf den Leib und versuchte den dumpfen Schmerz zu verdrängen, der sich immer unnachgiebiger in ihrem Unterleib aufbaute. Kurz betrachtete sie die beinahe leere Schale und schalt sich zum zweiten Mal an diesem Tag eine Närrin. Selbst ihren beiden Söhnen Aorélian und Glaoda würde es speiübel werden, wenn sie zuerst geräucherten Aal und hinterher Zuckerbrot und kandierte Veilchen in sich hineinstopften. Die Herzogin zwang sich so langsam und so gelassen wie möglich zu atmen und ihre Gedanken auf etwas anderes zu richten, als auf dieses kleine Wesen, das in ihr heranwuchs. Doch es wollte nicht gelingen. Das dumpfe Pochen schien sich zu verwandeln. Sie spürte, wie ihr gewölbter Leib unter dem krampfhaften Druck der Hände nachgab und sich plötzlich senkte. Furcht stieg in Maeliennyd Glyn Dwyr auf; eine nackte, kalte, eisige Angst. Wie ein Kaninchen, die Schlange anstarrte, richtete sie ihre Augen auf den Kamin, in dem noch die erbärmlichen letzten Reste eines alten Feuers lagen. Es war keine Sinnestäuschung. Sie bemerkte, wie in der kalten Asche winzige, hellblaue Flammen zum Leben erwachten. Der Schmerz in ihrem Leib nahm zu und mit jedem dumpfen Stechen wuchsen die Flammen, bis sie sich schließlich zu einem deutlichen, klaren Bild verwoben.
IX
Nachdem die beiden Männer ihren Beschluss gefasst hatten, beschrieb Chaulliac noch kurz Bernards Miniatur, so wie er sie im Gedächtnis behalten hatte: Ein Mann in einem sonderbar zeremoniell anmutenden Gewand steht auf einem Quaderstein. In der Rechten hält er eine Phiole aus Glas, in deren Inneren eine Schlange sich in den Schwanz beißt. Aus dem Hals der Phiole entspringen drei Blumen. Zur Linken des Mannes erhebt sich ein Berg, auf dessen Rücken allerlei Bäume und Pflanzen wachsen. Am Fuß des Berges erkennt man zwei Höhlen. Während ein Tier in die eine Höhle hineinläuft, entspringt der anderen Höhle ein Fluss, der unter dem auf dem Quaderstein stehenden Mann hindurchfließt, um in eine weitere Höhle zu verschwinden, die man am Fuß eines kleinen Hügels im Vordergrund entdecken kann. Auf diesem Hügel wachsen drei Rebstöcke mit saftigen Trauben. Zur Rechten des Mannes, etwas in den Hintergrund versetzt, erkennt man noch einen kreisrunden Turm, auf dessen Spitze sich ein gleichschenkliges Kreuz in einem Kreis befindet.
Ambrosius de Cornouailles hob die Schultern, als der Okzitanier zu Ende war. „Das macht keinen Sinn, Guy“, sagte der Herzog frustriert. „Er war gewiss keiner von uns, der sich abgewandt und sein Gelübde verraten hat. Und soweit ich weiß, war er auch keiner, den die Bruderschaft damals mit irgendeinem Auftrag bei den reformierten Benediktinern von Robert de Molèsme eingeschleust hätte.“
„Er vielleicht nicht, Ambrosius. Aber Du darfst Maol Maodhoogua Morguair nicht vergessen. Der heilige Malachias war ein Culdée aus Irland. Maol Morguair hat seine Rolle so ausgezeichnet gespielt, dass er nicht einmal ein Jahr brauchte, um es in Bangor zum Abt zu bringen. Im folgenden Jahr war er schon Bischof von Connor und acht Jahre später bereits Erzbischof von Armagh, .eine Funktion, die er –wie Du weißt- lange Zeit mit der des Primas von Irland und schließlich sogar mit der des Legaten des Heiligen Stuhls in Irland kumulierte. Maol Morguair war – wenn ich mich so ausdrücken darf – der bislang größte Erfolg der weißen Bruderschaft, die christliche Kirche tiefgehend zu unterwandern. Er ist in Cîteaux gestorben. Eine tiefe Freundschaft verband Maol und Bernard. Sie tauschten regelmäßig Briefe aus und ich bin mir sicher, dass das alte Schlitzohr aus Armagh es bei ihren persönlichen Treffen nicht dabei belassen hat, hochgelehrte Gespräche mit unserem begabten Übersetzer zu führen oder ihn bei einem Becher Wein mit Anekdoten aus seiner Zeit bei den heidnischen Götzendienern zu amüsieren. Die Zisterzienser sind nicht alleine Bernards Erfindung. Vieles in ihren Regeln erinnert an die von Comgall, dem Gründungsabt von Bangor; Regeln, die Maol wieder einführte, nachdem sein Vorgänger Oengus Ua Gorman das ganze Kloster in einen wüsten Schweinestall verwandelt hatte. Und Du weißt so gut wie ich, wer Comgall wirklich war, woher er stammte und von wem er die Regeln für Bangor abgekupfert hat. Nicht einmal Du kannst leugnen, dass Bernard aus den reformierten, aber immer noch schwarzen Benediktinern von Bernard de Molèsme wieder Weiße Brüder gemacht hat.“
Ambrosius seufzte. Ein leiser Anflug von Trauer legte sich über seine Augen, doch er hatte nicht das Herz sich mit Guy um einer Grundsatzfrage Willen genauso zu zerstreiten, wie sich einst dessen Großvater und Aodrén zerstritten hatten. Die Weiße Brüder von Bernard de Clairvaux, die Zisterzienser, hatten mit den Weiße Brüdern von Brocéliande oder mit denen vom Berg Mézenec im Velay in ungefähr so viel gemein, wie der bildschöne Hengst, den er von seiner letzten Reise aus Al Andalus mitgebracht hatte mit den stämmigen bretonischen Arbeitspferde, die seine Bauern vor ihre Pflüge spannten. „Dann könnte es also sein, dass er versucht hat, mittels dieser Miniatur eine Art geheimer Nachricht an uns zu schicken...irgendwie in der Hoffnung, die Übersetzung der Handschrift des Abraham Eleazar könne vielleicht irgendwann einmal in berufenere Hände fallen, als in die der Ritter des Tempelordens?“
Chaulliac hob die Schultern. Diesen Gedanken hatte er in jener Nacht im Haus von Nicolas Flamel auch gehabt. Doch obwohl ihn die Miniatur in gewisser Weise ansprach, wusste er sie genauso wenig zu deuten, wie Ambrosius Arzhur von Cornouailles. Er schüttelte vorsichtshalber den Kopf. Im Gegensatz zu den Weiße Brüdern aus dem Velay, die schon seit den Tagen der römischen Herrschaft um des Überlebens Willen gezwungen waren, neue Ideen aufzunehmen und von allen Seiten her zu betrachten, waren die Weiße Brüder von Brocéliande ausgesprochen stur, dickschädelig und nicht im Entferntesten bereit, auch nur ein Jota vom Weg der alten Lehre abzuweichen. Sie waren es gewesen die von Anfang an ihre ganze Energie und sehr viel Einfallsreichtum darauf verwandt hatten, die neue christliche Kirche zu unterwandern, um sie von innen heraus auszuhöhlen und zu spalten. Selbst in den Zeiten der grausamsten Verfolgung waren die Weiße Brüder von Brocéliande lieber in den Tod gegangen, als sich wie Weiden im Wind zu biegen und zu leben. Die Weiße Brüder das Velay hatten in Gwenc’hlan Rûn-ar-Goff, der das Rabenmal der Herrin der Spukgeister auf der Brust getragen hatte lediglich einen Druiden gesehen, der um der Macht Willen mit der Finsternis paktierte. Für die Weiße Brüder von Brocéliande und für Ambrosius de Cornouailles war Gwenc'hlan ein Held; eine Legende zu deren Ehren man zahllose Verse verfasst hatte und immer noch verfasste, eine Gestalt, von der jedes Kind in Cornouailles oder in der Bretagne in der Spinnstube der Frauen hörte... Gwenc’hlan Rûn-ar-Goff, der die Bretagne und Cornouailles vor König Dagobert gerettet und die Merowinger mit seinem gewaltigen Fluch belegt hatte. Noch heute brauchte es nicht viel mehr, als Augen, um zu sehen, wozu Gwenc’hlans Fluch am Ende geführt hatte. Seinen Freund Ambrosius von Cornouailles konnte Chaulliac im besten Fall als einen genauso gefährlicher Fanatiker einstufen, wie den Heiligen Augustinus oder den Dominikanerprokurator Bernhard Guy. Der Okzitanier war bereit, sein Hab und Gut und seinen guten Ruf als Wissenschaftler und Arzt darauf zu verwetten, dass der Herzog von Cornouailles bereit, willens und fähig war, wie der legendäre Gwenc’hlan mit den Dämonen der Finsternis zu paktieren, wenn er darin ein Mittel sah, die römische Kirche zu zerstören und wieder die Herrschaft der Druiden über ganz Frankreich heraufzubeschwören. Ambrosius war ein außergewöhnlich geschickter Politiker und Diplomat. Er hatte fast unerschöpfliche Schatztruhen, eine gewaltige Flotte, unzählige zutiefst ergebene Vasallen, die nicht nur in Cornouailles und in der Bretagne Lehen besaßen, sondern auch auf der anderen Seite der Grenze im Kernland Frankreichs. Er hatte dafür gesorgt, dass der jüngste Bruder des bretonischen Herzogs Yann, Arzhur de Richemont, an seinem Hof aufwuchs und er schien sogar in der Lage, den unheimlichen Wächtern von Barc’h Hé Lan seinen Willen aufzuzwingen. Guy de Chaulliac senkte die Augen und sagte ruhig. „Wir wer wahrscheinlich niemals herausfinden, warum Bernard de Clairvaux in seiner Übersetzung diese seltsamen Veränderungen vorgenommen und die Miniatur eingefügt hat, Ambrosius. De Molay wusste es auch nicht. Er schreibt in seinem Testament nur, dass es Bernard und seinen Helfern gelungen war den ursprünglichen Text von Abraham Eleazar vollständig zu entschlüsseln. Auf dieser Grundlage hatten sie einen Lapis Philosophorum erschaffen, den König Phillip auch als solchen erkannte, als die Templer ihm einmal vor dem aufgebrachten Volk im Pariser Ordenshaus Unterschlupf gewährten. Dies habe dann wiederum zu der berühmten Katastrophe geführt, die am 13.Oktober des Jahres 1307 ihren Anfang nahm. Aber mir scheint, Du hast recht und wir sind endlich am Ziel unserer Suche angelangt. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden und den braven Meister Flamel dazu überreden, uns diese Handschrift anzuvertrauen…“
Die Augen des Herzogs von Cornouailles funkelten böse, „…oder wir räumen Meister Flamel aus dem Weg und nehmen das Manuskript einfach.“
Chaulliac zwang sich zur Ruhe. Er war nicht davon überzeugt, dass es eine gute Idee war, Flamel sein Buch zu stehlen oder es durch Gewalt in ihren Besitz zu bringen. „Das wäre zu gefährlich, Ambrosius. Lasse gut sein. Ein Mord und ein Diebstahl würden viel zu viel Aufsehen erregen und möglicherweise wieder Männer auf die Spur des Ordens führen...oder schlimmer noch, auf die Spur der weißen Bruderschaft. Flamel...er weiß ganz genau, wie gefährlich sein Grimoarium ist; er erzählte mir, wie es ihm gelang, alles zu entschlüsseln...und warum er schließlich seine alchimistischen Arbeiten einstellte und das ganze Gold einfach verschenkte. Ich habe das Gefühl, das da noch mehr ist, als nur dieser komische Fluch. Flamel erwähnte kurz den Kerl, der für de Cramoisi gearbeitet hatte und wirklich die Untersuchung gegen ihn leitete...ein gewisser Jean de Craon. Vielleicht wäre es vernünftiger, erst einmal genau herauszufinden, wer dieser de Craon ist, welche Rolle er damals wirklich gespielt hat, warum er unserem Freund in der Rue de Marivaux solche Angst einjagte und wer am Ende wirklich dafür gesorgt hat, das der Notarius dieser königlichen Untersuchungskommission unbeschadet entrinnen konnte...und um welchen Preis.“
Die Augen des Herzogs von Cornouailles bohrten sich tief in die Augen des Okzitaniers. Mehrere Minuten lang schwiegen beide Männer sich an. Es war ein stummer Kampf, Wille gegen Wille, Überzeugung gegen Überzeugung. Chaulliac bemühte sich, weder Furcht noch Zweifel durchscheinen zu lassen, während er Ambrosius‘ Blick standhielt. Am Ende schien es so, als ob der Mann aus dem Süden den Sieg über den Herzog von Cornouailles davontrug. „Gut“, sagte Ambrosius kurz angebunden, “ wir werden vorerst das tun, was Du vorschlägst.“ Und mit einem leisen Hauch von Bitterkeit fügte er hinzu. „Ich werde morgen einen Kurier mit einer Nachricht für Stephan von Paléc nach Prag schicken. Damit hätten wir vorläufig unsere Pflichten dem Orden gegenüber erfüllt.“
Chaulliac atmete auf. Alles deutete darauf hin, dass er die erste Schlacht gewonnen hatte. Nun musste sich noch zeigen, ob er auch klug genug war, dafür zu sorgen, dass der ganze Krieg gewonnen wurde, bevor irgendein Mann, der tiefer in die Geheimnisse der Welt und der Zeit eingeweiht war, als Bernard de Clairvaux oder der Notarius Flamel die Übersetzung des Manuskriptes von Abraham Eleazar in die Hände bekam.
X
Bran’wen klopfte nicht an, sondern riss einfach die Tür auf: Als sie den unmenschlichen Schrei gehört hatte, war sie von ihrem Lager hochgefahren und losgerannt. Sie hatte vor lauter Angst keine Gedanken daran verschwendet, wie unschicklich sie aussah: Lediglich mit ihrem Untergewand bekleidet, ohne eine Haube über den Haaren und barfüßig stand die alte Frau im Gemach ihrer Herrin. Sie war unfähig sich zu bewegen oder auch nur ein Wort über die Lippen zu bringen. Mit furchtgeweiteten Augen starrte sie auf den dunklen, feuchten Fleck auf dem hellen Gewand. Die Herzogin von Cornouailles lag in einer seltsam unnatürlich anmutenden Haltung vor dem erkalteten Kamin. Auf den ersten Blick wirkte es so, als ob ein geheimnisvoller Angreifer ihr einen üblen Stoß versetzt hatte. Die Augen von Maeliennyd Glyn Dwyr waren geschlossen. Ihr Atem ging mühselig und stoßweise. Sie musste sich im Fall böse den Kopf angeschlagen haben, denn ihre schwarzen, zu einem schweren Zopf geflochtenen Haare wirkten an der einen Seite ganz klebrig und verfilzt. Der Lehnstuhl, auf dem sie zuvor wohl gesessen hatte, war achtlos umgestoßen worden und ebenso der kleine Tisch, auf dem die alte Frau noch wenige Stunden zuvor eine Glasschale mit Süßigkeiten und Obst für ihre Herrin hergerichtet hatte. Wie kleine Edelsteine funkelten die Splitter der zerbrochenen Schale im Licht der untergehenden Sonne, die durch die weit geöffneten Fenster fiel.
Erst als ein schwaches Wimmern, wie von einem verängstigten Kindes über die Lippen der bewusstlosen Frau auf dem Boden schlich, löste sich Bran’wens Erstarrung und sie Riss in einer Geste der Hilflosigkeit die Hände hoch. Dabei schrie sie mit aller Kraft. Ihr panischer Schrei glich dem eines schwer verletzten Tieres in Todesangst. So undeutlich der Schrei gewesen war, der die alte Frau erst wenige Augenblicke zuvor in ihrer Kammer aus dem Schlaf gerissen hatte, so deutlich waren die Worte die sie jetzt in ihrer grenzenlosen Verzweiflung herausschrie.
Obwohl sich an diesem Festtag wegen der Vorbereitungen für das große Bankett nur einige wenige Dienstleute innerhalb der Mauern des Palas aufhielten, dauerte es nicht lange, bis sich eine kleine Menschentraube hinter Bran’wen bildete. Die beiden blutjungen Mägde, zu deren Aufgabe es für gewöhnlich gehörte, dem Bäcker von Carnöet zur Hand zu gehen, hatten den Schrei der alten Frau ebenfalls gehört, obwohl sie unten im Innenhof zugange gewesen waren. Trotzdem waren sie sozusagen die Ersten, die es wagten sich hinter der händeringenden, verzweifelten Bran’wen in Maeliennyd Glyn Dwyrs Gemach zu drängen. Und sie waren die Einzigen, die auf das furchteinflößende Schauspiel, das sich ihnen dort bot, vernünftig reagierten.
Anstatt mit den anderen Gaffern tatenlos herumzustehen, zu heulen und zu lamentieren, rannte die Ältere sofort los, um den Herzog von Cornouailles zu finden, während die Jüngere sich auf den Weg in die Küche machte, einen großen Kessel mit Wasser übers Feuer hängte und einen Stapel saubere Tücher zusammensuchte. Sie hatte erst vor wenigen Wochen mitangesehen, wie das erste Kind ihrer älteren Schwester zur Welt gekommen war. Darum deutete sie den dunklen, feuchten Fleck, der sich bis fast hinunter zu den Knien auf dem hellen Gewand der Herzogin ausgebreitet sofort richtig.
Jetzt stand sie hinter einem dunkelhäutigen, dunkelhaarigen Mann mit scharf geschnittenen Gesichtszügen, den sie ein paar Stunden zuvor flüchtig in Begleitung des Herzogs von Cornouailles wahrgenommen hatte, als dieser ihr im Hof der Festung ein warmes, frisch gebackenes Brot aus dem Korb stibitzt hatte. Der Mann sprach in kurzen Sätzen und sein Tonfall war barsch, doch sie begriff, das seine herrische Art nicht gegen sie gerichtet, sondern ein Zeichen der Dringlichkeit der Situation war, mit der sie konfrontiert wurden. Ihre Freundin, die Ambrosius Arzhur geholt hatte, war bereits auf dem Weg, um auch noch Aodrén Jaouen Kréc’h Elis aufzuspüren. Die alte Bran’wen saß nur nutzlos und zutiefst verstört in einem Winkel des Zimmers und heulte leise vor sich hin.
„Es ist noch viel zu früh für das Kind“, fluchte der dunkle Mann, während Ambrosius de Cornouailles am Kopfende des Bettes seiner Gemahlin stand, und ihr mit einem feuchten Tuch die schweißnasse Stirn abwischte. Die Dienstmagd bemerkte, wie der Herzog sich anstelle einer Antwort auf die Lippen biss. Seine Augen waren finster und über seinem Gesicht lag ein Schatten.
XI
Die Stunden schlichen dahin. Bran’wen war inzwischen in ihrer Ecke eingeschlafen und die Dienstmagd, die Chaulliac zur Hand gegangen war, hatte man in die Küche zurückgeschickt, um noch mehr heißes Wasser aufzusetzen und für die Herzogin von Cornouailles einen großen Krug Kräutertee zu bereiten. Ihre Freundin hatte Aodrén zwischenzeitlich unweit der Festung am Flussufer gefunden. Dort hatte er zusammen mit den beiden Söhne von Ambrosius und Maeliennyd und ihrem kleinen Freund Arzhur de Richemont im Gras gesessen, die Zeit vertrödelt und den drei Kindern gezeigt, wie man sich aus ein paar nassen, geschmeidigen Binsen schnell und einfach eine Falle für schmackhafte Flusskrebse bauen konnte.
Jetzt stand der gelehrte Mann zu seiner ganzen Größe aufgerichtet und stocksteif am Fußende des Bettes der Herzogin und beobachtete tief besorgt die leichenblasse Frau, die kaum bei Bewusstsein schien. Für gewöhnlich riet Aodrén jeder Gebärende dazu, nachdem sie die Wasser verloren hatte, solange sie es aushalten konnte herumzulaufen, um die Wehen und damit die Geburt zu beschleunigen. Er verzog den schmalen Mund. In seinem langen Leben hatte er unzähligen Kindern gesund auf die Welt geholfen. Dies schloss nicht nur seine eigenen neun Töchter und seine drei Dutzend Enkel ein, sondern auch den gesamten Nachwuchs der herzoglichen Familie von Cornouailles, der während des letzten halben Jahrhunderts auf die Welt gekommen war. Er hatte sogar schon mehrfach erfolgreich die sogenannte römische Methode angewandt, ohne dabei die Mutter oder das Neugeborene zu verlieren. Man nannte diesen Eingriff auch die Sectio Caesarea. Der Imperator Julius Cäsar war damals dank zweier schneller, präziser Schnitte durch die Bauchdecke seiner von hochwirksamen Drogen betäubten Mutter ans Licht der Sonne geholt worden, nachdem die Steißlage des Kindes eine Geburt auf dem normalen Wege vereitelt hatte. Gewöhnliche Ärzte wagten diesen Eingriff höchstens bei toten Frauen, um ein ungeborenes Kind vielleicht doch noch zu retten.
Es war keine Eitelkeit, aber Aodrén wusste, dass er ein Meister seines Faches war. Und trotzdem kamen weder seine bewährten Methoden, noch der römische Schnitt in diesem ganz besonderen Fall in Frage. Um Herumzulaufen war die Herzogin zu aufgewühlt und eine innere Stimme warnte ihn vor den Drogen. Er fühlte, dass die Drogen, die notwendig waren um die Bauchdecke aufzuschneiden, ohne das die Frau dabei unsagbare Schmerzen erleiden musste Maeliennyd Glyn Dwyr in ihrem geschwächten Zustand umbringen würden. Er konnte sich einfach nicht erklären, wie diese Frau, die er noch wenige Stunden zuvor am Ufer des Sees lebhaft und übermütig beim Naschen von Erdbeerspinat überrascht hatte jetzt plötzlich an der Schwelle des Todes stehen konnte. Aodrén seufzte leise und warf Guy de Chaulliac einen fragenden Blick zu.
Der jüngere Mann war ebenfalls ein Chirurg von außergewöhnlichem Ruf. Doch es war offensichtlich, dass Guy sich besser darauf verstand Knochenbrüche einzurichten, Eingeweide wieder an den richtigen Platz zu bringen oder Kriegsleuten in der Hitze des Gefechtes Armbrustbolzen aus dem Fleisch zu schneiden. Im Angesicht einer Frau, die ein Kind zur Welt bringen musste, wirkte der Okzitanier genauso hilflos und verwirrt, wie Ambrosius de Cornouailles selbst. Der Herzog saß neben seiner Gemahlin auf der Bettkante und hielt ihre Hand fest in der Seinen. Er hatte niemals eine große Begabung für die Heilkunst besessen. Von all den Dingen, die Aodrén ihn einst gelehrt hatte, hatte er gerade einmal so viel im Gedächtnis behalten, um sich zu behelfen, wenn ein Pferd lahmte oder einer der Gefolgsleute sich die Schulter ausgekugelt hatte. Die wahren Stärken seines einstigen Zöglings lagen auf anderen Gebieten.
Während der alte Mann sich noch das Gehirn zermarterte, um eine Lösung für Maeliennyd und ihr ungeborenes Kind zu finden fiel sein Blick auf den Kamin des Gemachs. Die Kleine, die Chaulliac zur Hand gegangen war hatte zwar rasch die Scherben einer Glasschale zusammengefegt, die Maeliennyd bei ihrem Sturz zerbrochen haben musste, aber sie hatte in Anbetracht der Umstände keine sorgfältige Arbeit geleistet. Vor dem Kamin erkannte Aodrén feinen Aschestaub und frisch verkohlte Holzstücke und im Kamin selbst bemerkte er einen Scheit, der immer noch leise vor sich hin kokelte. Das war in der Tat ungewöhnlich.
Kein vernünftiger Mensch wäre je auf die Idee gekommen, bei dem wunderbar warmen Wetter draußen und den weit aufgerissenen Fenstern des Gemaches ein Feuer zu entzünden. Er schluckte, als er sich eingestehen musste, dass er nicht nur den Grund für die unnatürliche Schwäche von Maeliennyd Glyn Dwyr erkannte. Er hatte auch eine genaue Idee hatte, wie es dazugekommen war, dass sie hingefallen und sich so böse angeschlagen hatte.
„Geht“, sagte der Aodrén mit einer Stimme, die keine Widerworte zuließ. Seine für gewöhnlich gütigen, haselnussbraunen Augen blitzten kalt und hart, „geht alle und lasst mich mit der Herzogin alleine. Schickt lediglich die Magd mit dem heißen Wasser und weiteren sauberen Tüchern und dann lasst uns alleine. Niemand darf uns in den nächsten Stunden stören, wenn Euch das Leben der Weißen Dame von Concarneau am Herzen liegt und das ihres Kindes. Ich habe Maeliennyd mein Ehrenwort gegeben. Dieses Kind wird gesund zur Welt kommen und die Herzogin wird weiterleben.“ Die letzten Worte hatte er so leise ausgesprochen, dass niemand im Raum sie gehört hatte.
XII
Aodrén nahm wieder den Becher und füllte ihn aus dem Krug mit heißem Kräutertee. Es waren verschiedene Pflanzen, die in den ersten Monaten einer Schwangerschaft unweigerlich zum Abort führten, die aber im Augenblick der Geburt die Wehen beschleunigten und die Muskeln des Bauches entkrampften. Sanft legte er den Arm um die Schultern der Herzogin und richtete sie noch einmal vorsichtig auf. Dann presste er den Becher gegen ihre Lippen und beschwor sie mit eindringlicher Stimme zu trinken, soviel sie konnte. „Was in aller Welt hat Dich nur zu dieser Narretei veranlasst? Das kalte Feuer zu beschwören...“, tadelte er sie leise. In seinen Augen stand neben der Sorge auch Enttäuschung geschrieben.
Maeliennyd trank mühevoll und zwang sich das bittere Gebräu hinunterzuwürgen, obwohl alles in ihr gegen den Geschmack der Kräuter rebellierte. Seitdem sie nach einem explosionsartigen, unmenschlichen Schmerz die Wasser verloren hatte und hingefallen war, hatte sie keine Wehe mehr gespürt. Selbst als sie sich mit letzter Kraft auf den Rücken gerollt hatte, war der nach fünf erfolgreichen Geburten so vertraute Schmerz ausgeblieben. Ihr war lediglich immer noch speiübel und sie fühlte sich völlig verbraucht und zu Tode erschöpft. Sie fühlte sich nicht einmal mehr im Stande, den Becher mit dem Kräutertee zu halten und nur Aodréns stützender Arm verhinderte, dass sie sich einfach zurück in die Kissen sinken ließ. Sie wusste, wie gefährlich es war magische Kräfte zu beschwören, während man mit einem Kind schwanger ging. Niemals hätte sie aus eigenem Antrieb das kalte Feuer entfacht. Sie spann ja nicht einmal in diesem Zustand. Sie wusste, dass diese eintönige Tätigkeit sie in einen Zustand zwischen Schlafen und Wachen versetzen konnte, in dem sie plötzlich Dinge sah, die erst kommen würden. Die Flammen waren einfach da gewesen und hatten sie dann stetig in ihren Bann gezogen. Sie war nicht mehr imstande gewesen, den Blick abzuwenden und der Versuchung zu widerstehen, einen Hauch aus dem großen Wind der Zeit zu spüren. Diese seltsame und unheimliche Gabe war Macht und Fluch zugleich. Nachdem Maeliennyd noch ein paar Schlucke Tee hinuntergewürgt hatte, hob sie die Hand und bedeutete dem alten Mann, den Becher zur Seite zu stellen. Dann erwiderte sie mit schwacher Stimme. „Es war nicht mein eigener Wille, Aodrén.“
Die haselnussbraunen Augen des alten Mannes wanderten prüfend über ihr bleiches, vom Schmerz gezeichnetes Gesicht. Erst als er wirklich überzeugt war, dass die Herzogin von Cornouailles wahr gesprochen hatte, nickte er und nahm ihre zierliche, feingliedrige, eiskalte Hand in die Seine: „Mein liebes Kind“, seufzte er, „es ist bereits zu spät, um noch irgendetwas aufzuhalten. Ich sehe nur einen einzigen Ausweg. Und wenn Du den Mut hast und mir vertraust, dann können wir gemeinsam versuchen, die ganze Sache zu beschleunigen. Du hast das Kleine ein bisschen länger als achtundzwanzig Wochen unter dem Herzen getragen. Obwohl Deine Zeit noch nicht gekommen ist, ist es doch schon ein vollständiger, winzig kleiner Mensch. Als ich einst an der Schule zu Salerno studierte, da brachten sie uns ein solches zu früh geborenes Kind. Die unglücklichen Eltern hatten es in einem Körbchen auf dem Marktplatz liegen lassen. Es war wohl, um die Kosten für ein Grab zu sparen. Die Gelegenheit mehr über den menschlichen Leib zu erfahren war günstig. Wir zögerten natürlich nicht, heimlich den kleinen Leichnam zu öffnen und hineinzusehen. Alles war dort vorhanden, genauso, wie bei einem Wesen, das zur richtigen Zeit geboren wird.“
„Aber ein solches winziges Geschöpf kann doch unmöglich am Leben bleiben, Aodrén“, erwiderte die Herzogin verzweifelt, „selbst wenn es vollständig ist. Wie soll denn ein so kleines Herzchen schon schlagen können.“
„Genauso, wie es jetzt schlägt, meine Liebe“, erwiderte der weise Mann mit leisem Spott und legte vorsichtig seine Hand über Maeliennyds Leib. „Natürlich ist das Geschöpf arg zerbrechlich und man muss es mit allergrößter Vorsicht handhaben, bis es außerhalb des Mutterleibes zu seiner richtigen Größe heranwächst und genug eigene Lebenskraft besitzt. Es wird vielleicht auch niemals genauso stark und so kräftig sein, wie ein normal geborenes Kind. Aber Du weißt, dass meine Schutzzauber mächtig sind. Alle Deine anderen Kinder sind gesund herangewachsen und nicht ein einziges ist jemals ernsthaft krank gewesen oder gar gestorben. Warum sollten die höheren Mächte mich für dieses sechste Kind von Cornouailles nicht genauso erhören, wie für die Fünf anderen. Wenn sie es waren, die Dir das kalte Feuer geschickt und dadurch bestimmt haben, dass das Kind zu Bealltainn auf die Welt kommen soll, dann werden sie auch ihre schützende Hand über es halten. Es ist ihr Wille, dass Dir im Zeichen des Lichtes dieses letzte Kind geboren werden soll.“
Die Herzogin seufzte und zwang sich dazu aufrecht zu sitzen, obwohl die Schwäche ihrer Glieder ihr schwer zu schaffen machte. Der heiße Kräutertee in dem sie deutlich Wermut, Engelwurz und Rosmarin schmeckte, hatte ihren Magen endlich beruhigt. Das Gefühl der Übelkeit war fort. Sie spürte jetzt nur noch einen dumpfen Druck, wie von einem Gürtel, der zu fest geschnürt worden war. Dieses Unwohlsein war erträglich. Auch die Schmerzen in ihrem Kopf, den sie sich beim Fall angeschlagen hatte, wurden zunehmend schwächer.
„Es war…“, sie hielt kurz inne, um tief durchzuatmen und sich Mut zu machen. Sie fühlte, dass es wichtig war jetzt in Worte zu fassen, was sie zuvor so erschreckt und verstört hatte. „Es war…seltsam, Aodrén. Nein, nicht seltsam, eher unverständlich, fast wie ein Rätsel, das die Aes Sidhe mir zu lösen gaben.“ Maeliennyd griff mit der Hand nach dem Becher und trank noch einen Schluck Kräutertee. Das Gebräu schmeckte widerlich, aber es tat ihr gut und der Rosmarin belebte ihre Sinne. „Sie zeigten mir die Nacht der Sommersonnwende im letzten Jahr: Wie mein Gemahl mich zuerst, wie ein närrischer Jüngling mit einem Kranz aus Ähren und dunkelblauen Kornblumen geschmückt und dann zu einer kleinen, gut versteckten Waldlichtung an einer Biegung der Laïta geführt hatte. Wir waren dort ohne irgendwelche tieferen Gedanken einfach wie ein frischverliebtes Paar zusammen gewesen und hatten in diesem vertrauten Augenblick im fahlen Licht des neuen Mondes absolut nichts getan, dass irgendwie die Macht der Sidhe beschworen hätte. Und trotzdem empfing ich in eben dieser Nacht ein Kind der Sonnwendfeuer.“
Aodrén lauschte interessiert, während seine Hand immer noch auf dem Leib der Herzogin ruhte, um jederzeit auch nur die kleinste Veränderung ihres Zustandes oder die nächste Wehe fühlen zu können. Bereits als er die letzten Überreste des noch glühenden Holzscheites bemerkt hatte, war ihm ein ähnlicher Gedanke gekommen. Er hatte sich so zusammengereimt, dass das Kind unter Umständen vielleicht doch eine Chance hatte zu leben. Jetzt war er sich seiner Sache sicher. Die Magie der weißen Dame von Concarneau war stark und ihre Visionen betrogen sie nie. „Weiter“, ermutigte er Maeliennyd Mut sich zurückzuerinnern. Er wusste, dass der Herzog von Cornouailles in diesem Augenblick trotz seiner Angst um seine Gemahlin und seiner Verzweiflung bereits auf dem Weg hinunter zum großen Steinring im Wald am Ufer der Laïta war. Es war Ambrosius‘ Pflicht, den Segen über das Land zu sprechen und gemeinsam mit den anderen Drouiz die beiden ersten der Bealltainn-Feuer zu entzünden. Sobald sie brannten und die Drouiz ihre Gesänge anstimmten, wurde der Schleier zwischen der weißen Welt der Aes Sidhe und der Welt der Menschen für einige wenige Stunden dünn und durchlässig. Die Korred und die Elben überwanden ihre übliche Scheu, mischten sich unter die Feiernden und schenkten den Menschen Glück und überschäumende Energie. In guten Jahren, wenn die Feuer mächtig brannten, sahen vom Glück begünstigte gar Hu-Gadarn auf seinem Schimmel übers Land reiten. Die Magie der Feuer von Bealltainn war stark. Sie schenkte Leben, nicht den Tod. Für gewöhnlich war es eine besondere Gunst der Aes Sidhe, wenn einer Frau gewährt wurde, in diesem Augenblick ein Kind zur Welt zu bringen.
Maeliennyd Glyn Dwyr nickte Aodrén zu und überwand sich dazu das ganze Bild der Vision noch einmal vor ihrem inneren Auge aufleben zu lassen. Sie wusste, dass sie nicht das kleinste Detail vergessen durfte, denn möglicherweise verbargen sich dort Hinweise auf das Schicksal ihres ungeborenen Kindes. Und vielleicht verstand es ja der weise Mann, was sie in ihrem Schmerz und in ihrer Verzweiflung nicht begriffen hatte. „Dann wurde alles wieder dunkel“, fuhr sie fort, „und ich bekam fürchterliche Schmerzen. Es war unerträglich und trotzdem konnte ich weder schreien, noch mich bewegen. Und ich konnte die Augen nicht abwenden: Die Flammen des kalten Feuer wuchsen höher und höher. Ich erkannte deutlich eine große, in den Felsen gehauene Halle. Dort saß vom Schatten halb verhüllt eine dunkle Königin auf einem Thron aus Elfenbein. Neben ihr stand eine hochgewachsene Gestalt in einem schmucklosen, schwarzen Gewand. Auf der Brust trug diese Gestalt an einer schweren Kette aus Gold ein prachtvolles Schmuckstück in der Form eines Raben. Und um das Gelenk der Hand, die auf der Lehne des Elfenbeinthrons ruhte schloss sich der Reif von Eluned...derselbe Reif, den mein Vater der Cadwalladr meinem Gemahl am Tag unserer Vermählung anvertraut hat. Ich habe die dunkle Faith erkannt, Aodrén. Es war die Némain Sidhe selbst, der schwarze Rabe, die Königin der Spukgeister, die Herrin der Krieger, das Ende und die Wiedergeburt, Krieg und Frieden, Tod und Leben. Doch sie war nicht schrecklich und furchteinflößend, sondern schön und bleich und auf ihrem Antlitz lag ein wohlmeinendes Lächeln.“
Die Herzogin schien ihre Schwäche vergessen zu haben. Dem dumpfen Schmerz, der dem beklommenen Gefühl in ihrem Leib inzwischen wieder Platz gemacht hatte, schenkte sie keine Beachtung. „ Aodrén“, sagte sie so laut und deutlich, als ob sie einen heiligen Eid schwören wollte, „dort saß nicht die schreckliche Alte, sondern die Herrin des Sees. Die Morrigù selbst hat mir diese Vision geschickt und es war so ganz anders, als alle anderen Visionen, die ich je hatte. Die Némain Sidhe hat mich in eine ferne Zukunft blicken lassen, um mir etwas Bestimmtes zu zeigen. Doch was? “
Der alte Mann schwieg und strich Maeliennyd Glyn Dwyr in langsamen, sanften Bewegungen über den Leib, während sie weitersprach. Er hoffte ihr Zuversicht und Vertrauen einzuflößen und vielleicht auch die Wehen wieder in Gang zu bringen. Das kleine Wesen in ihr musste sich endlich weiter in Richtung auf den Ausgang zuzubewegen, wenn es leben wollte. Bereits als Chaulliac die Herzogin untersucht hatte, war dem alten Drouiz aufgefallen, wie weit geöffnet der Muttermund war. Frauen empfanden die Wehen immer sehr unterschiedlich. Jede von ihnen kam ganz individuell mit den Schmerzen klar. Die Tatsache, dass Maeliennyd Glyn Dwyr in ihrem erregten Zustand nur wenig zu spüren glaubte, bedeutete noch lange nicht, dass die Eröffnungswehen erst einsetzen mussten. Er hatte eher das Gefühl, dass sie bereits kurz vor der eigentlichen Niederkunft stand und dies alles nur nicht so wahrnahm, wie bei ihren letzten fünf Geburten. Auf den ersten Blick hatten die Bilder, die sie beschrieb auch für ihn keinen Sinn gemacht. Doch er fühlte, dass jedes einzelne ihrer Worte wichtig war. Darum musste er alles im Gedächtnis behalten. Sobald das Kind gesund und sicher auf der Welt war, würde er alle Zeit haben, vernünftig nachzudenken. Er hoffte, die Botschaft der Némain Sidhe zu deuten, die sie ihnen durch das kalte, blaue Feuer geschickt hatte.
XIII
Bran'wen schreckte plötzlich hoch, als sie klar und deutlich die Stimme ihrer Herrin hörte.
Langsam trotteten die Erinnerungen an den grauenhaften Nachmittag Eine um die Andere wieder in ihr altes, träges Hirn zurück, so wie eine undisziplinierte Schafherde hinter dem Hütejungen in den Stall zurückkehrt: Sie musste vor lauter Erschöpfung, und weil sie sich die Seele aus dem Leib geheult hatte, eingeschlafen sein. Ein kurzer Blick nach draußen, durch immer noch schlaftrunkene Augen, bestätigte ihr, dass die Sonne schon lange hinter dem Horizont verschwunden war, um der Nacht und dem neuen Mond Platz zu machen.
Als der Herzog, der dunkelhaarige Mann aus dem Süden und die Anderen in das Gemach von Maeliennyd Glyn Dwyr geströmt waren, hatte man sie achtlos aus dem Weg gestoßen. Sie hatte sich in einer Ecke neben einer Kleidertruhe hingehockt, um aus dem Weg zu sein und nicht zu stören. Dann mussten sie alle wieder fortgegangen sein und man hatte sie einfach vergessen. Jetzt konnte sie nur noch den Ollamh und ihre Herrin ausmachen. Sie saßen zusammen auf dem großen, mit prächtigen Vorhängen geschmückten Bett und plauderten. Bran'wen richtete sich so leise, wie möglich auf, um nicht den Zorn von Aodrén zu erwecken. Sie spähte vorsichtig über den Rand der Truhe hinweg. Ihre alten Ohren taugten wenig. Bran‘wen konnte kaum verstehen, worüber die beiden sprachen, doch allen Anschein nach ging es ihrer Herrin schon wieder viel besser. Sie hatte mit ihrem fürchterlichen Geschrei wohl nur eine unnötige Panik ausgelöst. Bran'wen biss sich auf die Lippen. Sie war sicher, dass ihr am nächsten Morgen eine gewaltige Strafpredigt drohen würde. Vermutlich würde Maeliennyd Glyn Dwyr sie wieder einmal eine alte Närrin schimpfen und ihr damit drohen, sie nach Wales zurückzuschicken, weil sie zu nichts mehr taugte.
Aodrén schien Maeliennyd ein kleines Fläschchen mit einer Flüssigkeit zu zeigen und ihre Herrin nickte zustimmend. Der Ollamh erhob sich, goss etwas von der Flüssigkeit in eine kleine Tonschale und entzündete eine Kerze unter dem Behältnis. Augenblicke später erfüllte ein wunderbarer Wohlgeruch das ganze Gemach. Bran’wen konnte lediglich eine einzige der Pflanzen bestimmen, die in diesem Duftöl vermischt worden waren: Es war der Beifuß. Sie stutzte ein wenig. Beifuß wurde regelmäßig während einer Geburt verbrannt, um Dämonen und böse Geister fernzuhalten und Mutter und Kind zu beschützen.
Jetzt stand der Ollamh über das Bett ihrer Herrin gebeugt und versperrte ihr die Sicht. Trotz ihrer schlechten Ohren verstand die alte Bran‘wen jedes Einzelne der Worte, die Aodrén in einem eindringlich beschwörenden Tonfall sprach. Dabei bewegten sich seine Arme sich in ganz präzisen Gesten und schrieben unsichtbare Zeichen über der Gebärenden.
Bran’wen fühlte eine seltsame Spannung im Gemach aufsteigen, als der weise Mann seinen Eibenholzstab nahm. In dem Augenblick, in dem seine Hand das glatte, dunkle Holz berührte, leuchtete der hellblaue, ungeschliffene Kristall an der Spitze in einem unirdischen Licht. Es schien, als ob die Luft sich langsam, aber stetig mit der Magie des Ollamh füllte. Ihre Herrin war währenddessen ganz still und gab keinen Laut von sich. Als Aodrén mit seinen Schutzzaubern zu Ende war, stieß er den Stab drei Mal hart auf den Boden. Im Kamin sprang aus dem Nichts ein Feuer hoch. Es verzehrte in einem kurzen Zischen und Knacken den müden, kleinen Scheit, der dort wohl nach der kalten Jahreszeit von den Dienstmägden vergessen worden war, während sie den Frühjahrsputz gemacht hatten und brannte dann aus eigener Kraft weiter.
XIV
Ambrosius fühlte sich leer, während er zusammen mit den anderen Drouiz auf einem kleinen Hügel stand und den jungen Mädchen dabei zusah, wie sie mit Haselstäben in den Händen um den frisch gepflügten und eingesäten Acker tanzten.
Die Stäbe schmückten rote und weiße Blumengirlanden. Ein paar junge Burschen spielten auf ihren Instrumenten eine fröhliche Weise. Die Mädchen hatten alle ihre hübschesten Gewänder angelegt. Sie wirkten aus der Ferne, wie ein Reigen bunter, farbenprächtiger Schmetterlinge. Ganz deutlich konnte man erkennen, wie die meisten von ihnen ihre offenen Haare mit Kränzen aus Birkenblättern und kleinen Sträußchen von Weißdornblüten geschmückt hatten, die bei jeder ausgelassenen Bewegungen als feiner Schnee durch die Luft flogen und dann zu Boden rieselten.
Für gewöhnlich genoss er alle Jahre wieder dieses ausgelassene Treiben der jungen Leute im Mondlicht. Es begann, nachdem die Drouiz genau im Herzen des Ackers eine Dankesgabe an die Natur vergraben und die Erde gesegnet hatten. Doch in dieser Nacht waren seine Gedanken nicht beim Fest, sondern bei seiner Gemahlin und Aodrén oben im Palas der Festung.
Unter anderen Umständen hätte er sich über eine Geburt unter den Feuern von Bealltainn gefreut. Bealltainn war das Fest des Lebens, des Lichtes und der Fruchtbarkeit und es gab keine schönere Form der Natur und den höheren Mächten die Ehre zu erweisen, als ihnen unter den Feuern ein neues, junges und frisches Leben zu schenken. Doch die Zeit seiner Gemahlin war noch lange nicht gekommen und selbst die Magie des Lichtes war nicht so stark, als dass sie aus einem unvollständigen Wesen ein zum Leben fähiges Kind machen konnte.
Seine Gemahlin hatte ihm an einem eiskalten Wintertag bei einem gemütlichen Schachspiel am wärmenden Feuer mitgeteilt, dass sie wieder schwanger war. Im ersten Augenblick hatte ihn dieses Geständnis verwirrt und geängstigt, denn Maeliennyd war schon weit über das Alter hinaus, in dem eine Frau ein Kind empfangen sollte. Nach der überaus schwierigen und gefährlichen Geburt seines jüngsten Sohnes Glaoda hatte er selbst keinen Augenblick gezögert, heimlich eine Schierlingssalbe zu verwenden, die seinen Samen unfruchtbar und somit für seine Gemahlin ungefährlich machte. Er nahm an, dass sie das Kind trotz seiner langjährigen, heimlichen Vorsichtsmaßnahmen irgendwann im Hochsommer oder im Frühherbst empfangen haben musste.
Natürlich hatte er Maeliennyd angefleht, sich nicht noch einmal dem Risiko einer Geburt auszusetzen und die gefährliche Leibesfrucht abzustoßen. Doch alle seine Versuche sie zur Vernunft zu bringen waren gescheitert. Schließlich hatte er aufgegeben und sich damit abgefunden, dass sie ihren Willen um jeden Preis durchsetzen wollte.
Chaulliac hatte Ambrosius, während sie gemeinsam den Weg von der Festung zum Festplatz hinunter gegangen waren bestätigt, was er oben im Gemach bereits in den Augen von Aodrén gelesen hatte: Es war zu spät, um die Geburt mit Hilfe irgendwelcher Kräutertinkturen aufzuhalten oder wenigstens hinauszuzögern.
Ambrosius ballte die Hände zu Fäusten und verschränkte die Arme fest über der Brust, um seine Gefühle unter Kontrolle zu halten. Er wollte den anderen nicht zu zeigen, wie sehr er um Maeliennyd zitterte. Leise verfluchte er dieses ungeborene Wesen, das durch seine bloße Existenz das Leben seiner Gemahlin in Gefahr brachte.
Für gewöhnlich war es Maeliennyd, die in der Nacht von Bealltainn nach dem Ende des Reigens um den geweihten Acker und die prächtig geschmückte Birke den jungen Tänzerinnen kleine Geschenke brachte: Geflochtene Körbchen mit süßem Buttergebäck, Nüssen und Beeren und hübsche bunte Bänder, um die Haare zu schmücken. Doch heute Nacht würden die Menschen die weiße Dame von Concarneau nicht zu Gesicht bekommen und sich aus diesem Grunde große Sorgen machen. Er musste ihnen eine glaubhafte Erklärung geben.
Seine Untertanen waren felsenfest davon überzeugt, dass Maeliennyds leichte Schritte um den geweihten Acker und den Maibaum dem Ritual der Belh-Feuer noch zusätzliche Kraft und Stärke verlieh und die Erde von Cornouailles so außergewöhnlich fruchtbar und reich machte. Hier war kein Unterschied zwischen denen, die der alten Religion folgten oder jenen die die sonntäglichen Messen der christlichen Priester besuchten. Auch der förmliche Kuss, den die Herzogin, so wie es in ihrer Heimat Wales alte Sitte war, der Frühlingskönigin und ihrem Gefährten auf die Stirn gab, galt als besonderer Glücksbringer. Seit der allerersten Nacht von Bealltainn in der Maeliennyd zugegen gewesen war, vor nunmehr zwanzig Jahren, hatten sowohl die auserwählte Frühlingskönigin, als auch der junge Mann, der ihren Gefährten, den grünen Mann darstellte immer ungewöhnlich viel Glück im Leben gehabt.
Natürlich hatte es damals nicht lange gedauert und die Kunde von diesem Glück hatte die Runde durch das kleine Land am mehr gemacht. Nun, zwei Jahrzehnte später, war der Segen der weißen Dame von Concarneau ein beinahe genauso wichtiger Bestandteil der Nacht von Bealltainn geworden, wie die mächtigen Feuer und die Segnung der Felder von der Hand der Drouiz.
Ambrosius schluckte trocken, als die letzten Töne der fröhlichen Weise endlich verklangen und seine Leute erwartungsvoll zum Hügel hinaufblickten, auf dem er zusammen mit den anderen Weiße Brüdern stand. Der Herzog bedeutete einem jungen Mann in einem blauen Gewand, das ihn als einen Barden kennzeichnete, Maeliennyds Korb mit den Geschenken zu nehmen und ihm zu folgen. Dann zwang er sich dazu, sein Gesicht unbekümmert und fröhlich wirken zu lassen. Im gleichen Augenblick, in dem er das Kind verflucht hatte, hatte er den Beschluss gefasst, den Menschen die Wahrheit über den Grund der Abwesenheit seiner Gemahlin zu sagen….auch wenn er ihnen die schwerwiegenden Umstände selbst verschweigen wollte.
Kurz richtete Ambrosius seine Augen auf den Mond. Er glänzte, wie eine frisch polierte Scheibe aus reinem Silber, so hell und so klar, dass man ohne Mühe die Farben der Gewänder der Mädchen erkennen konnte. Selten hatte er in einer Bealltainn-Nacht den Mond in einem solchen Glanz erstrahlen gesehen. Obwohl Mitternacht und der Augenblick der Feuer nicht mehr fern waren, war es immer noch warm, geradezu sommerlich. Vielleicht sollte er dies alles ja als ein gutes Zeichen für das Schicksal von Maeliennyd deuten und aufhören, seinen düsteren Gedanken nachzuhängen. Die Natur quoll geradezu über mit Leben und Freude. Seine Gemahlin war gesund; Aodréns Magie war stark, seine Kenntnisse als Arzt und Heilkundiger schier grenzenlos. Selbst Guy de Chaulliac hatte wie ein kleiner Schüler mit gesenktem Haupt und eingezogenem Schwanz ohne ein einziges Widerwort das Feld geräumt, als der alte Mann sie dazu aufgefordert hatte, das Gemach seiner Herzogin zu verlassen. Während Ambrosius von Cornouailles den Hügel zu seinen Leuten hinunterging, schickte er ein stummes Stoßgebet hinauf zu den Sternen.
XV
Der Kräuterduft im Raum zeigte seine Wirkung. Maeliennyd war sehr gelassen und ruhig geworden. Offensichtlich hatte es ihr geholfen, ihm die Bilder anzuvertrauen, die sie im kalten Feuer gesehen hatte.
Seit sie vor rund zwei Stunden mit ihrer Erzählung zu Ende gekommen war, hatten endlich spürbar Wehen eingesetzt. Auch sein Trank hatte die gewünschte Wirkung nicht verfehlt: Leicht ruhte seine Hand auf ihrem gewölbten Leib während er leise zählte.
Die Wehen kamen inzwischen in regelmäßigen Abständen. Seine Augen glitten wieder hinüber zu der Kerze, die speziell für solche Situationen hergestellt wurde. Sie brannte luftgeschützt hinter Glas. Es dauerte etwa das Viertel einer Stunde, bis sie von einer leuchtendroten Markierung bis zur nächsten abbrannte. Zwischen zwei Markierungen fühlte er immer genau zwei Mal das Zusammenziehen der Gebärmutter und ihre darauffolgende Entspannung, die den Leib wieder ganz weich werden ließ.
Während seine Rechte erneut nach dem Kind tastete, sprach der alte Mann weiter beruhigend auf Maeliennyd ein. Er gab sich viel Mühe sie abzulenken. Um die Erinnerungen an die Vision im kalten Feuer zu vertreiben erzählte er ihr sämtlichen, belanglosen Tratsch, den er während der letzten paar Tage aufgeschnappt hatte genauso, wie uralte Anekdoten aus seiner Zeit der Wanderschaft, als er bis zu den fernen Bergen Indiens am äußersten Rand der Welt vorgedrungen war. Sie musste ihre Atmung unter Kontrolle halten, um ihm zu helfen. Das Kleine lag richtig und der Muttermund war weit geöffnet. Nur noch ein bisschen Geduld, dann würde das Köpfchen bis auf den Beckenboden herunterkommen und er konnte sie dazu auffordern endlich zu pressen.
Wie eine harte Kugel krampfte sich die Gebärmutter unter seiner Hand zusammen und die Herzogin stöhnte zwischen zusammengebissenen Zähnen. Er wusste, dass es weniger der Schmerz und mehr die Anstrengung war, die dieses Stöhnen ausgelöst hatte. Seine Geburtszauber waren mächtig und ersparten einer Gebärenden das Schlimmste, doch gegen die Mühen der Wehen kannte auch die stärkste Magie der Drouiz keine Mittel. Er sandte ein leises Stoßgebet zu den Sternen. Wenn es ihnen gelingen würde, die eigentliche Pressphase auf weniger als zwei Markierungen der Kerze zu beschränken, dann hatte das Kleine eine gute Chance zu leben.
Seine Hand hob sich kurz von ihrem Leib und ergriff zielsicher ein kleines Fläschchen Kurz wärmte er das zu einem reinen Pulver gestoßene und mit einem Quintlein Quellwasser vermischte Eisenkraut über einer Flamme neben dem Bett. Dann drückte er es sanft gegen ihre Lippen und forderte sie auf, alles in einem Zug zu trinken. Das heilige Kraut, das die Ägypter zu Ehren der großen Mutter Kraut der Isis nannten, half den Frauen schon seit undenklicher Zeit leichter zu gebären. Er fühlte, dass die größte Gefahr jetzt nicht mehr für das Leben von Maeliennyd bestand, sondern für das kleine Wesen selbst. Es musste schnell gehen, ansonsten würde das Kind sich so sehr erschöpfen, dass es keine Kraft mehr hatte, um den ersten Atemzug zu tun.
„Jetzt“, sagte er bestimmt und bemühte sich, seine Stimme so optimistisch, wie nur irgend möglich klingen zu lassen. Dann legte er die Linke zurück auf den Leib der werdenden Mutter und drückte fest.
XVI
Bran’wen starrte auf den Ollamh und auf das Bett auf der anderen Seite des Zimmers. Der süße Duft des Kräuteröls in der Tonschale hatte auch ihre Sinne ein wenig betäubt. Sie verspürte unbändige Lust, die Augen zu schließen, doch ihr Herz wollte jetzt nicht schlafen, sondern ihrer Herrin, so wenig dies auch nützen mochte, in dieser schweren Stunden beistehen.
Sie hatte sich hingekniet und ihre Arme auf der Truhe verschränkt. Aodrén schien so in seiner Arbeit der Geburtshilfe gefangen, dass er der Ecke des Raumes in der sie sich versteckte, keine Beachtung schenkte. Die Herzogin selbst kämpfte viel zu schwer, um überhaupt noch etwas anderes wahrzunehmen, als den Schmerz und das Gesicht des weisen Mannes direkt vor ihr. Bran’wen war froh, dass er es war, der Maeliennyd Glyn Dwyr beistand. Er war mächtig und seine Magie war stark. Wenn immer es möglich war, dann schickten die Weiber, die ein Kind zur Welt bringen mussten nach dem Ollamh, denn er besaß ein fast grenzenloses Wissen und höchste Weisheit. Und wenn immer es möglich war, dann kam Aodrén auch zu ihnen. Er machte dabei niemals einen Unterschied zwischen arm und reich, wohlgeboren, oder Taglöhner.
Obwohl er noch viel älter war, als sie selbst, war ihm kein Weg zu weit oder zu gefährlich, wenn es darum ging einer Frau in diesem gefährlichen und schwierigen Augenblick beizustehen. Selbst im tiefsten Winter oder im strömenden Regen stieg der Ollamh auf seinen Falben und ritt hinaus.
Maeliennyd Glyn Dwyr schrie plötzlich gellend auf und Bran'wen sah, wie etwas Silbern in Aodréns Hand aufblitzte. Schließlich hörte sie, wie er die Herzogin dazu anspornte noch ein letztes Mal ganz tief Luft zu holen. Es war offensichtlich fast vorbei. Im Licht der Fackeln und des Vollmondes erkannte die alte Frau das seltsame, scharfe Messer aus bläulichem Stahl, von dem es hieß, der Ollamh habe es von einer seiner weiten Reisen ans andere Ende der Welt mitgebracht. Sie hatte ihn einmal beobachtet, wie er damit einen zerquetschten Finger amputiert hatte. Alles war so schnell gegangen, dass der verletzte Köhler nicht einmal die Zeit gehabt hatte, zu schreien.
„Ich hab nur Platz für das Köpfchen geschaffen“, erklärte der Ollamh ihrer Herrin. Er war gelassen und seine Stimme klang selbstsicher. „Du brauchst Dir keine Sorgen zu machen. Der Schnitt durch den Damm heilt viel schneller, als wenn ich zugelassen würde, dass das Kind Dich zerreißt.“ Bran'wen konnte genau sehen, wie er mit der Rechten den Kopf des Kleinen stützte, um zu vermeiden, dass dieser sich zu schnell nach hinten beugte. Seine Linke presste einen feuchten Lappen gegen den Unterleib von Maeliennyd, während er weiter in ruhigem Ton jeden seiner Handgriffe kommentierte. Bran'wen lies nun alle Vorsicht außer Acht. Sie stand vom Boden auf und setzte sich auf die Truhe, damit sie besser sehen konnte. Aodrén schien den Kopf des Kindes zu drehen und zu senken, damit die vordere Schulter geboren werden konnte. Ihre Herrin seufzte plötzlich laut und voller Erleichterung. Noch bevor Bran'wen begriff, was gerade geschehen war, hatte der alte Mann sich erhoben und ein winziges, blutiges Bündel, nur durch die Nabelschnur mit dem Mutterleib verbunden, lag auf dem Bauch von Maeliennyd. Ihre Herrin legte beschützend beide Hände über das kleine Wesen und weinte hemmungslos. Es waren Tränen des Glückes und der Erleichterung.
XVII
„Ein Knabe! Du hast Deine Sache sehr gut gemacht Herzogin.“ Aodrén wusch sich in der Waschschüssel gründlich die Hände.
Er musste nur noch die Nabelschnur durchtrennen und abbinden und dann dem kleinen Kerl vorsichtig den Schleim aus Mund und Nase entfernen.
Seine haselnussbraunen Augen blitzten vergnügt. Diese alte Närrin Bran'wen hinten in der Ecke hatte doch tatsächlich geglaubt, dass es ihm nicht aufgefallen war, wie sie hinter der Truhe versteckt geblieben war, als er alle anderen aus Maeliennyds Schlafgemach verscheucht hatte.
Doch er konnte der Frau einfach nicht böse sein.
Wenn sie nicht so schnell angerannt gekommen wäre, als die Herzogin hingefallen und sich angeschlagen hatte, dann würde er jetzt höchstwahrscheinlich nicht in allerbester Laune hier stehen.
Anstatt sich nach einer erfolgreichen Geburt zufrieden die Hände zu waschen, würde er vermutlich gemeinsam mit vielen anderen Menschen und Ambrosius Arzhur eine gute Frau und ihr ungeborenes Kind beweinen. „Wo sie schon einmal da ist, kann Bran'wen sich gleich nützlich machen“, dachte er. Sie konnte den kleinen Kerl baden, während er ihre Herrin versorgte.
Nachdem seine Hände abgetrocknet und das Skalpell aus Damaszenerstahl in einer Schale mit hochprozentigem Gerstenschnaps gesäubert war, wandte er sich wieder Maeliennyd Glyn Dwyr und ihrem Neugeborenen zu. Trotz der anstrengenden und angstschweren Stunden, die sie durchlitten hatte, wurde ihr Gesicht von einem Lächeln erhellt. Als er die Nabelschnur abgeschnitten und abgebunden hatte, ergriff er den Kleinen vorsichtig und nahm ihn vom Bauch der Mutter.
Mit geübtem Griff legte er sich den Knaben in die Armbeuge. Der Feuerschein im Kamin beleuchtete ein winziges runzeliges Gesicht. Dem alten Mann stockte der Atem. Ein wilder Schmerz, wie von einem Pfeil schoss durch sein Herz. Das winzige Gesicht war nicht rosig, sondern leicht bläulich verfärbt. Aodrén musste sich dazu zwingen, keine Panik aufkommen zu lassen. Rasch säuberte er mit dem kleinen Finger die Nasenlöcher und den Mund des Neugeborenen, dann drehte er ihn um und versetzte ihm einen bestimmten Klaps auf den nackten Hintern. Durch diesen Schrecken wollte er den ersten Schrei des Knaben provozieren. Doch das Neugeborene schrie nicht. Ein zweiter Klaps zeigte ebenso wenig Wirkung. Maeliennyd beobachtete ihn nur stumm aus dunklen Augen. Das Lächeln hatte einem Ausdruck absoluten, ungläubigen Entsetzens platzgemacht. Sie hatte eine Hand über den Mund gelegt, um ihren Schmerz nicht herauszuschreien.
Noch einmal drehte Aodrén das Kind um, doch jetzt packte er es an den kleinen Füßen und lies es mit dem Kopf nach unten hängen. Der dritte Klaps war wesentlich härter und bestimmter, als der erste und der zweite. Ein trauriges Seufzen aus tiefstem Herzen, dann schüttelte er langsam den Kopf.
Maeliennyd schrie auf, wie ein verletztes Tier. „Das ist nicht wahr, Ollamh“, fauchte sie zwischen zusammengebissenen Zähnen. Ihr schmerzender Unterleib, ihre Schwäche und die Erschöpfung wichen mit einem Mal einem Gefühl des grenzenlosen Zorns. Sie richtete sich mit einer Kraft und Energie auf, die Aodrén, ihr nicht zugetraut hätte. „Du hast mich belogen, alter Mann“, herrschte ihn die Herzogin an und zeigte anklagend mit dem Finger auf ihn und das leblose Bündel in seinen Armen, „du hast mir geschworen, dass er leben wird. Du hast mir heute Nachmittag geschworen, dass er leben wird, bevor Du meinen Gemahl und den Okzitanier aus dem Raum geschickt hast. Fluch über Dich und Deine Schlangenzunge.“
In dem Augenblick, in dem Maeliennyd mit zornig funkelnden Augen ihre Verwünschung auf ihn los jagte, ertönte von draußen durch die geöffneten Fenster ein unbändiger Jubelschrei aus hunderten und aberhunderten von Kehlen. Das magische, kalte Feuer, das der Ollamh zuvor im Kamin entfacht hatte zischte plötzlich hoch und ein Meer von Funken stob durch das Gemach, während sich draußen ein gewaltiger, leuchtendgelber Schein zum Himmel hinaufstreckte. Ambrosius von Cornouailles und die Drouiz hatten die Bealltainn-Feuer entzündet.
XVIII
Gebannt folgte Bran'wen dem erbarmungslosen, bitteren Kampf zwischen ihrer Herrin und dem Ollamh. Immer noch hielt dieser das tote Kind in den Armen. Maeliennyd Glyn Dwyr schrie und weinte und stieß schreckliche Verwünschungen aus, während der weise Mann verzweifelt versuchte, ihr zu erklären, dass es bereits an ein Wunder grenzte, dass sie selbst diese Geburt unbeschadet überstanden habe, man aber für den zu früh geborenen Knaben nichts mehr tun konnte.
„Du lügst“, zischte sie böse, wie eine Schlange, „von Anfang an hast Du mit meinem Gemahl unter einer Decke gesteckt. Du wolltest mich dazu überreden, Deinen verfluchten Trank einzunehmen und meinen Sohn einfach abzustoßen, wie eine unnütze Last.“
„Närrin“, herrschte Aodrén sie genauso böse an, „du weißt genauso gut, wie ich oder jeder andere vernünftige Mensch, das eine Frau die in Deinem Alter empfängt kaum eine Chance hat, bis zum Ende ihrer Schwangerschaft zu kommen. Wie viele kennst Du? Sag es mir. Sei dankbar, dass Du Deinen Wahnsinn überlebt hast.“
Maeliennyd Glyn Dwyr streckte ihre Arme nach dem kleinen Bündel aus und versuchte sich vom Bett hoch zu kämpfen. „Gib mir meinen Sohn, alte Schlange. Er ist ein Kind des Lichtes. Er ist unter den Feuern von Bealltainn geboren und ich schwöre Dir, dass er leben wird… es gibt Mittel und Wege… Du kennst sie genauso gut, wie ich.“
Draußen vor dem Fenster wurde das Jubeln der Menschen immer lauter, während die Flammen der Bealltainn-Feuer höher und höher in den Himmel stiegen. Der Geruch nach brennendem, knochentrockenem Holz wurde vom leichten Frühlingswind in den Raum getrieben und vermischte sich mit den Gerüchen der Geburtskräuter, die immer noch in der Tonschale dampften. Zu den Stimmen der Menschen gesellten sich nun auch noch die der Tiere. Wildes Blöcken und heißeres Muhen erfüllte die Nacht, während man die große, aufgeregte, wogende Masse geschickt zwischen den beiden Feuern hindurchtrieb. Schrill wieherten von den Flammen verängstigte Pferde, als der harte Druck der Schenkel ihrer Reiter auch sie durch das heilige Licht zwang. Die reißenden Ströme der schönen, warmen Jahreszeit schäumten aus den schier berstenden Herzen der Menschen unten auf dem Festplatz und auf der großen Lichtung im Wald von Carnöet. Ein Teil von Maeliennyd war unendlich müde und beinahe geneigt, den Kampf aufzugeben, sich in das Schicksal zu führen und ihren toten Sohn zu betrauern, während ein anderer Teil von ihr draußen mit den anderen zwischen den Feuern hindurchrannte und vom Leben und vom Licht gestärkt wurde.
„Großer Rabe“, flehte sie stumm die Némain Sidhe um Hilfe an, die ihr in den kalten, blauen Flammen einen hochgewachsenen, schwarzhaarigen Mann mit scharf geschnittenem Gesicht und schwarzen Augen gezeigt hatte, der das weiße Gewand eines Drouiz über den breiten Schultern trug. Ihre Augen hielten die Augen von Aodrén fest und bohrten sich tiefer und tiefer in die Seele des Weisen. Sie verbannte die Schwäche und konzentrierte sich nur noch auf die Kraft des Lebens und des Lichtes. Als sie bereits einen Fuß auf den Boden gesetzt hatte und sich mit der Hand an der Bettkante abstützte um aufzustehen, gab er endlich nach.
Aodrén wich einen Schritt zurück und senkte die Augen. “Willst Du um seinetwillen sterben. Närrin“, sagte er enttäuscht und bitter, „du bist zu schwach. Du könntest in diesem Augenblick nicht einmal eine Kerze anzünden, ohne einen Spann und Feuersteine zur Hilfe zu nehmen…“
„Aber Du könntest es“, erwiderte die Herzogin von Cornouailles mit ruhiger Stimme. Sie wusste, dass sie den Kampf gewonnen hatte. Der Ollamh beugte sich und würde endlich tun, was getan werden musste. Langsam sank sie in die Kissen zurück ohne dabei ihre Augen von Aodrén zu nehmen. Ein leiser Hauch von Traurigkeit überfiel sie, als sie begriff, dass dieser Sieg sie vielleicht für immer seine Freundschaft und seine Achtung kosten würde. Doch sie vertrieb dieses Gefühl genauso unbarmherzig, wie zuvor die Schwäche und den Schmerz in ihrem Körper. Das Einzige, was zählte war das Leben ihres Sohnes.
XIX
Bran'wen biss sich auf die Lippen um einen Schrei des Entsetzens zu unterdrücken. Der laute, wüste Streit zwischen ihrer Herrin und dem weisen Mann hatte nur wenige Augenblicke gedauert. Jetzt wischte Aodrén mit einer barschen Handbewegung das magische Feuer aus dem Kamin und zog es in einem weiten Kreis um sich und das tote Kind in seiner linken Armbeuge. Die Flammen züngelten kalt und blau, als sie sich um die beiden zu einem undurchdringlichen Wall schlossen.
Nur verschwommen konnte sie erkennen, was der Ollamh in der Mitte seines magischen Kreises tat. Er kniete sich hin und legte den leblosen, blutverschmierten, winzigen Körper vor sich auf den Boden. Dann zog er den schmalen, langen Dolch aus der Scheide an seinem Gürtel und zog sich die Klinge in einer raschen, geübten Bewegung über die Innenfläche der Hand.
Als das Blut aus der Schnittwunde auf den Leib des Kindes tropfte, beugte er sich zu ihm hinunter und legte seinen Mund auf den Mund des Kleinen. Gleichzeitig zeichnete seine blutige Hand einen Kreis auf der Brust des Jungen. Immer wieder richtete Aodrén sich auf, hob beschwörend die Hände und murmelte unverständliche Worte. Dann beugte er sich wieder über den Kleinen. Nach einer Weile schien es so, als ob es ihm gelang, dem Kind von seiner eigenen Lebenskraft und Stärke einzuhauchen. Bran'wen bemerkte, wie sich eines der winzigen Beinchen schwach bewegte, dann das andere.
Immer öfter richtete der weise Mann sich auf um seine mächtigen Beschwörungen über dem kleinen Wesen zu sprechen. Ihre Herrin lag auf der anderen Seite des Raumes auf dem Bett ausgestreckt und starrte genauso gebannt in die Flammen, wie sie selbst. Und plötzlich wuchsen die Flammen des magischen Feuerkreises so hoch, dass sie sowohl Bran’wen, als auch Maeliennyd Glyn Dwyr den Blick in sein Inneres vollkommen versperrten.
Ein gellender, spitzer Schrei erfüllte den Raum. Die alte Frau erschrak zu Tode, als sich der Feuerkreis mit einem Mal in Nichts auflöste und der Ollamh mit dem blutverschmierten, wild strampelnden und lauthals brüllenden Knaben zum Bett der Mutter hinüberging. Seine Schritte waren unsicher und kraftlos und sein bärtiges Gesicht schien leichenblass. Seine für gewöhnlich lebhaften, braunen Augen wirkten leer und tot.
„Dein Sohn, Herzogin von Cornouailles“, sagte der alte Mann zu Tode erschöpft, als er Maeliennyd Glyn Dwyr das Neugeborene an die nackte Brust legte. „ Vergiss niemals, dass Zauber nicht immer so wirken, wie wir Menschen uns dies wünschen. Sie unterliegen ganz eigenen Gesetzen und diese Gesetze sind uns genauso fremd, wie der Lauf der Zeit oder der Wille der höheren Mächte.“ Dann sank er neben ihr auf die Bettkante und seufzte schwach. „Hör endlich auf zu gaffen, Du törichtes, altes Weib.“ Seine leeren, toten Augen richteten sich kurz auf Bran'wen, die immer noch stocksteif mit vor den Mund geschlagenen Händen auf der Kleidertruhe hockte. „Lauf schon hinunter in die Küche, hole einen Kessel voll warmem Wasser und saubere Tücher. Der kleine Prinz von Cornouailles muss endlich gewaschen und gewickelt werden.“
XX
Guy de Chaulliac beobachtete seinen Freund Ambrosius Arzhur. Der saß inmitten seiner Gefolgsleute und der anderen Drouiz an einer der sich vor Überfluss durchbiegenden Festtafeln.
Während alle um ihn herum schmausten, tranken und fröhlich durcheinanderschwatzten hingen seine Augen, wie gebannt an den beiden Bealltainn-Feuern, die langsam herunterbrannten, während sich am fernen Horizont die ersten Strahlen der Morgensonne aus der Dunkelheit hervorschlichen und den vollen Mond langsam von seinem erhabenen Platz am Himmel vertrieben.
Zwischen den Fingern drehte der Herzog einen silbernen, mit blutrotem Wein gefüllten Pokal hin und her, ohne jedoch aus ihm zu trinken. So saß Cornouailles nun schon seit vielen Stunden da, unbeteiligt und abwesend. Er schien nachdenklich. Guy hatte sich gewundert, als er den Leuten erklärte, dass seine Herzogin nicht mit ihnen Feiern würde, weil sie in der Nacht von Bealltainn einem Kind das Leben schenkte. Die Menschen hatten nach dieser Ankündigung laut gejubelt und geklatscht und während die Nachricht ihren Weg durch die unüberschaubar große Menge machte, waren diese Freudenbekundungen immer lauter und fanatischer geworden.
Sogar die christlichen Priester und die Mönche aus zwei in der Nähe gelegenen Klöstern, die trotz ihres anderen Glaubens zu diesem Fest eingeladen worden waren hatten es sich nicht nehmen lassen, ihrem Gott für diese gute Neuigkeit zu danken und für die weiße Dame von Concarneau zu beten, während die Drouiz die Bealltainn-Feuer entzündeten.
Guy schüttelte sich bei dem Gedanken, wie die Menschen wohl reagieren würden, wenn sie am Morgen erfahren mussten, dass das Land seine Herzogin verloren hatte: Die, die am alten Weg festhielten, würden es als ein schreckliches Omen ansehen, ein Vorzeichen für einen schlechten Sommer und unfruchtbare Felder. Vielleicht würden sie sogar die Macht der Drouiz in Frage stellen, weil dieses Unheil unter den Feuern von Bealltainn geschehen war.
Die Schwächsten und Wankelmütigsten von ihnen würden sich davonschleichen und zu den christlichen Priestern zu laufen. Und die christlichen Priester würden es sich gewiss nicht nehmen lassen, in ihren Kapellen und Kirchen vor den Altar zu treten über dem ihr zu Tode gemarterter Gott an seinem Holzkreuz hing, um den anderen zu erzählen, dass das Unglück, das die herzogliche Familie von Cornouailles in ausgerechnet dieser Nacht befallen hatte die gerechte Strafe für ihre heidnische Ketzerei war, an der sie so unbeugsam festhielten: ein Fingerzeig ihres rachsüchtigen, christlichen Gottes, endlich den Hexer von Concarneau und sein walisisches Teufelsweib zu vertreiben und einen rechtgläubigen Fürsten ins Land zu rufen.
Ambrosius musste entweder wahnsinnig oder völlig verzweifelt gewesen sein.
Mit seinen unbedachten Worten hatte er nicht nur seine eigene Herrschaft aufs Spiel gesetzt, sondern möglicherweise auch der weißen Bruderschaft einen nicht wieder gut zu machenden Schaden zugefügt.
Finster wandte Guy de Chaulliac seine Augen von dem stillen, nachdenklichen Mann im weißen Gewand der Drouiz und blickte hinauf zur Festung von Carnöet, die dunkel und verlassen auf dem Hügel über ihnen thronte, wie eine Ruine aus längst vergessenen Zeiten.
Der Okzitanier beschloss, dass er so schnell es schicklich war aufbrechen würde, um diesem Ort auf Nimmerwiedersehen den Rücken zu kehren.
Sein Vater und sein Großvater hatten also doch recht gehabt, als sie ihn vor diesem kleinen Land am Ende der Welt und seinen Fürsten gewarnt hatten: Er hatte es damals nicht geglaubt, als er und Ambrosius Arzhur Freunde geworden waren. Der junge Herzog war ein genauso gefährlicher Fanatiker, wie zuvor schon sein Vater und sein Großvater …und dazu war der Mann auch noch vollkommen verrückt.
Er würde unverzüglich auf dem schnellsten Weg nach Prag reiten, um dem Großmeister des Ordens Stephan von Paléc mitzuteilen, was er in Paris entdeckt hatte. Nur so konnte es ihm vielleicht noch gelingen, seine unentschuldbare Vertrauensseligkeit wieder gut zu machen, Ambrosius Arzhur als Erstem von der Wiederentdeckung der Übersetzung des Manuskriptes des Abraham Eleazar berichtet zu haben.
Niemand konnte unter diesen Umständen vorhersehen, was dieser gefährliche Verrückte wohl zu tun in der Lage war, wenn seine Macht um seines bodenlosen Leichtsinnes Willen ins Wanken geriet. Guy konnte sich nur zu gut vorstellen, wie sein ehemaliger Freund sogar den heiligen Eid der weißen Bruderschaft brechen würde, um sich dieser Handschrift zu bemächtigen, die es dem Templerorden damals erlaubt hatte, über mehrere Jahrhunderte hinweg eine geradezu grenzenlose Macht beinahe mühelos auszuüben.
Gerade als er eine belanglose Entschuldigung erfinden wollte, um sich von seinen unlieb gewordenen Tischgefährten diskret zu verabschieden, um im Schutz der Morgendämmerung seine Abreise vorzubereiten, bemerkte er eine hochgewachsene Gestalt in einem weißen Gewand, die langsam von der Festung zum Festplatz hinunterkam.
Er kniff die Augen zusammen, um besser durch das trübe Licht des jungen Tages hindurchsehen zu können: Die hochgewachsene Gestalt hatte unverkennbar einen bis zum Gürtel reichenden, steingrauen Bart und ebenso lange, steingraue Haare, die offen über den Schultern hingen. In der Rechten hielt er einen hohen, schlanken Stab, dessen ungeschliffener Kristall an der Spitze die ersten Strahlen der Morgensonne brach.
Guy fuhr von seinem Platz hoch und stieß dabei so heftig gegen die Holzbohlen, die ihnen als Tisch gedient hatten, dass ein großer, tönerner Krug scheppernd zerbrach und alle am Tisch Sitzenden mit dunkelrotem Wein besudelte. Noch bevor die Ersten überhaupt dazu ansetzen konnten, ihn um seiner Unvorsichtigkeit willen lauthals zu beschimpfen, war er schon über die Bank gesprungen. Er rannte mit fliegenden Gewändern auf die weißgewandete Gestalt zu, die eine in ein feines, hellgrünes Tuch gewickelte Last trug.
„Aodrén“, schrie er, ohne das Kopfschütteln und die ungehaltenen Blicke derer zu beachten, die er bei seinem raschen Lauf achtlos zur Seite stieß. Ihm war mit einem Mal klar, was der alte Mann so stolz trug.
„Aodrén!“ als er den alten Drouiz schon beinahe erreicht hatte, hörte Guy ein zweites Paar Füße hinter sich. Dann spürte er kräftige, unnachgiebige Hände, die ihn an den Schultern packten und zurückhielten. Als er sich umdrehte, Entrüstung im Herzen und einen zornigen Satz auf den Lippen, blickte er in die schwarzen, tiefgründigen Augen des jungen Mannes, der ihnen erst am Morgen schweigend und unheimlich Wein serviert hatte. Doch jetzt waren diese Augen nicht mehr eiskalt und unerbittlich, sondern übermütig und ausgelassen: „Wartet bitte, Meister Chaulliac“, flüsterte der Wächter von Bar‘ch Hé Lan dem Okzitanier leise ins Ohr, „wartet bitte noch ein wenig. Es ist nicht an Euch, den kleinen Prinzen von Cornouailles in dieser Welt willkommen zu heißen.“
Aodrén war inzwischen stehengeblieben und hatte mit einer energischen Handbewegung seinen Stab in den Boden gestoßen. Dann nahm er das kleine, grün eingepackte Bündel vorsichtig in beide Hände und hielt es hoch über den Kopf damit alle es sehen konnten. Die Anstrengung der vergangenen Nacht stand ihm zwar ins Gesicht geschrieben, doch seine Stimme war energisch und fest, als er den Menschen und dem Herzog von Cornouailles den gesunden, lebendigen Knaben zeigte, dem die weiße Dame von Concarneau unter den Feuern von Bealltainn das Leben geschenkt hatte.
„Er ist nicht nur der dritte Sohn unseres Herzogs“, flüsterte der junge, dunkle Mann Guy de Chaulliac ins Ohr, „er wurde auch im Zeichen des Lichtes geboren. Die stehenden Steine von Carnac haben endlich wieder einen neuen Herrn.“
Der Okzitanier seufzte und ergab sich in sein Schicksal. Jene düsteren Gedanken und Pläne, die noch bis vor kurzem in seinem Kopf herumgeschwirrt waren, hatte er bereits verdrängt.
Aodrén wäre niemals so verrückt gewesen, ein totgeborenes Kind hierher zu bringen, denn er war nicht dabei gewesen, als Ambrosius Arzhur zu seinen Leuten gesprochen hatte und konnte deshalb auch nicht wissen, auf welches waghalsige und gefährliche Spiel der Herzog sich eingelassen hatte.
„Woher wisst Ihr eigentlich, dass der Ollamh uns allen einen Knaben vorführen möchte, “rächte er sich mit einer überaus schnippischen Frage an seinem Bezwinger. Der junge, dunkle Mann liest ihn los und klopfte ihn freundschaftlich auf die immer noch schmerzende Schulter: „Für die Knaben gibt es nur einfaches Grün, Meister Chaulliac“, erwiderte er ebenso schnippisch und sehr selbstbewusst, „bei den Mädchen mag der Ollamh es farbenprächtiger und spektakulärer: Er wickelt sie immer in das Drachenbanner von Wales, die Farben unserer Herzogin.“
Inzwischen hatten sich schon zahllose Menschen an ihnen vorbeigedrängelt und versperrten die Sicht. Ein paar Mönche, die zuvor unweit der Tafel von Chaulliac eifrig dem Wein zugesprochen hatten, waren sogar in die Knie gesunken und sprachen offensichtlich ein Dankgebet für die glückliche Geburt des jüngsten Prinzen von Cornouailles.
Er schüttelte leicht den Kopf und dachte daran, wie dieselben, überschwänglichen Gottesdiener im gegenteiligen Fall wohl ebenso enthusiastisch Ambrosius' Ketzerei verurteilt hätten. Inzwischen war es sogar seinem Freund gelungen, sich einen Weg bis zu Aodrén und zu seinem kleinen Sohn zu bahnen. Guy stellte sich auf die Zehenspitzen und streckte sich, um wenigstens ein klein wenig von dem ganzen Spektakel mitzubekommen.
Der Herzog strahlte. Die ganze Last der langen Nacht war von ihm abgefallen. Seine Augen leuchteten, während er sich leise ein paar kurze Augenblicke mit Aodrén zu beraten schien, der ihm schließlich irgendetwas ins Ohr flüsterte. Dann nahm er das kleine, grüne Bündel aus den Armen des alten Mannes entgegen und erkannte damit gemäß der alten Sitte dieses Kind offiziell als seinen Sohn an.
Das meiste, was der Herzog zu seinen Leuten sagte, während er den inzwischen ausgesprochen griesgrämigen, kleinen Kerl hochhielt verstand Guy de Chaulliac nicht. Für ein zu früh geborenes Kind konnte der Prinz von Cornouailles nämlich gewaltig schreien. Nur seinen Namen bekam er mit: Sévran de Carnac.
Den Leuten und dem jungen, dunklen Wächter schien dieser Name gut zu gefallen, denn sie riefen ihn ein paar Mal laut und enthusiastisch, bevor sich Aodrén endlich des kleinen Bündels erbarmte und es seinem Vater wieder abnahm, um es zurück in die Festung zu tragen, wo es sich im Arm seiner Mutter beruhigen konnte.
„Ich hoffe Du wirst einmal mit genauso viel Verstand gesegnet sein, wie Du heute Nacht Glück gehabt hast, Sévran de Carnac“, schickte er dem kleinen Prinzen von Cornouailles seine ganz persönlichen guten Wünsche hinterher. Dann lies er sich von der begeisterten Menschenmenge widerstandslos zurück zu den Festtafeln schieben. Ein paar kräftige Mägde schleppten bereits frische Krüge mit Wein und Bier zu den Tischen und er beschloss, dass man die Nachricht für den Großmeister des Ordens auch durchaus erst am nächsten oder übernächsten Tag auf den weiten Weg gen Osten schicken konnte.