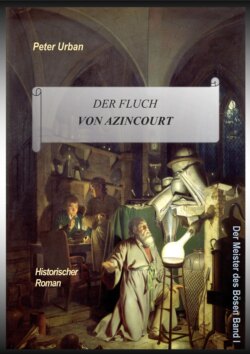Читать книгу Der Fluch von Azincourt Gesamtausgabe - Peter Urban - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 1 Das Amulett
ОглавлениеI
Boucicault schmunzelte, als er das Wappen erkannte. Schwarz hob es sich von dem hellgrünen Schild ab, als der junge Mann sein Pferd auf der Hinterhand wendete: Zwei mächtige Drachen hielten zwischen ihren Klauen ein Pentagramm, dessen Spitze gen Himmel zeigte. Also hatten sogar sie sich dieses eine Mal dazu durchgerungen Partei zu ergreifen. Charles d’Albret hatte es geschafft. Der Konnetabel von Frankreich hatte innerhalb von nur zwei Monaten eine riesige Armee vor den Toren von Rouen gesammelt. Und es erweckte den Anschein, als ob diese Armee bereit war, für die Sache der Valois zu kämpfen.
Die großen Seigneurs von Frankreich waren alle nur selbstsüchtige, eigenwillige, untereinander verfehdete Individualisten, die lediglich auf ihren eigenen Vorteil bedacht waren und ihre militärische Stärke am liebsten meistbietend versteigerten. Charles VI. de Valois, den man seit seinem misslungenen Feldzug gegen die Bretagne im Jahre 1392 als den wahnsinnigen König belächelte, konnte für gewöhnlich nur wenig von ihnen erwarten...am allerwenigsten Loyalität zu seinem Haus.
Boucicault hatte gehofft, dass Ambrosius Arzhur de Cornouailles und sein Nachbar und Busenfreund Yann de Montforzh ihre sture Neutralität und ihre aufrührerischen Unabhängigkeitsgedanken wenigstens dieses eine Mal im Augenblick der größten Gefahr für das Überleben von ganz Frankreich hinter dem Interesse aller zurückstellen konnten.
Genauso, wie die Burgunder: Jean Sans Peur und seine beiden Brüder waren mit einem ansehnlichen Kontingent in Rouen eingetroffen, obwohl Gerüchte umgingen, dass der Herzog immer noch mit dem Gedanken spielte, heimlich mit den Engländer gemeinsame Sache zu machen.
Der mit dem teuflischen Schild und dem nachtschwarzen Kriegspferd, dem man seine hispanischen Vorfahren deutlich ansah und das vermutlich ein kleines Vermögen gekostet hatte, war gewiss Cornouailles’ ältester Sohn Aorélian de Douarnenez, der Erbe der Herzogskrone des geheimnisumwobenen, kleinen Fürstentums an der sturmgepeitschten Atlantikküste am äußersten Zipfel Frankreichs; Penn Ar Bed – das Ende der Welt.
Douarnenez schien eine Hundertschaft Berittener zu bringen. Das war eine beachtliche Anzahl von Männern, wenn man in Betracht zog, wie unwirtlich das Küstenland Armôr und die Wälder des Argoat mit den Monts Arée waren. Sein Vater, der Herzog Ambrosius Arzhur, hatte vermutlich jedes einzelne Kriegspferd für hartes Gold in der Normandie gekauft. Dazu kamen noch einmal fünfhundert oder sechshundert Bogen- und Armbrustschützen.
„Salud dit, Arzhur!“, hörte Boucicault den jungen Mann in seiner Muttersprache fröhlich durch den Lärm des Feldlagers vor den Toren der Stadt Rouen rufen.
„Gant pasianted ha hir amzer, E vez graet meur a dra, Aorélian. – Gut Ding will Weile haben“, schrie Arzhur de Richemont zurück. Der jüngste Bruder des bretonischen Herzogs Yann de Montforzh hievte sich vom langen Ritt etwas steif aus dem Sattel eines bildschönen Goldfuchses mit eindeutig orientalischen Vorfahren. Hinter Richemont flatterte seine berüchtigte weiße Kriegsfahne mit dem Eber, der Eiche und dem arroganten Motto „Que qui le vueille! – Wer mit mir Streit sucht, der wird ihn finden!“
Die Männer aus Rennes waren eben erst angekommen, obwohl ihr Weg um vieles kürzer gewesen war, als der aus Concarneau von der wilden Felsenküste des Penn Ar Bed. Der junge Douarnenez lenkte seinen Schwarzen geschickt durch die Bogenschützen hindurch zu Richemont hinüber. Auch er sprang aus dem Sattel und die beiden Männer umarmten sich, wie Brüder.
Boucicault schüttelte den Kopf. Eine barbarische Sprache, das Keltische. Eine barbarische Sitte, diese öffentliche Zurschaustellung von Gefühlen. Wenn er es nicht besser gewusst hätte, dann hätte er die lebhafte Jugend mit den langen, offenen Haaren, den prächtig bestickten, bunten und weiten Surcotten, den altmodischen Kettenhemden und den sündhaft teuren ausländischen Kriegspferden vielleicht gleichfalls als Barbaren abgetan. Doch er kannte aus langer und oftmals schmerzlicher, militärischer Erfahrung sowohl Yann de Montforzh, als auch Ambrosius Arzhur Emrys de Cornouailles, die Herzöge der beiden Gebiete an der Atlantikküste: Sie verfügten über ergebene Vasallen und sorgsam ausgebildete Bogenschützen, die sie als Miliz hatten und nicht wie alle anderen als Söldnertruppe. Sowohl Arzhur de Richemont, als auch Aorélian de Douarnenez hatten sich bereits einen eigenen, guten Ruf erkämpft und auf vielen Turnieren geglänzt. Sowohl die Bretagne, als auch das kleine, abgelegene und geheimnisvolle Cornouailles konnten ihre Ansprüche mit Waffengewalt durchsetzen und wussten ganz genau, wie man im Spiel der Mächte Frankreichs seine Stellung hielt....und beide Fürsten hatten große Flotten, bis an die Zähne bewaffnete, moderne Kriegsschiffe und mächtige Kauffahrer, die ihren Ländern Reichtum und Wohlstand brachten.
Alleine schon die Tatsache, dass Ambrosius' ältester Sohn gemeinsam mit Yanns jüngstem Bruder hier auftauchte und die Größe der beiden Kontingente, deuteten darauf hin, dass die beiden eigensinnigen Herzöge die Invasion der Engländer als eine Bedrohung für ihre eigenen Grenzen ansahen. Darum fanden sie sich ausnahmsweise einmal bereit, zusammen mit Orléans, Armagnac und allen anderen auf Seiten der Valois zu kämpfen, anstatt wie üblich geduldig abzuwarten und zuzusehen...und sich hinterher aus den Überresten der geschwächten Gegner straflos zu bedienen, wie gierige Aasvögel.
Und sie würden kämpfen. Boucicault spürte es. Bald.
Henry, der Sohn des Thronräubers und Mörders Lancaster, wollte diesen Krieg, der während der letzten zwanzig Jahre zu einem unbehaglichen Waffenstillstand zwischen ihren beiden Ländern geworden war, um jeden Preis wieder aufflammen lassen.
„Um jeden Preis“, murmelte Boucicault, während er seine Augen von der jungen Schar aus der Bretagne und aus Cornouailles abwendete, „ und der Preis ist die Normandie, und die soll der Engländer um nichts in der Welt bekommen...So helfe uns Gott.“ Der Marschall stieß seinem Pferd scharf die Sporen in die Flanken.
Morgen, bei Tagesanbruch, würden sie aufbrechen und Lancaster entgegen ziehen. Henry hatte nach einer schmerzhaften wochenlangen Belagerung den Hafen Harfleur genommen und dabei zweitausend seiner zehntausend Soldaten in den Marschlanden und auf den Schanzen vor der befestigten Stadt gelassen. Weitere zweitausend verrotteten, krank oder sterbend. Die unwilligen Bürger von Harfleur unterstützt von Schwärmen hungriger Stechfliegen, hatten dem Engländer schnell den Mut für seinen kühnen Plan genommen, die Eroberung der Normandie zu beginnen und noch vor Wintereinbruch 1415 auf Paris zu ziehen. Boucicault war zufrieden: Sie würden fünfundzwanzigtausend Ritter und Fußsoldaten gegen die ausgeblutete Handvoll Bogenschützen und Ritter und den jungen Taugenichts Henry werfen, den sie nur darum ihren König nannten, weil sein Vater skrupellos Richard II. Tudor umgebracht hatte.
Ein schmutzig aussehendes Soldatenweib riss gerade noch ihr halbnacktes Balg aus dem Weg, bevor die schweren, eisenbeschlagenen Hufe des gewaltigen, dunkelbraunen Brabançonner, den der Marschall ritt, den vom Regen durchweichten Boden zu Matsch schlugen. Hinter einem Wagen der zu den Kriegsleuten von irgendeinem kleinen Seigneur gehörte, der mit Anjou gekommen war, kläffte ein großer, italienischer Kriegshund wütend über den unerwarteten Aufruhr. Boucicault sah, wie der Armbrustschütze, der den wildgewordenen Köter mit einem Nagelhalsband kaum zu bändigen vermochte, dem Tier einen herben Tritt in die Rippen versetzte, damit es sich wieder hinlegte. Irgendjemand schimpfte in einem unverständlichen Dialekt aus den südlicheren Regionen Frankreichs auf das arrogante, prunksüchtige Adelspack, das ihrer aller Untergang sein würde.
II
Der Mann hatte seine Arme um den Knaben gelegt und drückte ihn fest an sich. Leise zischte er zwischen zusammengebissenen Zähnen. „Verfluchter Verräter. Zur Hölle sollst Du fahren und in unendlichen Qualen brennen. Ich verfluche Dich und Dein Blut und das Blut Deines Blutes bis in die siebte Generation.“
Der dem sein Fluch galt, hatte ihn weder gehört, noch bemerkt. Er stand zufrieden an der Seite des breitschultrigen, stiernackigen Richemont, dessen gutaussehendes und von der Sonne tiefbraun gefärbtes Gesicht von unendlich vielen Lachfalten durchzogen war. Er nahm fröhlich am Begrüßungsritual und allgemeinen Schulterklopfen mit den Barbaren teil und deutete mit der Rechten stolz auf die Reiter, die er mitgebracht hatte.
Jean de Craon konnte nicht hören, worüber sein Sohn Amaury so lebhaft mit dem Erben der Bretagne und dem schwarzhaarigen Keltenprinzen diskutierte und es interessierte ihn auch nicht. Alles was Bedeutung hatte, war das der Verräter sich in Rouen befand und mit d’Albret und Boucicault ziehen würde. Die stechenden, grauen Augen des hageren Mannes mit dem dünnen Spitzbart und den glanzlosen, von grauen Strähnen durchzogenen, hellbraunen Haaren verengten sich zu Schlitzen. Leise fluchte er weiter, während er dem Knaben, den er in seinen Armen geborgen hielt, sanft über die dunkelbraunen Locken strich. Die Armee würde sich bald auf den Weg machen.
Der Seigneur von Champtocé, Tiffauges, Craon und Laval hatte seine Männer nicht nur mitgebracht, um Engländer totzuschlagen. Der Hass in seinen Augen verglühte langsam, als er sich ausmalte, wie einfach es in diesem Aufruhr sein würde: Ein scharfes Messer in der Nacht, ein Pfeil irgendwo in einem Wald, ein Schwert im Kampf. Niemand würde sich darüber wundern, wenn der Erbe des de Craon-Vermögens starb. Viele die an diesem Herbstmorgen noch lachten, Witze rissen und mit ihren Waffenkünsten prahlten, würden das Weihnachtsfest nicht erleben. Im Krieg starb man: An Erschöpfung, an Krankheiten, an einer Verletzung. Der Krieg war auch eine wunderbare Gelegenheit, um persönliche Probleme diskret zu beseitigen.
Er hatte es ein paar Mal in Rennes versuchen lassen. Doch am Hof des Montforzh konnten sie einfach nichts ausrichten. Der Bretone war ein misstrauischer Mann, sein Bruder Richemont ein wahrer Wachhund. Niemand näherte sich dem Herzog von Breizh mit einer Waffe in der Hand. Niemand betrat den Palas mit einem Objekt, das zu Töten vermochte. Gift ins Essen zu mischen war genauso unmöglich, denn nicht einmal die geringste Küchenmagd war bereit für ein paar Goldstücke ihre Haut zu riskieren. Montforzh behandelte seine Leute anständig. Aber solange der Verräter Amaury am Leben war, würde Gilles immer nur an zweiter Stelle stehen. Also musste der Schweinehund verschwinden.
Jean de Craon presste die dünnen, blassen Lippen fest zusammen, um nicht vor Zorn und Hass laut aufzuschreien. Amaury. Er verfluchte die Nacht, in der er das Balg gezeugt hatte. Schlechtes Blut. Undankbare Brut.
Richemont hatte den linken Arm um den widerlichen Sohn gelegt, mit dem er gestraft war und der es gewagt hatte ihn vor aller Welt den Teufel von Champtocé zu schimpfen. Die Rechte des Bruders von Yann de Montforzh ruhte auf der Schulter des farbenprächtig herausgeputzten, langhaarigen und mit Goldschmuck behängten Barbaren. Vermutlich einer aus Cornouailles, von der Atlantikküste. Dort verehrten sie heimlich immer noch die alten, verbotenen Götter. Sie beteten zu Bäume oder stehende Steine, heiligten Quellen und zündeten Feuer an, um reiche Ernte zu erwirtschaften. Amaury hatte sich feine Freunde gefunden. Für das heidnische Barbarenpack ließ er seine Familie im Stich. Er würde es schon bald bereuen.
Das Kind in den Armen des bitteren, alten Mannes nahm die Flüche und Gefühlsausbrüche seines Großvaters überhaupt nicht war. Es kannte Amaury de Craon lediglich aus wagen Erzählungen der Leute auf Champtocé. Die wenigen Geschichten über den Bruch mit dem Vater, murmelten sie hinter vorgehaltener Hand, wenn der Herr nicht auf der Festung war oder sich in seinen Gewölben mit seiner Forschungsarbeit beschäftigte.
Gilles’ Augen hingen nicht an Amaury de Craon, dem Objekt des Hasses und des Zorns seines Großvaters, sondern an einem Mann, den er noch nie zuvor im Leben gesehen hatte: Der Knabe beobachtete Aorélian de Douarnenez.
Gilles war ein aufgewecktes Kind. Er war für sein Alter ungewöhnlich groß und kräftig. Niemandem im Feldlager vor Rouen war aufgefallen, dass er erst elf Jahre alt war. In seinem prächtig verzierten Waffenrock und seinem Mantel aus dunkelgrünem Samt, einen Dolch im Gürtel und schwarze Reitstiefel aus feinstem Hirschleder an den Füßen schien er vierzehn oder fünfzehn Jahre alt. Viele der Knappen, die ihre Herren begleiteten, um das erste Mal den Krieg aus der Nähe kennen zu lernen waren in diesem Alter.
Gilles de Laval war ein Waisenkind. Sein Vater, der Baron Guy Laval-Blaison, de Craons Schwiegersohn, war vor ein paar Jahren auf der Jagd von einem Eber angegriffen und so schwer verletzt worden, dass er elend an Wundbrand krepierte. Die Mutter, Marie de Craon, Jeans älteste Tochter, hatte die Geburt ihres zweiten Kindes nicht überlebt. Seit dieser Tragödie lebte Gilles bei seinem Großvater. Er hatte seine Eltern so wenig gekannt, dass der Verlust ihm nie bewusst geworden war. Und obwohl er von väterlicher Seite her einer der reichsten Erben Frankreichs und einer der bedeutendsten Baronien des bretonischen Herzogtums war, war seine ganze Welt doch Jean de Craon. Er liebte den Großvater abgöttisch. Die wagen Erinnerungen an die harte, strafende Hand des Vaters waren an dem Tag verblasst, an dem de Craon ihn aus der Festung von Machécoul nach Champtocé an die Ufer der Loire geholt hatte. Er hatte nie wieder an seine Zeit bei den Eltern zurückgedacht. Und mit dem Vermögen, das Jean ihm vermachen wollte, würde er eines Tages der reichste Mann von ganz Europa sein.
Während de Craon weiterhin seinen ältesten Sohn an der Seite des Bretonen Richemont fixierte und dabei leise Flüche murmelte, kniff Gilles die Augen zusammen. Er wollte besser erkennen können, was seine Aufmerksamkeit bereits im ersten Moment auf den jungen, unbekannten Mann mit der farbenprächtigen Kleidung, dem wunderschönen, schwarzen Kriegspferd und den langen, offenen Haaren gelenkt hatte. Als er Richemont umarmte, war der weite Ärmel an seiner Rechten nach oben gerutscht und die Sonne hatte sich in einer seltsamen, silbernen Armspange gebrochen.
Gilles hatte nicht geglaubt, dass ein solches Objekt wirklich existierte. Er hatte einmal in einer der vielen sonderbaren Handschriften des Großvaters darüber gelesen und angenommen es wäre nur eine Legende. Doch die beiden Totenköpfe und der quadratisch geschliffene Blutstein waren unverkennbar. Natürlich konnte er aus der Ferne die Sigillen selbst nicht entziffern. Der Unbekannte trug ein uraltes und mächtiges, magisches Amulett am rechten Handgelenk, so mächtig und selten, dass sich selbst in der reichen Sammlung von Jean de Craon kein Ähnliches fand.
In der Handschrift war genau erklärt worden, wie man mit Hilfe eines Sigillenreifs, im Verlauf einer Beschwörung, einen aufgebrachten Geist oder sogar einen Dämon beherrschte, der sich gegen den Beschwörer auflehnen wollte. Der Knabe legte seine Hand über die Hand des Großvaters. „Seht Ihr den mit dem leuchtendgrünen Waffenrock und den schwarzen Haaren“, unterbrach er die Gefühlsausbrüche des alten Mannes. Deutlich konnte er spüren, wie de Craon in seinem Zorn stoßweise atmete.
„Ein dreckiger Barbar, Gilles. Ein gefährlicher Häretiker. Einer der sich noch in seinem Schweinestall zur Nachtruhe legt und seine ungewaschenen Mägde unter den Sonnwendfeuern mit einem Hirschgeweih auf dem Kopf schwängert, um seinen heidnischen Götzen zu gefallen“, de Craon zog verächtlich die Augenbrauen hoch.
Champtocé lag am linken Ufer der Loire, unweit der Bischofsstadt Nantes. Kaum einen Tagesritt von seinem Stammsitz entfernt eröffnete ein undurchdringliches und von Wölfen verseuchtes Waldland den Weg hinein in das kleine Herzogtum Cornouailles. In den achtundfünfzig langen Jahren seines Lebens war er noch niemals über diese unsichtbare Grenze geritten und er würde es gewiss auch niemals tun.
Cornouailles gehörte den alten Göttern. Man munkelte hinter vorgehaltener Hand, dass es am Hof zu Concarneau noch immer weißgewandete, tätowierte Götzendiener gab, die bei allen Unternehmungen und politischen Entscheidungen das letzte Wort hatten. Der Herzog Ambrosius Arzhur Emrys war ein gefährlicher Ketzer. Er war mit einer teuflischen Hexe aus dem barbarischsten Landstrich der englischen Insel verheiratet, Wales. Es hieß, in den Adern der Hexe floss das Blut des legendären Pendragon Eudaf Hen, Urahn von König Arthur.
Man munkelte, die Hexe aus Wales könne Blitz und Donner beschwören und mit einem einzigen Blick töten. Ambrosius Arzhur Emrys selbst, der Barbarenfürst, der sich rühmte ein direkter Nachfahr von König Conan Meriadec zu sein, besiegte seine Feinde scheinbar, indem er Armeen schrecklicher, schwarzer Spektren auf sie hetzte. Alles Ammenmärchen!
Niemand beherrschte die Elemente und die heidnischen Götzendiener waren auch nur aus Fleisch und Blut. Im verfluchten Zauberwald von Paimpont, den man auch Brécheliant nannte und der auf der anderen Seite seiner Ländereien, in der Nähe von Laval und Craon lag, standen ständig Hunderte bis an die Zähne bewaffneter, dunkelhäutiger und tätowierter Langhaariger. Es waren Kriegsknechte des Herzogs von Cornouailles, die die Götzendiener beschützten, die im Wald lebten, weil sie selbst offenbar nicht fähig waren mit ihren sogenannten mächtigen Zaubern anderen den Zutritt in ihr finsteres Reich zu verweigern.
„Seht doch, was der Mann an seinem Arm trägt, Großvater“, wiegelte Gilles der Geschimpfe des Alten ab, „darüber haben wir zusammen einmal in der großen Handschrift gelesen, die Ihr aus Tours mitgebracht habt. Da stand, es würde mit Hilfe der magischen Schriftzeichen die es trägt, Geister und Dämonen bannen oder auch beherrschen.“
De Craon kniff seine Augen zusammen und betrachtete die Armspange des Erben von Cornouailles genauer. Der Blutstein leuchtete und funkelte in der Morgensonne. Er lag eingebettet in einem gleichschenkligen, spitz zulaufenden Kreuz, einem sogenannten Al-Tar-Kitar, dem Zeichen, das die israelitischen Hexer anstelle eines Pentagramms verwendeten. Sie nannten es den Urlaut und sein Schutz übertraf ihrer Meinung nach bei Weitem den Schutz, den das gewöhnliche Pentagramm gewähren konnte. Und die Sigillen auf dem Reif waren keine einfachen lateinischen Schriftzeichen. Soviel konnte de Craon erkennen.
„ Das müssen die berüchtigten, magischen Zeichen der Heiden sein“, sagte er leise mehr zu sich selbst, als zu Gilles, der von seiner sonderbaren Entdeckung begeistert war. Mit einem Schlag besserte sich auch die Laune des alten Mannes und er verdrängte die Gedanken an seinen unwürdigen Sohn Amaury.
Gilles reckte den Hals, um besser sehen zu können: Sein Großvater hatte ihn von klein auf mit hinunter in die Gewölbe der Festung genommen, wo sich ein alchimistisches Laboratorium verbarg. Er hatte ihm alle Manuskripte gezeigt, die er im Laufe eines langen Lebens angehäuft hatte und viele wundersame magische Amulette und Zaubergerät. Und er hatte ihn sogar gelehrt, wie man mit denen im Jenseits in Kontakt treten konnte, um den Geistern der Toten Informationen zu entlocken, die einen persönlichen Vorteil brachten: Ein paar Mal schon hatten sie sich so geschickt angestellt, dass eines der Schattenwesen preisgab, wo es noch zu Lebzeiten wertvolle Dinge verborgen hatte.
„Wenn wir uns nicht irren, Gilles und die Sigillen auf dem Reif wirklich magische Zeichen der Heiden sind, dann kann man mit diesem Amulett Rituale von großer Macht und Kraft vollziehen, Rituale aus ihrer alten Magie. Insbesondere für unsere Arbeiten in der hermetischen Kunst wäre es von außergewöhnlichem Wert, wenn wir ein solches Objekt besäßen“, de Craon hatte die Armspange inzwischen gründlich betrachtet. Die Rechte ihres Besitzers lag entspannt auf der Schulter des Erben der Bretagne und beide Männer sprachen miteinander, während ihre Waffenleute bereits anfingen, das Lager aufzuschlagen oder sich um die Pferde zu kümmern.
Amaury war aus dem Blickfeld des alten Mannes verschwunden –zusammen mit den Reitern, die er ihm damals von Champtocé gestohlen hatte. Sein abtrünniger Sohn hatte die Frechheit besessen den Kriegsknechten einzureden, dass sie einem Hexer, Nekromanten und Teufelsanbeter dienten und ihnen die Feuer der Hölle gewiss wären, wenn sie weiterhin in seinen Diensten blieben.
De Craon schüttelte fast ungläubig den Kopf. Bei der Armspange des Barbaren handelte sich eindeutig um ein ungewöhnlich mächtiges und sehr altes magisches Amulett. Vielleicht sogar ein einzigartiges Amulett.
„Der wird uns den Reif gewiss nicht verkaufen wollen, Großvater.“
„Junge, wir leben in einer gefährlichen Zeit“, antwortete de Craon. Endlich gelang es ihm seine Augen von der Szene abzuwenden, die sich unweit von ihm abspielte, „und selbst ein Ritter oder ein bis an die Zähne bewaffneter, dreckiger Barbar sind heute ihres Lebens und Gutes nicht mehr sicher...“
„Und der Zug gegen die Engländer wird sich bald in Bewegung setzten“, der Knabe grinste. Er hatte den Hinweis genau verstanden. Sein Großvater erklärte ihm immer, das man sich nehmen musste, was man haben wollte, weil die gebratenen Tauben keinem in den Mund flogen.
Sein Großvater nahm sich auch immer was er wollte. Und aus diesem Grund fürchteten ihn viele, während andere ihm lieber aus dem Weg gingen, um de Craons Aufmerksamkeit nicht auf sich zu lenken. Doch der Großvater wusste trotzdem Bescheid. Auch die, die sich versteckten durchschaute er gründlich und dann mussten sie eben für ihren Widerstand bezahlen. Sie hatten viele Waffenleute auf Champtocé. Der Großvater ließ ihnen immer ihr Vergnügen und darum konnte man auf die Soldaten zählen. De Craon hielt sich auch nicht mit irgendwelchen Gefühlsduseleien auf. Ob einer um Gnade winselte und flehte, oder sich in sein Schicksal ergab, war gleichgültig, weil sich die Laval-Craon-Montmorency am Ende immer nahmen, was sie haben wollten.
„Beobachte den Barbaren, Gilles. Wir haben Wochen vor uns. Merke Dir genau, was Du in Erfahrung bringen kannst. Erzähle mir alles. Wir werden schon Mittel und Wege finden, ihm sein hübsches Amulett wegzunehmen“, de Craon drückte das Kind fest an sich und küsste es liebevoll auf die Stirn. Der Knabe erwiderte die Umarmung des alten Mannes und strahlte ihn an. Er liebte seinen Großvater mehr als je zuvor. Er hatte ihm nicht nur erlaubt in den Krieg mitzukommen und zuzusehen, wie sie die Engländer totschlugen. Er vertraute ihm sogar eine wichtige Aufgabe an, die eines Mannes würdig war. Er –Gilles- hatte das Amulett entdeckt und sein Großvater würde alles tun, um ihn dabei helfen, das Objekt seiner Begierde zu bekommen.
III
Im Spätherbst war der Hof von Concarneau nach der kleinen Festung Rusquec gezogen; der Wald in der Umgebung, der Uhel Koad südlich von Morlaix - Eichen, Hainbuchen, ein paar Kiefern im Wechsel mit hellen Laubbäumen, ein sagenumwobenes Chaos riesiger Steine – war nicht nur ein gutes Revier für die Jagd auf Wild und Vögel. Er war auch die Quelle des sagenhaften Reichtums der Herren von Cornouailles.
Vor mehr als eintausend Jahren hatte der Marzhin selbst dem Hochkönigs der Volcae gezeigt, wie er nur dem Silberfluss bis zum Ty ar Boudiket folgen musste. Der Rhiotomas Rigadaf ap Deroch, Ambrosius Arzhurs Vorfahr, hatte dort unter der riesigen Steinplatte, die der Eingang zu einer Silbermine war mit den Korred gerungen. Erst als er sie alle besiegt, gefesselt und gebunden hatte, erzählten sie ihm endlich ihr Geheimnis. Der Preis für ihre Freiheit waren nicht nur die Mine und das Silber gewesen: Die Korred hatten für Rhiotomas den Quinotaur geschmiedet, der sagenhafte Schild der brythonischen Hochkönige. Er zierte immer noch den großen Saal der Festung von Concarneau und beschützte seinen Träger im Kampf vor Verrat und verräterischen Tod.
Aodrén Jaouen Kréc’h Elis zog seinen neuen, dunkelgrünen Tasselmantel, der innen ganz mit feinstem Maulwurfpelz gefüttert, enger um die dünnen Schultern. Sogar zwischen den schützenden Bäumen des Uhel Koad spürte man schon den eisigen Wind, der den Winter ankündigte. Der schöne Mantel, die feinen Unterkleider aus heller Wolle...Geschenke der Herzogin Maeliennyd Glyn Dwyr: Den Saum und den Kragen des Mantels hatte sie zusammen mit ihren Frauen selbst bestickt. Sie sorgte sich, wie alle Jahre wieder, bei Einbruch des Winters um Aodrén. Er war ein alter Mann, so alt, das niemand mehr sich daran erinnern konnte, wann er wirklich geboren worden war. Selbst er hatte es vergessen. Nur an den Ort erinnerte er sich noch; Molène, eine kleine Insel vor der Küste der Aodoù-an-Arvor. Ein sturmgepeitschter, karger Felsen mitten in der See. Sein Vater war ein einfacher Fischer gewesen. Als die Weiße Brüder gekommen waren, um ihm mitzuteilen, das Aodrén ausgewählt worden war, um im Heiligen Wald von Brécheliant zu studieren, hatte der Vater aus Dankbarkeit den Göttern die einzige Ziege geopfert, die er besaß.
Aodrén hatte seinen Vater niemals wieder gesehen, aber in seinem Herzen hatte er immer gespürte, das der Fischer stolz auf ihn war. Der alte Mann ließ die Gedanken an seine ferne Heimat los und trieb den cremefarbenen Zelter voran, durch die einzige Furt des Silberflusses unterhalb des Zitterfelsen.
Neben ihm ritt ein Knabe, dem das Herbstwetter überhaupt nichts auszumachen schien. Auf seinen Wangen leuchtete ein gesundes Rot, seine kohlrabenschwarzen Augen blitzten und sein hüftlanges, im Nacken mit einem Band zusammengehaltenes gewelltes, schwarzes Haar flatterte, wie eine Kriegsfahne im Wind. Sein Mantel war im Gegensatz zu dem von Aodrén zusammen mit seinem pelzgefütterten Garde-Corps hinter dem Sattel des schneeweißen irischen Ponys festgezurrt, das er ritt. Und obwohl man aufgrund des schön gestickten Wappens auf dem Rücken seiner Surcotte aus hellgrünem Samt und dem aufwendig gearbeiteten, knielangen Gürtel, dessen silberne und edelsteinbesetzte Beschläge das Wappen wiederholten leicht ersehen konnte, das hier der Sohn eines Adeligen von Rang und Einfluss ritt, trug sein Hengstlein aus Connemara doch vorne, links und rechts über dem Widerrist jeweils einen aus Weide geflochtenen Korb, so wie man sie üblicherweise bei den Eseln oder Maultieren der Händler vorfand. Beide Körbe waren sorgfältig mit Tüchern zugedeckt.
Das Wetter im Spätherbst war ideal für das Kräutersammeln und sie durchstreiften den Wald bereits seit Sonnenaufgang. Aus dem Weidekorb roch es stark nach Portulak: Wenn man ihn zu Tee aufkochte, senkte der Sud Fieber. Sie hatten Zitronenkraut gefunden, Dill, der im Winter gegen Beschwerden beim Harnlassen wichtig war und Wacholderbeeren, die gekocht wurden, um verstopfte Nasengänge freizumachen.
„ Aodrén, erzähl mir doch noch eine Geschichte“, bat der Knabe, nachdem sie auf der anderen Seite des Flusses angekommen, gemütlich zwischen den Bäumen nebeneinander her ritten. Er wäre mit seinem kleinen Schimmel Finn zwar lieber im gestreckten Galopp nach Hause gestürmt, doch Sévran de Carnac, der jüngste Sohn des Herzogs von Cornouailles wusste, dass sein alter Mann nicht mehr so schnell reiten mochte, obwohl der Zelter ein braves Tier war, das keine Bocksprünge versuchte. Darum war es das Besten, aus der Not eine Tugend zu machen und sich die Zeit so angenehm, wie möglich zu vertreiben. Sévran liebte es, Geschichten zu hören.
Der alte Mann strich sich nachdenklich mit der Hand über den steingrauen Bart, der ihm bis hinunter zum Gürtel reichte. Seine haselnussbraunen Augen lächelten, als er den Jungen neben sich betrachtetet: Sévran war gerade einmal zwölf Jahre alt und trotzdem benahm er sich schon beinahe, wie ein erwachsener Mann. Er wollte wissen und lernen, anstatt wie andere Kinder ihre Zeit mit Unsinn und unnötigen Spielereien zu vergeuden. Im Vergleich zu seinem Vater Ambrosius Arzhur, war der Knabe ein Geschenk der Götter. Ambrosius hatte als Kind nie still sitzen wollen, um den Weisen zuzuhören. Mit einem Auge war er immer im Hof der Festung von Concarneau gewesen, wo die Waffenleute übten. Trotzdem hatten Aodrén ihn am Ende doch alles gelehrt, was er ihn lehren konnten und Ambrosius war eines Tages bereit gewesen, in den Heiligen Wald zu gehen und dort den Nebelschleier über Bar’ch Hé Lan zu heben. Dann hatte er während vieler Jahre weite Reisen in fremde Länder unternommen, um seinen Wissensdurst genauso zu stillen, wie seine militärischen und politischen Ambitionen. Ambrosius war erst mit der Zeit weise geworden, so weise dass die Versammlung der Weiße Brüder ihn vor wenigen Jahren im Wald von Carnöet, im Heiligen Hain am Ufer der Laïta, sogar zum Drouiz Meur, zum Erzdruiden gewählt hatte.
Doch Ambrosius‘ jüngster Sohn war bereits weise auf diese Welt gekommen: Die Herzogin von Cornouailles hatte Sévran in der Nacht von Bealltainn das Leben geschenkt. Es war eine außergewöhnlich schwierige Geburt gewesen. Maeliennyd Glyn Dwyr hätte in diesem Alter einfach kein Kind mehr austragen dürfen, doch sie hatte sich trotz der Gefahr für ihr Leben, die eine solch späte Schwangerschaft darstellte standhaft geweigert den Trank einzunehmen, den er für sie zubereitet hatte, um die Frucht im Mutterleib zu töten. Sie musste damals bereits gespürt haben, dass dieses letzte Kind etwas ganz Besonderes sein würde.
Sévran hatte nicht geatmet, als er etwa zwei Monate vor seiner Zeit auf die Welt gekommen war.
Aodrén lächelte leise in sich hinein; wenn Ambrosius damals nicht das Gemach seiner Herzogin verlassen hätte, um die Bealltainn-Feuer im Heiligen Hain zu entzünden, wie die Tradition es ihm vorschrieb, dann hätte der Knabe möglicherweise niemals einen ersten Atemzug getan und einen ersten Schrei ausgestoßen. Der Herzog von Cornouailles hätte niemals sehenden Auges zugelassen, was Maeliennyd Glendower -verzweifelt und vollkommen erschöpft von der schweren Geburt und dem Blutverlust - in dieser Nacht von ihm verlangt hatte…nicht einmal um den Preis des Lebens seines jüngsten Sohnes…
Zärtlich und stolz betrachtete der alte Mann das Kind an seiner Seite: Er bereute nichts von dem, was er damals getan hatte und er hatte der weißen Dame von Concarneau ihre verletzenden Worte schon lange verziehen. Sévran war in Aodréns Augen die Umsetzung des göttlichen Planes bis ins letzte Detail und bis hin zur Selbstaufgabe. Tot geboren hatte er das Tor der Anderswelt hinter sich gelassen und war hinübergefahren bis zum Hafen der Untergehenden Sonne – en aod pa vez aet an heol da guzh. Er hatte die Insel gesehen, Inis Gwenva, die weiße Welt, das Reich der Kinder des Lichtes …
Erst als mit dem Beginn der Sommerzeit und den lodernden Bealltainn-Feuern alles durch die Hand der Drouiz wieder zu neuem Leben erweckt worden war, war auch Sévran von seiner Reise in die andere Welt zurückgekehrt. Aodrén wusste genau, dass in diesem Augenblick auch etwas von dem Licht und von den Zaubern von Inis Gwenva mit dem Kind nach Tir na m-Béa, in ihre Welt zurückgekehrt war…etwas, das noch tief in ihm verborgen schlummerte, denn er war jung und unerfahren. Doch eines Tages, wenn die Zeit reif war, dann würde Sévran verstehen. Es war eine Kraft, die nicht erlernt, sondern nur erinnert, geweckt werden konnte. Aodrén trieb seinen Zelter dichter neben den kleinen weißen Hengst und legte dem Knaben liebevoll die Hand auf die Schulter: „Du möchtest also noch eine Geschichte hören? Gut! Aber dreh Dich zuerst einmal um und beschreibe mir genau, was Du am Ufer des Silberflusses siehst.“
Der jüngste Sohn des Herzogs von Cornouailles grinste, zügelte sein Pferdchen und tat, was Aodrén ihm aufgetragen hatte. Er kannte das Spiel seines alten Mannes. Immer, wenn er irgendetwas wissen wollte, musste er Aodrén zuerst etwas von seinem eigenen Wissen preisgeben. Sie waren im Argoat, in der Ferne erhoben sich die Monts Arée durch die Nebel des Herbsttages. Yenn Elez, das Höllenmoor lag dort hinten, unweit des Eingangs zur alten Silbermine von Rhiotomas: „Nun, wer bereit ist, sich die Füße schmutzig zu machen, der kann durch das Schilf, die Uferböschung hinuntersteigen und in das Meer aus Felsen eintauchen, Aodrén“, erwiderte er übermütig, „aber danach ist mir heute wirklich nicht. Ich möchte lieber mit sauberen Stiefeln nachhause kommen.“
„ Das muss sich das kleine Tierchen damals wohl auch gesagt haben“, begann der alte Mann vergnügt seine Geschichte. Der cremefarbene Zelter fiel aus dem Schritt in einen weichen Passgang, Sévrans Schimmelchen trabte locker neben dem größeren Tier her. Das Kind war von der Erzählung seines Lehrers so gefesselt, das es nicht einmal mehr auf den Weg achtete, den sie einschlugen.
„Vor langer, langer Zeit einmal ritt der Hochkönig Conan Meriadec durch diesen Wald“, erzählte Aodrén, „und genau an dieser Stelle hier zügelte er sein Pferd, denn irgendetwas bewegte sich im Schilf des schlammigen Flussufers...“
Es war natürlich ein kleines, schneeweißes Hermelin: Conan, neugierig geworden, hielt sein Pferd zurück und beobachtete es Das kleine Tier mit dem schneeweißen Pelz ging vorwärts, dann schreckte es zurück, und versuchte erneut, den schwärzlichen Schlamm auf einem viel zu schwachen Ast zu überqueren. Es schien wirklich verwirrt beim Anblick dieses Morasts. „„Warum ist dieses anmutige Tier so ängstlich? Und warum flüchtet es nicht so schnell wie möglich vor uns? Ist es vielleicht verletzt“, fragte Conan den Waffenträger, der ihn begleitete.
„Herr, das Hermelin ist nicht verwundet, aber es will ohne Flecken bleiben. Es fürchtet, sein makelloses Kleid beim Überqueren des Flusses zu beschmutzen.“
Herr , das Hermelin ist nicht verwundet, aber es will ohne Flecken bleiben. Es fürchtet, sein makelloses Kleid beim Überqueren des Baches zu beschmutzen.“O Wunder der Reinheit“, rief Meriadec aus,O Wunder der Reinheit! rief Mériadec aus. „die Ehre gebietet es, dass König Conan das Hermelin rettet und beschützt.“
Die Ehre gebietet es, daß König Conan es schützt und rettet. Als ob das Hermelin das Gespräch der beiden Männer verstanden und die Güte von Conan vorausgeahnt hätte, lief es schnurstracks auf die Hand, die der König ihm entgegenstreckte, und suchte Zuflucht in den Falten des königlichen Mantels, der reich mit Hermelinpelzen geschmückt war.
Als ob das Hermelin das Gespräch der beiden Männer verstanden und die Güte von Conan vorausgeahnt hätte, lief es auf die Hand, die der König ihm entgegenstreckte, und suchte Zuflucht in den Falten des königlichen Mantels, der reich mit Hermelinpelzen geschmückt war.Conan sagte spöttisch zu ihm: „Also ziehst Du es vor zu sterben, anstatt Deinen Pelz zu retten, indem Du ihn schmutzig machst und wegläufst? Lieber der Tod, als die Schande? Dies sei fortan unsere Devise und Du, das Hermelin, sollst dafür das lebende Symbol sein“, fügte der König hinzu, während er das Tierchen auf seinen Schild hob und es über den Silberfluss ans andere Ufer trug.
Conan sagte spöttisch zu ihm: Also ziehst Du es vor zu sterben als Dich zu beschmutzen? Lieber der Tod als ein Makel? Dies sei fortan unsere Devise; und Du, das Hermelin, wirst dafür das lebende Symbol sein! fügte König Conan hinzu während er es auf sein Schild hob.ñ”Kentoc'h mervel eget en em saotrañ - Eine gute Devise, Aodrén: Lieber der Tod, als die Schande!“ Sévran de Carnac lächelte seinen alten Mann zufrieden an. ,Melius mori, quam feodari! Eine gute Devise, Aodren. Lieber der Tod, als ein Makel!í Sévran de Carnac lächelte seinen alten Mann zufrieden an. Die Geschichte von König Conan hatte ihm gefallen. Er wollte gerade sein Schimmelchen aus dem Trab zu einem leichten Galopp antreiben, um endlich zurück nach Hause zu reiten, denn inzwischen spürte auch sein junger Körper den Wind und die Kälte und die Müdigkeit des langen Tages. Doch Aodrén hielt ihn zurück und brachte seinen Zelter ganz zum Stehen.
Die Geschichte hatte ihm gefallen. Er wollte gerade sein Schimmelchen aus dem Trab zu einem leichten Galopp antreiben, um endlich zurück nach Hause zu reiten. Inzwischen spürte auch sein junger Körper den Wind und die Kälte und die Müdigkeit des langen Tages. Doch Aodren hielt ihn zurück und brachte seinen Zelter ganz zum Stehen.“Und nur weil ich Dir eine uralte Legende von einem schlauen Hermelin erzähle, der sich den weißen Pelz nicht schmutzig machen will, denkst Du, Du kämst heute genau so leicht davon, junger Mann?“ Die braunen Augen des Drouiz blitzten fröhlich. Sein spindeldürrer Finger deutete zurück auf den Silberfluss, auf die Uferböschung und auf eine unscheinbare Ansammlung welker, gelblich verfärbter, spitz zulaufender und sehr schmaler Blätter, die sich vom dunkelbraunen Schlamm abhoben. Die Furt über den Fluss lag schon weit hinter ihnen.
,Und nur weil ich Dir eine uralte Geschichte von einem Hermelin erzähle der sich den weißen Pelz nicht schmutzig machen will, denkst Du Du kämst heute genau so leicht davon, junger Mann!í Die Augen des Druiden blitzten fröhlich. Sein spindeldürrer Finger deutete zurück auf den Silberfluss. auf die Uferböschung und eine Ansammlung welker, gelblich verfärbter, spitz zulaufender und sehr schmaler Blätter, die sich deutlich vom dunkelbraunen Schlamm abhoben. Die Furt lag weit hinter ihnen.“Schwertlilien“, seufzte das Kind. Sie hatten den ganzen langen Tag nach Schwertlilien Ausschau gehalten und keine gefunden und genau in dem Augenblick in dem er sich nur noch nach einem warmen Feuer, trockenen Kleidern und einer großen Schüssel heißer Suppe sehnte, hatte sein alter Mann an der unmöglichsten Stelle im ganzen Uhel Koad die markanten Blätter der Pflanze entdeckt.
,Schwertlilien,í seufzte das Kind; Sie hatten den ganzen langen Tag nach Schwertlilien Ausschau gehalten und keine gefunden und genau in dem Augenblick in dem er sich nur noch nach einem warmen Feuer, trockenen Kleidern und einer großen Schüssel heißer Suppe sehnte hatte sein alter Mann an der unmöglichsten Stelle im ganzen Wald von Uhel Koad die markanten Blätter der Pflanze entdeckt.“Da wird Dir wohl nicht viel übrig bleiben…“, murmelte der Drouiz, während er ein kurzes Messer mit breiter Klinge aus dem Gürtel zog und es Sévran hinstreckte.
,Da wird Dir wohl nicht viel übrig bleiben, Kind!í Murmelte der Druide, während er ein kurzes Messer mit breiter Klinge aus dem Gürtel zog und es Sévran hinstreckte.Der Knabe nahm das Messer aus der Hand seines Lehrers entgegen und wollte gerade sein Pferd wenden, als der alte Mann ihm mit einer unerwartet schnellen Handbewegung in die Zügel griff. Der Knabe nahm das Messer aus Aodrenís Hand entgegen und wollte gerade sein Pferd wenden, als der alte Mann ihm mit einer unerwartet schnellen Handbewegung in die Zügel griff.“Das kurze Stück kannst Du doch sicher auch laufen, Sévran. Ich bleib hier stehen und ruhe mich ein bisschen aus und damit mein Pferd sich nicht so einsam fühlt, werde ich Dein Pony festhalten.“ Die Lachfalten um Aodréns Augen wurden tiefer. Sein schmaler Mund, der hinter seinem langen, steingrauen Bart gut versteckt lag, verzog sich listig und schlau.
,Das kurze Stück kannst Du auch laufen, Sévran. Ich bleib hier stehen und damit mein Pferd sich nicht so einsam fühlt, werde ich Dein Pony festhalten.í Die Lachfalten um Aodrenís Augen wurden tiefer; sein schmaler Mund, der hinter seinem langen, steingrauen Bart gut versteckt lag verzog sich hinterlistig und schlau.Der jüngste Sohn des Herzogs von Cornouailles seufzte leise und stieg gehorsam aus dem Sattel des Schimmelchens. Sein alter Mann sollte sich nicht mehr so sehr anstrengen. Seine Mutter sagte immer, das Aodrén schon fast einhundert Jahre alt sei und sie es nur der Gunst der Götter verdankten, dass er noch bei ihnen war. Der jüngste Sohn des Herzogs von Cornouailles seufzte leise und stieg gehorsam aus dem Sattel des Schimmels. Sein alter Mann sollte sich nicht mehr so sehr anstrengen! Seine Mutter sagte immer, das Aodren schon fast einhundert Jahre alt sei und das sie es nur der Gunst der Götter verdankten, das er noch bei ihnen war. Er steckte das Messer in den Gürtel und schürzte Cotte und Surcotte. Der Uhel Koad war voller Wurzeln und Stolperfallen. Er würde über die großen, glitschigen Felsen klettern müssen und dann durch das eiskalte Wasser waten, um bis zu den Schwertlilien zu gelangen. Den sauberen Reitstiefeln konnte er wohl „Adieu“ sagen.
Er steckte das Messer in den Gürtel und schürzte Cotte und Surcot. Der Wald von Uhel Koad war voller Wurzeln und Stolperfallen. Er würde über die großen, glitschigen Felsen klettern müssen und dann durch das eiskalte Wasser waten, um bis zu den Schwertlilien zu gelangen.Aodrén beobachtete Sévran noch einen kurzen Augenblick, bevor er seinem Zelter die Fersen kräftig in die Flanken stieß. Er war zwar alt, aber nicht im Geringsten gebrechlich oder schwach: Das Tier sprang aus dem Stand in den Galopp, der kleine Schimmel folgte willig. Ohne sich umzudrehen oder auf den jungen Carnac zu achten schlug der Drouiz den Weg nach Rusquec ein. Die beiden Pferde waren frisch und ausgeruht; sie hatten den ganzen Tag vertrödelt, während er und das Kind Kräuter gesammelt hatten. Ein scharfer Galopp würde ihnen nicht viel ausmachen. Damit war Aodrén sicher, vor Einbruch der Nacht zurück auf der Festung zu sein, wo er seine müden Knochen bequem vor einem warmen Feuer ausstrecken konnte. Aodren beobachtete Sévran noch einen kurzen Augenblick, bevor er seinem Zelter die Fersen kräftig in die Flanken stieß. Er war zwar alt, aber nicht im Geringsten gebrechlich oder schwach: Das Tier sprang aus dem Stand in den Galopp; der kleine Schimmel folgte willig. Ohne sich umzudrehen oder auf den jungen Carnac zu achten schlug der Druide den Weg nach Rusquec ein. Die beiden Pferde waren frisch und ausgeruht; sie hatten den ganzen Tag vertrödelt, während er und das Kind Kräuter gesammelt hatten__•Sévran hatte den Dolch, die Weisheit seiner zwölf Sommer und ein paar gesunder, kräftiger Beine. Es war an der Zeit ihn endlich auf die schweren Prüfungen vorzubereiten, die ihn schon bald im Heiligen Wald von Brocéliande, im Kreis der weißen Bruderschaft erwarten würden.