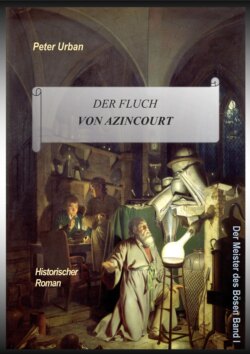Читать книгу Der Fluch von Azincourt Gesamtausgabe - Peter Urban - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 4 Das Geheimnis von Saint Jacques
ОглавлениеI
Ambrosius Arzhur erhob sich aus dem bequemen Lehnstuhl direkt neben dem gekachelten Kamin. Er hatte ihn erst im letzten Sommer für Maeliennyd und ihre Frauen in der Kemenate des Palas von Carnöet errichten lassen. Die Festung war so alt, das niemand mehr sagen konnte, wer wirklich ihren Grundstein gelegt hatte. Und obwohl sie hier gerne die warme Jahreszeit verbrachten, musste man gegenüber dem Komfort und der Wohnlichkeit seines Palas in der Ville Close von Concarneau doch große Abstriche machen. Er betrachtete den geschlossenen Kamin noch einmal zufrieden. Eine eindeutige Verbesserung, nicht nur in der Lebensqualität seiner Gemahlin. Auch er kam gerne in das große, heimelig warme Zimmer, um sich auszuruhen oder um sich bei einem Schachspiel zu entspannen.
Der Herzog ging zu einer Silberschale mit Süßigkeiten und Nüssen, die auf einer geschnitzten Holztruhe zwischen zwei kostbaren Vasen aus Glas stand. Die ersten Frühlingsblumen zierten bereits die Gemächer von Maeliennyd und verströmten angenehmen Duft, der den üblen Geruch der Öllampen wohltuend überdeckte. Ambrosius nahm ein kandiertes Veilchen und betrachtete es gedankenverloren, bevor er es in den Mund schob: „ Der Brief aus Paris ist wirklich interessant gewesen, meine Liebe.“
Maeliennyd nickte, faltete das Pergament wieder sorgfältig und legte es in ein Fach ihres Comptoirs zurück: „Der Burgunder hat seine beiden toten Brüder und Azincourt schnell vergessen. Jetzt läuft er dem Lancaster hinterher, wie ein Schoßhund und bietet ihm seine Freundschaft an“, antwortete sie zynisch. Für gewöhnlich war dies nicht ihre Art, doch der Brief aus Paris hatte schmerzhafte Erinnerungen in ihr wachgerufen. So leicht es Jean Sans Peur gefallen war, einen Schlussstrich unter das Debakel vom 25.Oktober 1415 zu ziehen...sie konnte nicht vergessen: Ihr schöner, starker und tapferer Aorélian, von einer Plündererbande ermordet. Glaoda -gutmütig, gelassen und klug- von Henry V. ermordet, dem Sohn des Mannes, der ihre Mutter und ihre Geschwister umgebracht und der ihrem Vater sein Königreich gestohlen hatte.
Obwohl inzwischen drei Jahre vergangen waren, schrie das Herz von Maeliennyd Glyn Dwyr immer noch laut und unerbittlich nach Rache für Azincourt.
Ambrosius Arzhur seufzte, als er in die dunklen Augen seiner Gemahlin blickte, die mit einem Mal so kalt und hart und unergründlich geworden waren. Er verstand sie mit dem Herzen, doch die Notwendigkeiten der Politik forderten von ihm, dass er die Geschehnisse des Jahres 1415 mit Abstand und Zurückhaltung betrachtete.
Auf die Nachricht von der Niederlage bei Azincourt war König Charles VI., der sich bereits seit 1392 und seinem missglückten Feldzug gegen die Bretagne in einem Zustand der geistigen Umnachtung befand, regelrecht dem Wahnsinn verfallen. Obwohl Azincourt erstaunlicherweise die Grundlagen der Beziehung zwischen England und Frankreich nicht verändert hatte, hatte die Schlacht tiefgreifend die Machtverhältnisse innerhalb des Landes beeinflusst. Seit dem Weihnachtsfest, das auf die Katastrophe in der Picardie gefolgt war, führte Bernard d’Armagnac in Paris ein brutales, rücksichtsloses Regime an. Das hässliche Gesicht seiner Eisernen Hand manifestierte sich in der Gewalt, mit der er Zwangsanleihen bei den Handelsherren und Zunftmeistern der reichen, französischen Hauptstadt durchgesetzt hatte, um die leeren Staatskassen wieder aufzufüllen. Die Goldmark von Paris, die unter Charles V. noch sechzig Livres von Tours wert gewesen war, war inzwischen auf über einhundert Livres geklettert.
Während Armagnac in der Hauptstadt seine Raubwirtschaft betrieb, massakrierten sich seine Anhänger und die Anhänger des Burgunder auf der gesamten umliegenden Ile-de-France und in der Champagne. Anstatt nach Azincourt seine Truppen zurück nach Hause zu schicken, hatte Jean Sans Peur sich unweit der Hauptstadt in Lagny häuslich eingerichtet und bedrohte von dort aus seit nunmehr drei Jahren Bernard d’Armagnac und seine Schergen. Armagnac hielt den wahnsinnigen König Charles VI. zusammen mit einem Teil der königlichen Kinder und dem Dauphin Charles de Ponthieu, wie Geiseln, während andere Kinder sich als Faustpfand in der Hand des Herzogs von Burgund befanden. Isabeau de Bavière die Wittelsbacher Königin, saß immer noch in ihrem Exil in Troyes und erklärte jedem, der es hören wollte, dass sie alleine Frankreich regierte. Dabei verheimlichte sie niemandem, das sie am liebsten gemeinsame Sache mit den Burgundern gegen den eigenen Gemahl und ihre Söhne machen wollte. Selbst das starke und unabhängige Anjou zitterte, wie Laub im Wind vor den Grauen des Bürgerkrieges, der immer wieder hart und gnadenlos über die Grenzen der Loire schwappte. Nur die wehrhafte Bretagne und das unzugängliche Cornouailles standen in diesen schweren Tagen noch unbeugsam, wie die beiden letzten Felsen in der Brandung.
Draußen, auf der anderen Seite ihrer Grenzen - im Süden für Cornouailles die Loire und im Norden für Yann de Montforzh die Mayenne - tobte das Grauen. Schlimmer noch: Am 29.Juni 1417 war die französische Flotte vor La Hougue von der englischen Flotte zerstört worden und den schmalen Wasserweg zwischen den beiden Ländern beherrschte jetzt der Thronräuber Lancaster. Es diente seiner Eroberung der normannischen Länder wohl.
Henrys Bruder Bedford befand sich in Caen, dass das Regierungszentrum der Engländer auf dem Kontinent geworden war. Zuvor hatte er die französischen Bürger der Stadt gnadenlos enteignet und vertrieben. Der Hafen von Trouville erlitt das gleiche Schicksal und nur zwei Jahre nach dem Tod des Herzogs von Alençon auf dem Feld von Azincourt hatte die Kriegsknechte von Henry Lancaster sowohl Argentan, als auch den Herzogssitz Alençon unterworfen. Jean, der junge Herzog kämpfte einen erbitterten, aber aussichtslosen Guerillakrieg gegen die Engländer. Rouen wurde von Lancasters Truppen hart belagert. Der Feind stand direkt vor den Toren der Bretagne.
Die einfachen Menschen, die von dem politischen Gewittersturm nach Azincourt und von den finsteren Machenschaften des englischen Königs keine Ahnung hatten, zitterten vor plündernden Waffenleuten und Söldnern ohne dabei einen Unterschied zwischen Lancaster, Bourgogne, Armagnac oder Orleans zu machen.
Anstatt sich ausrauben und totschlagen zu lassen, verließen sie ihre Höfe auf dem Land und flüchteten in die befestigten Städte. Die Verwegenen verschwanden durch den Passais in die Bretagne und bevölkerten heimatlos und abgerissen die Gossen von Rennes und anderen größeren Städten im Herrschaftsgebiet von Yann de Montforzh. Außer dem Bürgerkrieg und der Eroberung der Normandie, die Henry, der seit dem Vertrag von Canterbury vom August 1416 auch noch mit Sigismund von Luxemburg und dem Heiligen Römischen Reich verbündet war vorantrieb, drohten überall Hungersnot und Seuchen. Selbst Cornouailles, fern ab, am Ende der Welt, spürte inzwischen schon die Auswirkungen der Katastrophe und sah abgerissene, halb verhungerte Bettler und Vertriebene in den größeren Hafenstädten an der Küste.
Auch ohne diesen überraschenden Brief aus Paris war Ambrosius über die Lage in Frankreich bestens informiert und er konnte sich ohne Mühe ausrechnen, dass angesichts von Armagnacs Regime und der harten Hand seines Hauptmanns Tanguy du Châtel, die Anhängerschaft für Jean Sans Peur in der französischen Hauptstadt stetig zunahm. Es würde nicht mehr lange dauern und irgendwer würde dem Burgunder ohne Rücksicht auf seine englischen Neigungen die Tore weit öffnen, nur um Armagnac, Tanguy, seinen schwarzen Mörderhaufen und ihre brutale Zwangsherrschaft loszuwerden.
„Sidonius von Concarneau!“ Er hatte in einer energischen Handschrift unterschrieben. Der Brief erweckte auch in Ambrosius zahlreiche schmerzhafte Erinnerungen: Sidonius von Concarneau. Szenec!
Wie alt war Meister Juizigs Sohn jetzt? Siebzehn oder achtzehn Jahre?
Ambrosius knackte mit der Hand eine große Walnuss. Er hatte nie herausgefunden, warum Sévran am Morgen nach der Schreckensnacht vor drei Jahren so energisch darauf bestanden hatte, das sie sich um den Sohn eines einfachen Fischers von Cap Coz und um dessen Weib kümmern mussten. Dieser Juizig war offensichtlich einer von denen gewesen, die zusammen mit Glaoda bei Azincourt umgekommen waren, als Henry anordnete, die Gefangenen totzuschlagen, damit sie ihn auf seinem Marsch nach Calais nicht behindern konnten. Warum ausgerechnet der Sohn dieses Juizig und nicht der Sohn irgendeines anderen Bauern oder Fischers aus Cornouailles, der auch dort oben in der Picardie geblieben war? Es waren mehr als fünfhundert Männer gewesen…
Ambrosius erinnerte sich noch in allen Einzelheiten an den Morgen nach der schrecklichen Vision seines jüngsten Sohnes. Es war ein stürmischer, kalter Herbsttag gewesen. Durchdringende Regenschauer rissen vor den Toren von Rusquec das goldene Laub von den Ästen der Bäume des Uhel Koad und verwandelten sie in schwarze Skelette, ganz so, als ob die Natur in die Trauer der Bewohner der Festung einstimmte.
Sévran war nach einer unruhigen Nacht aus den Gemächern im Turm geschlichen und hatte heimlich und von allen unbemerkt Rusquec verlassen. Stunden später war er bis auf die Knochen durchweicht aus dem Uhel Koad zurückgekehrt und hatte ihm diese sonderbare Bitte bezüglich des Fischerjungen Szenec vorgetragen...mit einer viel zu ruhigen Stimme und Augen, die über Nacht kalt geworden waren, wie Eis. Es waren die Augen eines erwachsenen Mannes gewesen, die ihn damals an diesem Oktobermorgen vor drei Jahren angeblickt hatten.
Ambrosius war noch viel zu sehr in seinem Schmerz und seiner Trauer um den Erben von Cornouailles und seinen zweiten Sohn Glaoda gefangen gewesen, um mit einem erschöpften, bis auf die Knochen durchnässten, halberfrorenen und dickköpfigen Kind zu diskutieren, das die letzte Hoffnung für sein Herzogtum darstellte. Er hatte einfach einen Boten losgeschickt, mit einem Beutel Gold und dem Auftrag, es Juizigs Weib und seinem Sohn schonend beizubringen. Offensichtlich hatten sie sein Gold nicht verschwendet.
„Sidonius von Concarneau!“ Anstatt in die Fußstapfen von Meister Juizig zu treten und Fischer zu werden, war Szenec mit den herzoglichen Goldstücken in ein Benediktinerkloster geschickt worden, während seine eigene Herzogin die verwitwete Mutter des Knaben offensichtlich als Bedienstete in ihren persönlichen Haushalt geholt hatte.
Die Benediktiner und die ihnen verwandten Zisterzienser hatten Ambrosius Arzhur nie gestört. Der irische Mönch Columban war vor fast eintausend Jahren nach Cornouailles und Breizh gekommen. Er hatte damals gesagt: „Christus ist mein Druide“, und der Marzhin selbst hatte ihm die Hand gereicht, denn Columbans Mönche versuchten nicht zu missionieren oder die Menschen gegen die Weiße Brüder aufzubringen. Sie waren einfach da und lebten im Schutz der Steinringe und der Eichenhaine oder als Eremiten, tief in den Wäldern, die sich durch den Passais und das Bocage bis tief in die von den Nordmännern beanspruchte Normandie erstreckten. Sie lebten in Frieden miteinander, sie kannten einander gut und jeder schätzte den anderen für das was er war.
Aus unerfindlichen Gründen waren Sévran und der Sohn des Fischers von der Felsenküste offensichtlich schon immer Freunde gewesen. Sévran war zu Anfang des Sommers, nach der Katastrophe von Azincourt zusammen mit Aodrén in den Heiligen Wald, nach Brocéliande fortgegangen, um den alten Göttern zu dienen. Szenec hatte sich einen neuen Gott gesucht. Es hatte ihrer Freundschaft scheinbar keinen Abbruch getan. Genauso wenig wie der Unterschied in ihrer Geburt und die vielen Jahre, die sie sich nun schon nicht mehr gesehen hatten. Er würde natürlich auch einen Boten zu Sévran schicken, damit dieser die Neuigkeiten von seinem alten Freund Szenec erfuhr.
Szenec. Ein Benediktiner! Und jetzt war er in Paris und studierte an der Sorbonne. Er schrieb, dass er es seinem Herzog schuldig war, das Beste zu versuchen. Und er hatte mit energischer Hand seinen neuen lateinischen Namen auf das Pergament gesetzt: Sidonius von Concarneau. Zu Ehren der herzoglichen Familie von Cornouailles!
„Guethenoc“, rief Ambrosius seinen Truchsess zu sich.
Der kleine, beleibte Mann sprang von der warmen Bank am Kamin hoch, auf der sich gewärmt hatte und lies dabei beinahe den Becher mit Gewürzwein fallen, den er in der Hand hielt. Ambrosius hatte sich im Verlauf vieler Jahre mit dieser Unart seines Verwalters abgefunden. Obwohl es nicht seine Gewohnheit war, die Magistraten wie Dreck zu behandeln, konnte der Truchsess sich einfach nicht angewöhnen seinen Befehlen ruhig und gelassen zu folgen. Er verbeugte sich tief vor dem Herzog: “Mein teurer Herr?“
„Lasse zwei Mönchskutten schneidern. Finde heraus was die Benediktiner für gewöhnlich tragen. Ich glaube, es ist von schwarzer Farbe.“
Der Truchsess verbeugte sich eifrig.
„Sorge auch dafür, dass es vom allerfeinsten Tuch ist, das sie tragen dürfen. Du erinnerst Dich doch noch an den Sohn von Meister Juizig, dem Fischer von Cap-Coz ? Szenec! Die Kutten schick ihm nach Paris an das Collegium Sorbonianum, wo er jetzt studiert...mit einem zuverlässigen Boten. Das versteht sich von selbst, damit er für unseren Bruder Sidonius von Concarneau auch gleich noch ein paar Goldmünzen mitnimmt. Niemand soll behaupten können, das Ambrosius von Cornouailles seine Getreuen nur von Luft und...Theologie leben lässt!“
Guethenoc schmunzelte. Für gewöhnlich lag über seinem fleischigen, bleichen Gesicht ein ernster, geschäftiger Ausdruck, insbesondere dann, wenn er die Mägde und Bediensteten des herzoglichen Haushaltes bei der Arbeit halten musste. Doch in diesem Augenblick freute er sich ehrlich darüber, wie gelassen sein Herr es aufnahm, dass der Sohn von Meister Juizig diesen sonderbaren Weg gewählt hatte, um ihm zu dienen. Ein Mann, der dem neuen Gott huldigte, obwohl er in der alten Religion erzogen worden war. Und trotzdem hatte Szenec nicht vergessen, wem seine wahre Loyalität gehören musste.
Ambrosius bediente sich noch einmal aus der Silberschale: „Aus Sevilla-Orangen gemacht“, bemerkte er anerkennend, als er die Süßigkeit kostete.
II
Es war kein Zufall , das Claire de Saint Germain, ein junger Ritter aus Anjou, sich ausgerechnet Herzog Jean Sans Peur angeschlossen hatte und in dieser warmen Nacht vom 28.Mai auf den 29.Mai 1418 unweit der Porte Saint Germain de Près, vor den Toren der belagerten Hauptstadt auf ein Zeichen des Hauptmannes de Villiers wartete. Er war von den politischen Wirren in Frankreich und den Machtkämpfen zwischen Bourgogne, Armagnac und Orléans völlig unberührt vor einem Jahr nach Troyes gekommen, um dort Nachforschungen über den Schlüssel zu einer Handschrift anzustellen, die einer seiner Vorfahren vom ersten Kreuzzug und vermutlich aus dem Heiligen Land selbst mitgebracht hatte.
Sein Vater, mehr Gelehrter und Alchemist, als Edelmann war irgendwo in der riesigen Bibliothek, die sie auf Mont Saint Marsan hatten über die Handschrift gestolpert und hatte nicht gezögert, sie seinem ältesten Sohn, mehr Adept der hermetischen Kunst, als Kriegsmann zu schicken. Claire weilte damals gerade am Hof ihres Lehnsherren König Louis und dessen Gemahlin Yolande d’Aragón, der Herzogin von Anjou und damit in unmittelbarer Nähe der berühmten Universität von Montpellier. Die Handschrift hatte den jungen Mann so fasziniert, dass er seinen Dienst bei Louis von Sizilien und Neapel aufkündigte. Ein konvertierter Jude, den er zufälligerweise in Bourges traf, hatte ihm erklärt, dass es sich um die Kopie eines der Werke des legendären Rabbi Akiba handelte. Man nannte es die Sepher Yetzirah, das Buch der Schöpfung und die Sprache, in der es geschrieben war, war das Aramäische, so wie Jesus Christus selbst es noch gesprochen hatte.
Doch der Konvertierte war natürlich nicht mehr in der Lage gewesen den Text zu übersetzen und seit den schrecklichen Judenverfolgungen im Anschluss an die Pest des Jahres 1356 machten sich Männer, die das alte Aramäisch lasen oder sprachen im Reich der französischen Könige rar. Der Konvertierte hatte lediglich wage Erinnerungen daran gehabt, dass man dieses geheimnisvolle Werk, wenn man ihrer alten Sprache mächtig war, auch mit einem Code entschlüsseln konnte, der Tetrahedron hieß und den ein Gelehrter namens Isaac von Toledo etwa zur gleichen Zeit erfunden hatte, als der Vorfahr von Claire aus Jerusalem wieder auf den Familiensitz bei Bayonne am Fuß der Pyrenäen zurückgekehrt war.
Claire hatte sich nach vielen Irrwegen und Enttäuschungen irgendwann bis in die Champagne und nach Troyes vorgearbeitet, weil er ein Gerücht hörte, dass sich dort vor etwa dreihundertfünfzig Jahren eine Gruppe von Kabbalisten und Rabbinern unter dem Schutz des Grafen Hughes niedergelassen hatte. Diese Männer, angeführt von einem gewissen Rabbi Rashi, der ein Schüler von Isaac war, hatten die ursprüngliche Sepher Yetsirah vervollkommnet und als Gelehrte in der Wissenschaft der Mathematik um den Bahir erweitert, die Schöpfung aus dem Buch Genesis, die dreifache Transformation der Prima Materiae.
Claire hatte in Troyes zwar weder den geheimnisvollen Tetrahedron aufgespürt, noch das Geheimnis seiner Abschrift des Sepher Yetsirah ergründet, doch er hatte dort einen Mann kennen gelernt, der wusste wo sich unter Umständen ein einfacherer alchimistischer Text befand, der die Anleitung für die Erschaffung des Lapis Philosophorum, des berühmten Steins der Weisen enthielt. Sie hatten bis tief in die Nacht miteinander diskutiert. Claires neuer Freund schlug vor, sein Wissen um den Verbleib des Textes preiszugeben, wenn Saint Germain dafür im Gegenzug übernahm, das Buch aus dem belagerten Paris herauszuholen. Die darauffolgenden Arbeiten würden sie gemeinsam auf der Festung de Craons - Champtocé - durchführen, wo er über einen Athenor und ein großes Laboratorium verfügte.
Der Seigneur Jean de Craon, ein Vasall des bretonischen Herzogs Yann de Montforzh, hatte schwerwiegende Gründe gehabt, warum er den Text nicht selber aus Paris herausschaffen konnte. Die Hauptstadt war nach seinen eigenen Worten ein Ort, den er meiden musste, wie die Pest. De Craon behauptete, er habe sich politisch auf die Seite seines Cousins George de Tremoille geschlagen, des verfemten Kanzlers von Frankreich, der mit Königin Isabeau de Bavière gemeinsame Sache machte und mit der Exilregierung in Troyes residierte. Offensichtlich war Bernard d’Armagnac, der noch Herr über Paris war hierbei der gefährlichste Feind, während de Craon sich bei Jean Sans Peur nicht sehen lassen konnte, weil er nach Azincourt, wie Herzog Yann de Montforzh sein Lehnsherr, politische Neutralität gewählt hatte, anstatt sich zu Bourgogne zu gesellen.
Claire war dieses Gewirr aus Intrigen und persönlichen Abhängigkeiten zu undurchschaubar, als dass er viel Zeit und Überlegung hierauf verschwendete. Seine Faszination mit der hermetischen Kunst beruhte nicht nur auf der umfangreichen Sammlung maurischer und spanischer Handschriften in der Bibliothek seines Vaters auf Mont Saint Marsan. Für ihn war der Weg der königlichen Wissenschaft auch die ständige Suche nach seiner eigenen, besseren Persönlichkeit, sein Weg des Lichtes und der Erkenntnis. Ein Weg der Veredelung und Veränderung seines Selbst.
Der junge Ritter aus Anjou fluchte leise vor sich hin, während er mit den anderen Freiwilligen gemeinsam auf den Verräter wartete, der ihnen das Tor öffnen wollte. Er hatte keine Lust darauf, sein Leben im Kampf zu riskieren oder anderen zu beweisen, wie mutig er doch war. Er wollte in die Stadt hinein und anschließend so schnell wie möglich wieder weg von diesem Ort des Krieges und der Grausamkeit.
„Man sagt, die Hunde von Armagnac hätten ihre Streitäxte und Rüstungen schwarz angemalt, um besser einen üblen Handstreich mitten in der Nacht ausführen zu können“, hörte Claire einen der burgundischen Armbrustschützen einem anderen einfachen Soldaten zuflüstern.
„Ach, halt das Maul Du Schlappschwanz“, zischte ihm der Angesprochene böse zu, „wegen Deinen blöden Altweibergeschichten werden sie uns noch bemerken.“
Saint Germain ging auf Abstand zu den Männern. De Villiers hatte ihnen versprochen, sie könnten sich schadlos die Taschen füllen, sobald sie durch das Tor waren und die Parteigänger von Bernard d’Armagnac totgeschlagen hatten, die man ihnen aufzeigen würde.
Kurz nach Mitternacht bewegte sich tatsächlich etwas an der Porte Saint Germain des Près.
„Perrinet“, flüsterte der Hauptmann de Villiers.
„Kommt! Alles ist wie besprochen“, flüsterte ein gesichtsloser Schatten zurück.
III
Auf die trügerische Stille folgte ein schrecklicher Feuersturm. Zuerst waren nur wenige Männer unter Führung von de Villiers in die Stadt geschlichen. Der Verräter Perrinet und sein Sohn, ein Kaufmann den der Verfall der Pariser Währung vollständig ruiniert hatte, zeigten den Soldaten des Burgunder-Herzogs, wo sich die wichtigsten Parteigänger von Bernard d’Armagnac befanden. Im Schutz der Nacht starben ein paar Männer. Dann schlich die Gruppe zur Porte de Clichy, auf der anderen Seite von Paris und öffnete sie genau so weit, wie zuvor die Porte Saint Germain.
In der ersten Morgendämmerung erwachten die Bürger der Hauptstadt zum Klirren der Waffen. Während die Burgunder die Wälle von Paris mit riesigen Kriegsmaschinen von drei Seiten her beschossen, drangen bereits Sturmtruppen durch die Pforten. Alles war nur noch Tumult, Chaos und Blutvergießen. Obwohl Bernard d’Armagnac durch einen kühnen Sprung in den Garten eines Nachbarhauses entkommen konnte, gelang es dem Konnetabel von Frankreich nicht mehr, noch irgendeine Form von Widerstand gegen die Burgunder zu organisieren. Bald schon stürmten Soldaten von Herzog Jean Sans Peur den Louvre und nahmen König Charles VI. und ein paar seiner Kinder in Gewahrsam. Lediglich die Geistesgegenwart und der Mut des Provos von Paris, Tanguy du Châtel, einem abtrünnigen bretonischen Edelmann, ersparte dem Dauphin Charles de Ponthieu ein ähnliches Schicksal. Tanguy schleifte den völlig verstörten Charles in die Bastille und organisierte noch am gleichen Tag von dort aus die Flucht des jungen Mannes. Er brachte ihn nach Bourges, im Südwesten der Hauptstadt Paris und auf der anderen Seite der Loire.
Niemand beachtete den jungen Ritter, der durch die umkämpften Straßen von Paris seinen Weg über den Petit Pont auf die linke Seite der Seine suchte. Jean de Craon hatte ihm alles ganz genau beschrieben: Die sogenannte Grande Rue führte mitten durch das Universitätsviertel. Hier waren die Kämpfe nicht ganz so gewalttätig. Bernard d’Armagnac hatte mit seiner Politik der brutalen Härte die gelehrten Männer der Sorbonne so sehr provoziert, dass die meisten von ihnen für Jean de Bourgogne Partei ergriffen hatten.
Die Porte Saint Jacques befand sich am äußersten Ende der Grande Rue. Als Claire endlich die Kirche Saint Jacques-de-la Boucherie ausmachte, senkte sich die Nacht bereits über Paris. Die Kampfhandlungen zwischen den Waffenleuten von Bourgogne und den führungslos gewordenen Anhängern von Armagnac ebbten langsam ab, aber die durch Blut und Lärm toll gewordenen Soldaten beider Seiten liefen ihren Hauptleuten völlig aus dem Ruder. Sie schlugen die Türen und Fenster der Häuser ein, in denen die verzweifelten Bürger der französischen Hauptstadt sich vor dem Kampf verbarrikadiert hatten. Mark und Bein erschauerten, wenn unmenschliche Schreie daran erinnerten, dass niemand vor Truppen die eine Stadt gestürmt hatten sicher sein konnte. Man schlug alte Männer und kleine Kinder einfach tot, stürzte sich auf Frauen und Mädchen, wobei das Alter keine Rolle spielte.
Claire konnte im roten Feuerschein eines brennenden Hauses deutlich erkennen, was ihr furchtbares Los war. Nachdem eine ganze Gruppe vom Blut und vom Wein berauschter Waffenleute das Mädchen - ein Kind von gerade einmal zwölf oder dreizehn Lenzen - aufs Brutalste missbraucht hatten, ohne sich dabei um die Schreie der Kleinen zu kümmern, schlug ihr der Letzte, nachdem er seine Lust an ihr befriedigt hatte, ohne mit der Wimper zu zucken den Schädel mit einem Holzknüppel ein. Sie machten sich nicht einmal die Mühe, das Zeugnis ihres Verbrechens zu beseitigen und den Leichnam in die Flammen zu schmeißen. Grölend und lachend zogen die Kriegsknechte weiter auf der Suche nach dem nächsten hilflosen Opfer. Claire fühlte Übelkeit in sich aufsteigen. Vorsichtig drückte er gegen die kleine Pforte, die versteckt hinter Büschen und Sträuchern den Weg zur Sakristei der Kirche freigab.
Der Alchemist war am Dreikönigstag gestorben. Er hatte das gesegnete Alter von neunundachtzig Jahren erreicht. Gemäß seiner testamentarischen Verfügung hatten sie ihn in Saint Jacques zur Ruhe gelegt. In den letzten zwanzig Jahren seines Erdendaseins hatten die Kirche und die Gemeinde von freizügigen Geldspenden profitiert. Die Steinfreske über dem Hauptportal bezeugte Nicolas Flamels Großzügigkeit. Im Kreis der Jünger Jesu und Israeliten, die dem Christus lauschten stand einer, dessen Gesicht die Züge des berühmten Alchemisten trug. Die Tür schwang auf. Claire duckte sich instinktiv ganz tief, als er durch die leere, dunkle Sakristei schlich. Er war auf dem Weg, einen Leichnam zu schänden.
Im Glockenstuhl seiner Lieblingskirche hatte Flamel sich neben seinem treuen Weib Perenelle unter einem großen, schön bearbeiteten Stein zur letzten Ruhe gelegt. Und er hatte sein geheimnisvolles Buch mitgenommen. Dieses Buch barg nach Aussagen von Jean de Craon den Schlüssel zum größten aller Geheimnisse dieser Welt: Dem Lapis Philosophorum, dem Stein der Weisen, der in sich das reine Leben trug und damit die alles umfassende Kraft, Geist und Seele miteinander zu vereinen. Unsterblichkeit! Wem es glückte diesen wunderbaren Stein – Lapis ex Coelis - zu erschaffen, der konnte nicht nur unedle Metalle in Gold umwandeln. Er durfte sich auch von Gott, dem Allmächtigen ein ewiges Lehen auf Erden erbitten. Flamel, so sagte man, sei dies gelungen, obwohl er von dem Elixier des Lebens, dem Aurum Potabile, dem legendären Trank, der alle Leiden zu heilen vermochte und auch dem Tod Einhalt gebot offensichtlich nicht zu kosten gewagt hatte. Der junge Ritter aus Anjou schmunzelte. Die Schrecken des Krieges, draußen vor der Pforte von Saint Jacques waren bereits vergessen. Vorsichtig, fast ehrfürchtig ging er in die Knie.
Flamels Gruft!
Er zog seinen Dolch aus dem Gürtel und begann die Ritze zwischen dem Grabstein und den Bodenplatten im Glockenstuhl entlang zu fahren. Es würde eine lange Nacht werden. Er musste ganz alleine zuerst diesen schweren Stein lösen und anheben. Dann musste er ihn wieder an seinen Platz zurückbefördern.....so das niemand je bemerken würde, das man sich hier zu schaffen gemacht hatte.
IV
Sidonius kauerte sich unter dem Altar des Heiligen Jakobus zusammen, als er den Ritter durch die Tür schleichen sah. Hatten sie nicht einmal mehr Respekt vor dem Haus Gottes? Trugen sie ihren Krieg nun auch in seine Kirche? Der junge Benediktiner wagte es kaum noch zu atmen, so sehr fürchtete er sich vor diesem bewaffneten Mann, obwohl sein hübsches, glattes Gesicht, die klaren, blauen Augen und die blonden Locken ihm mehr den Anschein eines Engels, als eines Mordbuben gaben. Doch der Mann trug gut sichtbar ein Schwert und ein spitzer Dolch steckte im Gürtel. Sidonius hörte, wie die Schritte des Ritters auf dem Boden der menschenleeren Kirche widerhallten. Sie kamen näher. Er duckte sich noch tiefer in die Ecke unter dem Altar.
Üblicherweise verbeugten sich an dieser Stelle Männer und Frauen, bevor sie sich auf den weiten Pilgerweg nach Santiago-de-Compostella in Galizien machten. Hier ließen sie ihre Gurden, ihre Pilgerstäbe und die Jakobus-Muscheln weihen, die sie als äußeres Zeichen ihres Gelübdes trugen.
Der junge Benediktiner hielt den Atem an. Die Kirche war wieder still. Die Schritte auf dem Steinboden verstummt. Ganz vorsichtig schob er das Tuch zur Seite, mit dem der Altar geschmückt war.
Der junge, blonde Kriegsmann hatte sich hingekniet und seinen Dolch gezogen und er machte sich an einer Grabplatte zu schaffen. Sidonius brauchte nicht zwei Mal nachzudenken. Sie hatten diese Platte erst vor wenigen Monaten niedergelegt und versiegelt, als der steinalte Meister Flamel gestorben war. Meister Flamel hatte nicht nur viel für diese Kirche in seinem Viertel, in der Nähe seines berühmten Skriptoriums Rue de Mariveaux getan; er war ein wahrhaft gottesfürchtiger Mensch gewesen: Die schön restaurierten Pforten zum „Friedhof der Unschuldigen Kinder“ zeugten von seiner Güte. Er hatte den Bürgern der Hauptstadt im Verlauf von beinahe dreißig Jahren insgesamt vierzehn Spitäler, drei Kapellen und sieben kleine Kirchen gestiftet. In Boulogne, auf dem Weg nach Santiago-de-Compostella - so erzählte man - habe er ähnlich viel Gutes getan und er war immer freizügig mit dem Geld gewesen, um Armen, insbesondere hilflosen Witwen und Waisen zu helfen und Leid das ihm ins Auge stach zu lindern. Meister Flamel war wahrlich ein großartiger Mann gewesen, ungeachtet der vielen seltsamen Gerüchte, die es über ihn in der Hauptstadt gab.
Sidonius erinnerte sich noch genau daran, wie sehr der Priester von Saint Jacques sich am Dreikönigstag geziert hatte, Meister Flamel dieses sonderbare, uralte und große Buch mit ins Grab zu legen, dieses Buch, von dem man munkelte, es sei ein Wunderbuch zur Herstellung von Gold und Meister Flamel selbst habe es dem Teufel abgeluchst. Meister Flamel war auch ein berühmter Gelehrter und Alchemist gewesen.
Sidonius wurde etwas waghalsiger, als er erkannte, wie konzentriert der blonde Ritter arbeitete. Natürlich! Dieser junge Mann trachtete ihm nicht nach dem Leben. Er profitierte vom Krieg und von dem Chaos in den Straßen der Stadt, um das Grab von Nicolas Flamel zu schänden und ihm sein Zauberbuch wegzunehmen. Irgendjemand hatte dem Krieger verraten, dass es hier begraben lag. Vielleicht war es der Pfarrer von Saint Jacques gewesen, dem der Blonde den Dolch an die Kehle gesetzt hatte. Um seine Haut zu retten musste der zittrige, versoffene Alte ihm davon erzählt haben. Oder er war über den sonderbaren, düsteren Professor mit der Adlernase und den kalten Augen gestolpert, der sich während der Grablegung so still und ernst im Hintergrund gehalten hatte, zusammen mit dem Notarius, den Flamel als seinen Testamentsvollstrecker eingesetzt hatte.
Der Notarius war aus Pontoise gekommen, Flamels Geburtsort. Sidonius hatte ihn noch nie zuvor gesehen. Er hatte nur stumm neben dem Professor Anselmus von Vannes gestanden, der mit den kalten, harten Augen eines bösen Raubvogels darüber gewacht hatte, dass das Buch zusammen mit dem Leichnam des Alchemisten und seinem einfachen Eichensarg dort unten in ihrem Loch und unter der schweren Steinplatte verschwand.
Der junge Ritter hatte es offenbar geschafft, seinen Dolch in einen etwas größeren Spalt zu zwängen. Sidonius sah genau, wie der Grabschänder sich mit aller Kraft auf die Waffe stemmte und die Platte aus ihrer Verankerung hob. Der Blonde schnaufte schwer vor Anstrengung. Schweißperlen tropften von seiner glatten Stirn über sein hübsches Engelsgesicht hinunter auf den kalten, grauen Boden.
Der Mann kannte keine Scham. Er stieg in die Gruft hinunter. Bald darauf splitterte Holz. Er musste mit seinem Schwert entweder den Sargdeckel zerschlagen haben oder einen Sprunt an der Seite. Als er nach einer ganzen Weile wieder nach oben kletterte, sah Sidonius, wie der Dieb das Wunderbuch fest gegen seine Brust presste. Ein verklärtes Lächeln lag über seinem Gesicht. Noch bevor er sich wieder daran machte, seinen schändlichen Akt vor den Augen der Welt zu verbergen und die Grabplatte an ihren ursprünglichen Platz zu rücken, küssten seine Lippen das Diebesgut, ganz so als ob es eine schöne Frau wäre.
Sidonius zog den Hals ein. Es war widerlich. Er hatte während der Beisetzung einen kurzen Blick auf den Einband von Flamels Buch erhascht: Lauter nackte Kreaturen mit Menschenleibern und Tierköpfen waren es gewesen, die ausgesehen hatten, als ob sie tanzten.
Während der junge Ritter arbeitete und schwitzte, überlegte der Benediktiner was er nun tun sollte. Den Provos von Paris aufsuchen und ihm von der Grabschändung berichten und ihm den Schänder beschreiben? Wen kümmerte es schon in einer Stadt, die man gerade in Schutt und Asche legte, ob da ein wilder Kriegsmann ein Grab schändete. Und gewiss hatten sie den Tanguy de Châtel bereits totgeschlagen. Er war einer der fanatischsten Anhänger des grausamen Armagnac gewesen und außerdem ein übler Schinder, Schlächter und Teufelsanbeter. Nôtre Dame? Der Erzbischof? Bestimmt war der bereits über alle Berge und irgendwo außerhalb der Stadt in Sicherheit. Senlis lag einen Tagesritt von Paris entfernt, genauso, wie Dreux
Sidonius schüttelte den Kopf. Er war einfach zu leichtgläubig und zu blind: Wenn ein Mann es wagte bewaffnet in ein Gotteshaus einzudringen und kaltblütig ein Grab zu schänden, womit er seine Seele den Feuern der Hölle aussetzte und vor weltlicher Gerichtsbarkeit im besten Fall mit einem schmerzhaften, langsamen Tod rechnen konnte, dann musste der Preis das Risiko wert sein. Dies konnte nur bedeuten, dass sämtliche wilden Gerüchte über das Buch von Meister Flamel Wahrheit waren. Es war ein Zauberbuch, ein Grimoarium, ein magischer Text; vielleicht sogar einer voller schwarzer Magie, genauso wie der, dessen Tanguy de Châtel sich Gerüchten nach bediente, um Nachtens Untote und Spektren zu beschwören, die in seinem Auftrag schändliche Mordtaten an Feinden der Armagnac-Fraktion ausübten.
Sidonius beschloss, ohne sich noch länger mit Grübeln und wilden Theorien aufzuhalten, diesem blonden Ritter zu folgen und herauszufinden, was er mit dem Teufelsbuch wirklich vorhatte. Falls sich Gelegenheit ergab, würde er es ihm vielleicht wegnehmen und in die Flamelsche Gruft zurückbringen können. Wenn nicht, dann würde er nach Hause nach Cornouailles verschwinden und seinem Herrn Ambrosius Arzhur davon erzählen.
Ambrosius Arzhur würde genau wissen, was mit einem Teufelsbuch zu tun war. Seine Magie war mächtig. Er entzündete die Bealltainn-Feuer und schenkte seinem Land damit neues Leben, reiche Ernten und einen guten Fang draußen auf dem Meer. Er beherrschte die Elemente, seine Hand heilte und er wusste um die Weisheit und den Weg der alten Götter. Ambrosius Arzhur war der Drouiz Meur. Er stand auf der Seite des Lichtes und hatte stets die dunklen Mächte bekämpft und sein Land und die Kinder von Penn-Ar-Bed beschützt.
Sidonius trug zwar die schwarze Kutte des Orden des Heiligen Benedikt am Leib, doch unter dem schweren, warmen Wollstoff hatte das Herz von Szenec, dem Sohn von Juizig dem Fischer von Cap-Coz in der Waldbucht direkt vor Concarneau nie aufgehört zu schlagen.
Leise schlich der junge Mönch im Schutz der Dunkelheit hinter dem blonden Ritter her, der sein schändliches Werk inzwischen erledigt hatte. Da er die Kirche von Saint Jacques verlassen glaubte, bemühte der Blonde sich nicht mehr, leise zu sein. Er achtete lediglich darauf, die großformatige Schrift in ihrem schweren Einband aus Leder und Messing sorgfältig unter seinem weiten Umhang zu verbergen.
V
Sidonius hatte keine Zeit verloren. Er war dem Ritter durch die Straßen der Hauptstadt gefolgt, wie ein Schatten. Nachdem er sicher war, dass der Grabschänder nicht sofort aufbrach, sondern sich erst ausruhte, war er zu seiner eigenen Unterkunft zurückgekehrt und hatte seine Habseligkeiten zusammengepackt. Dann war es ihm gelungen, kaltblütig ein kräftiges Pferd zu stehlen. Während die neuen Herren von Paris noch feierten, mordeten, plünderten und brandschatzten, war er im Schutz seiner Ordenskleidung durch die Porte de Clichy verschwunden. Er hatte sich diskret mit dem Pferd zwischen ein paar Büschen verborgen und den Ausgang der Stadt beobachtet. In der Tat war der blonde Dieb bei Sonnenaufgang erschienen. Er ritt einen hübschen, dunkelbraunen Roussin und führte an einem langen Strick ein solides Packpferd auf dem seine Waffen und seine Rüstung verstaut waren.
Sidonius hatte einen ganzen Tag gebraucht, um sich wieder daran zu erinnern, wie man vernünftig ritt. Die Klosterschule von Sankt Hennebont und die Holzbänke des Collegium Sorbonianum zusammen mit der großzügigen Börse seines Herren Ambrosius von Cornouailles hatten ihn etwas träge und rundlich gemacht. Doch als Kind war er oft zusammen mit seinem Freund Sévran, dem jüngsten Sohn von Ambrosius Arzhur geritten. Als sie noch klein gewesen waren, hatten sie meist einträchtig zusammen auf dem schweren Ackergaul gesessen, der den Wagen seines Vaters zwei Mal in der Woche zum Markt nach Concarneau gezogen hatte. Dann waren sie miteinander durch den Wald bis zur Küste zurückgerannt, um zu spielen, während Meister Juizig und die Mutter den Fang zum Verkauf anboten. Später hatte Sévran ihn auf Finn reiten lassen, dem kleinen, schneeweißen Hengst aus Irland, den er von seiner ältesten Schwester, der Gemahlin des Königs von Thomond geschenkt bekommen hatte. Sévran hatte sich immer durch die Pforte für die Dienstleute aus der Festung weggeschlichen und war durch die Nacht zusammen mit Finn zu ihrer Hütte am Cap Coz gekommen. Sidonius hatte einen Weg übers Dach gefunden, auf dem er der Wachsamkeit seiner Mutter entrinnen konnte, wenn der Vater mit dem Boot auf See war. Und dann waren sie zusammen mit Finn verschwunden…in den Wald hinein oder an die Küste hinunter, wo es einen wunderbaren langen Sandstrand gab, der zum wilden Galoppieren einlud.
Sidonius schmunzelte: Er war seiner Mutter meist unbemerkt entwischt. Die Gute hatte immer schon einen gesegneten Schlaf gehabt. Doch sein Freund Sévran hatte regelmäßig Schelte von Aodrén Jaouen Kréc’h Elis bezogen, der trotz seines sagenhaften Alters offenbar die Augen einer Eule und die Ohren eines Luchses besaß. Sévran sollte lernen, nicht sich am Strand herumtreiben und Steine übers Wasser springen lassen oder, wie ein Bauernlümmel durch die Nacht streunen. Trotzdem war er jedes Mal zur Stelle gewesen, wenn sie eines ihrer kindlichen Abenteuer verabredet hatten.
Der blonde Dieb hatte von Paris aus den Weg nach Chartres eingeschlagen. Der Mann schien in schrecklicher Eile zu sein. Er bemerkte nicht einmal dass er verfolgt wurde. Selten suchte der blonde Ritter bei Einbruch der Dunkelheit nach einem Gasthof, in dem er vernünftig ausruhen konnte. Meist stellte er seine Pferde in irgendeiner Scheune unter und schlief selbst im Stroh oder er übernachtete gar unter freiem Himmel. Sidonius dankte dem Allmächtigen für seine Kinder- und Jugendjahre an der rauen Küste von Cornouailles. Saint Hennebont, die Benediktiner und das Studium in Paris hatten ihn zwar etwas füllig gemacht, doch sie hatten ihn weder verweichlicht, noch seine Sinne und Reflexe beraubt: Während der Dieb sich Nachtens regelmäßig mit kümmerlicher Kost und Wasser zufrieden geben musste, fand er immer einen leichtsinnigen Igel oder ein unvorsichtiges Eichhörnchen für eine warme Mahlzeit.
Als Kind hatte er mit der Mutter oft Beeren und Pilze gesammelt oder manchmal auch Sévran und den gestrengen Aodrén begleiten dürfen, wenn sie Kräuter holten. Der Wald hinter Chartres war trotz der fortgeschrittenen Jahreszeit noch reich an roten und schwarzen Früchten, die zwar leicht vertrocknet waren, aber trotzdem den Eintopf versüßten. Pilze gab es an allen Ecken. Der blonde Ritter schien entweder zu dumm oder zu sehr von seinem Zauberbuch gefangen, um überhaupt zu riechen, wer sich da in unmittelbarer Nähe von seinem Nachtlager etwas Leckeres zusammenbrutzelte, während er selbst hungrig ging.
Im Verlauf der Zeit wurde Sidonius waghalsiger. Er folgte dem blonden Dieb dicht auf. Der Mann schien so von seinem Buch besessen, dass er nichts merken wollte. Sie folgten der Eure und Sidonius holte sich Krebse oder fette Forellen aus dem glasklaren Wasser, während der Blonde immer dünner und verklärter wurde. Abends las der Ritter im Schein seines Feuers in Flamels Zauberbuch, bis er vor lauter Müdigkeit einschlief. Er deckte sich nicht einmal zu, sondern schlotterte und zitterte in der Kälte. Nur das Buch presste er im Schlaf fest an die Brust.
Als sie endlich Le Mans erreichten, war der Blonde schließlich so erschöpft, dass er sich zwei Tage Pause in einem Gasthof gönnte. Er musste sein Kriegspferd neu beschlagen lassen und auch das Lasttier hatte ein Eisen verloren.
Sidonius erwischte einen Lehrjungen des Schmieds beim Wickel und überzeugte ihn mittels einiger Kupfermünzen davon, dass es gottgefällig war, Bescheid zu geben, sobald der Ritter weiterzog. Dann kratzte er sich sorgfältig den Bart aus dem Gesicht, zog eine der beiden kostbaren Kutten aus feinster Wolle über, die sein Herr Ambrosius Arzhur ihm zu Anfang des Frühjahres nach Paris geschickt hatte und suchte den Abt des Kapitels von Saint Vincent auf. Während sein Dieb in einem flohverseuchten, schmierigen Gasthof nächtigte, genoss Sidonius den Vorteil das wohlgekleidete Mitglied eines angesehenen Ordens zu sein. Er erzählte seinen Brüdern, das er auf dem Heimweg nach Saint Hennebont in Cornouailles war, hörte mit ihnen die Messe, lies es sich gehörig schmecken und verschwand, als der Lehrling des Schmiedes auftauchte genau so diskret, wie er zuvor gekommen war.
Die nächste Woche führte die beiden Männer zuerst durch einen finsteren, unheimlichen Wald und dann an die Ufer der Sarthe. Irgendwann konnte Sidonius vom Sattel seines Reittieres aus die dunklen Wasser der Loire erkennen. Der Ritter beschleunigte seine Reise. Er rastete nicht einmal mehr bei Anbruch der Dunkelheit, sondern nur noch, wenn seine Pferde nicht mehr weiterkonnten.
Genau einen Monat nach der Grabschändung von Paris senkten zwei bis an die Zähne bewaffnete Männer ihre Lanzen und ließen ihn über eine schwere Zugbrücke den langen Weg hinauf in eine bedrohlich wirkende Festung reiten.
Sidonius war inzwischen der Jagd beinahe überdrüssig geworden. Der Mann hatte von Paris aus die schwierigste Strecke hinunter in die Bretagne ausgewählt, wie einer der keine Ahnung hatte, wo er eigentlich hinwollte. Kein vernünftiger Mensch hätte sich je die Wälder und die Sarthe zugemutet, wo es doch über Alençon eine gute Straße und reichlich saubere Wirtshäuser gab. Sidonius zuckte nur mit den Schultern, wendete sein Pferd und trabte zum nächstliegenden Weiler, um sich zu erkundigen, welche Namen die Festung und ihr stolzer Herr trugen: Er hatte beschlossen noch ein paar Tage Wache zu stehen, um sicher zu sein, das sein blonder Dieb nicht entwischte. Der Weg nach Concarneau war nicht mehr weit. Er würde über Nantes und Vannes reiten.