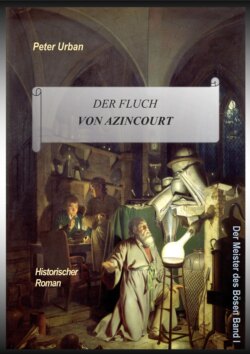Читать книгу Der Fluch von Azincourt Gesamtausgabe - Peter Urban - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 1 Der Orden von Santiago
ОглавлениеI
„Komm, Sévran. Es ist Zeit.“
Der junge Mann seufzte leise, dann erhob er sich von seinem Stein unter der Weide, um Aodrén zu folgen. Am Ufer des Aff blühten kleine, weiße Anemonen. Der Boden war bedeckt von frischem, neuem Gras, von Veilchen und von Waldmeister. Nur ein leiser Lufthauch drang durch die Blätter der Bäume und lies Blütenduft im warmen Wind verwehen. Der wirbelnde Schaum auf dem vom Frühlingsregen geschwollenen Bach sah aus, wie ein weißes Feengewand. Als er sich einen kurzen Augenblick von seinem Lehrer unbeobachtet glaubte, strich Sévran de Carnac sorgfältig das einfache rostbraune Gewand glatt, das er heute vielleicht zum letzten Mal tragen würde. Ein leises Lächeln umspielte seinen schmalen Mund und seine kohlrabenschwarzen Augen leuchteten. Hocherhobenen Hauptes schritt er auf den Steinkreis zu, in dem sie ihn erwarteten. Seine Schultern waren eckig und breit geworden und sein Körper war schlank und wohl bemuskelt. Trotzdem wirkte er auf den ersten Blick immer noch zierlich, wie ein Mädchen.
Sévran überragte seinen Lehrmeister Aodrén Jaouen Kréc’h Elis bereits um einen ganzen Kopf und an die Stelle eines schwächlichen, oftmals kränkelnden Kindes war im Verlauf der letzten drei Jahre im Heiligen Wald von Brocéliande ein zäher, sehniger und sehr selbstbewusster junger Mann getreten, der niemals müde zu werden schien. Als er sich schließlich vor den versammelten Drouiz leicht verbeugte, schenkten Konogan und Hegareg ihm ein aufmunterndes Lächeln. Lediglich Tugdual versuchte ernsthaft dreinzuschauen, doch so ganz gelang ihm die Übung nicht.
Der Sohn des Herzogs von Cornouailles spürte Zuversicht in sich aufsteigen: Unter der uralten Eiche, im Schatten und fast vor den Blicken der anderen verborgen saß Maod’ana. Sie musste sogar noch älter sein, als Aodrén. Üblicherweise bemühte die Bandrouiz sich nicht, wenn es lediglich darum ging zu entscheiden, ob einem jungen Mann das Recht zugesprochen wurde, den Titel eines Anruth zu führen, denn der Weg von Séna - der Ile de Sein- quer durch Cornouailles und Breizh war weit, gefährlich und beschwerlich. Es war eine große Ehre, der steinalten, von Sagen und Legenden umwobenen Hohepriesterin zu begegnen.
Maod'anas schlohweißes Haar verbarg ihr Gesicht, wie ein Schleier. Sie stützte ihre faltige, wettergegerbte Rechte auf die Schulter von Berc’hed, die eines Tages an ihre Stelle treten würde, wenn die Götter beschlossen, die Bandrouiz in die weiße Welt nach Tir na ù Ban zu rufen. Hinter den beiden Frauen stand noch eine Dritte im Schatten der Eiche. Sévran konnte aus der Entfernung ihr Gesicht nicht erkennen und sie schien ihm mehr Schatten, als Wirklichkeit. Im Gegensatz zu Maod’ana und Berc’hed war sie in dunkle Gewänder gehüllt und trug ihr schwarzes, hüftlanges Haar offen. Alles hatte den Anschein, als ob man ihn heute mehr einer Formalität, als einer echten Prüfung unterziehen wollte.
Er spürte, wie Aodrén ihm sanft die Hand auf die Schulter legte. Ohne Worte schien sein Lehrer ihm mitzuteilen, dass alles gut sein würde, am Ende dieses langen Tages. Der junge Mann blickte den Weiße Brüdern, die am Steinring im Hochwald von Brocéliande versammelt waren, um ihr Urteil über ihn zu sprechen fest in die Augen. Er brauchte sich nicht vor ihnen zu fürchten.
Als die feinen Morgennebel zerrissen und eine strahlende Sonne durch das Blätterwerk auf die Gruppe im Steinkreis fiel, hatte Sévran bereits das Schlimmste hinter sich: Aodrén hatte ihn immer dazu antreiben müssen, sich mit den Gesetzen zu beschäftigen und ihre Geschichte auswendig zu lernen.
Als Kind, als er sich noch gequält hatte, eine um die andere die fünf ersten Stufen der Weisheit zu erringen, da war ihm dieses Wissen verglichen mit den Abenteuern der Natur, den Geheimnissen der Gestirne, der Lehre von den Göttern und ihren Kräften und der Präzision der Mathematik immer wie schmückendes Beiwerk vorgekommen, obwohl er niemals den Zauber der Verse geleugnet hatte. Doch in diesem Augenblick, als Tugdual die Arme ausbreitete und der junge Mann im Zentrum des Steinrings auf die Knie fiel, um die Anerkennung der Drouiz für diesen Teil seiner Prüfung zu empfangen, sprach er die traditionellen Worte voller Stolz.
„ Ich weiß, warum die Erle purpurfarben ist,
warum der Hänfling grün ist,
warum die Zweige rot sind,
warum eine Frau nie zur Ruhe kommt,
warum die Nacht hereinbricht...
Ich weiß,
dass der Fuß des weißen Schwanzes schwarz ist,
ich weiß, dass die spitze Lanze vier Kanten hat,
ich weiß, dass das Geschlecht der Himmel
niemals untergehen wird,
aber ihr Endzweck ist mir unbekannt.
Ich kenne die Fährten der Eber und der Hirsche,
ich weiß, welch unendliche Macht
in den Gezeiten des Meeres schlummert,
aber niemand weiß, warum das Herz der Sonne rot ist.“
Tugdual bedeutete Konogan, dessen Fähigkeiten in der Medizin und den Wissenschaften über die Natur die aller anderen Drouiz im heiligen Wald von Brocéliande übertraf, das der Prüfling nun ihm gehörte.
Sévran warf einen Blick zu Aodrén hinüber, der inzwischen im Kreis der anderen Weisen saß. Er bemerkte, wie lebhaft und aufgeregt sein Lehrer war. Der alte Mann reckte sich, um jede Einzelheit der Prüfung mitzubekommen, die Konogan vorbereitet hatte und seine Augen glitzerten. Aodrén hatte vor endlos langer Zeit einmal selbst hier in diesem Steinring gestanden, um als Drouiz Meur über einen jüngeren Konogan zu urteilen, bevor er schließlich endgültig den heiligen Wald von Brocéliande verlassen hatte, um nur noch den Herzögen von Cornouailles zu dienen.
„Der Ollamh erscheint mir heute um Vieles nervöser, als sein Schüler“, schmunzelte Konogan, bevor er Sévran die erste Frage in lateinischer Sprache stellte. „An ergo alia, melior et mollior, reperta? Et quae illa, Sevran ?“, beendete Konogan schließlich seine eigenen kurzen Ausführungen über verschiedene Möglichkeiten, Schmerzen zu lindern. „Existiert also etwas anderes, etwas Besseres und Angenehmeres? Und was ist es?“
Der junge Mann bemühte sich so ernst, wie nur möglich dreinzuschauen, als er dem Drouiz antwortete. Konogan hätte ihn zur Astronomie, zur Mathematik, zur Geographie oder zur exakten Berechnung der Zeit ausfragen können. Natürlich hätte Sévran ihn auch in diesen Wissenschaften zufriedengestellt, doch der Drouiz hatte in Anwesenheit der Bandrouiz und der beiden Töchter von Séna ganz offensichtlich mit Absicht die Medizin und die Pflanzenkunde gewählt. Als Schüler von Aodrén war es beinahe selbstverständlich, das Sévran hier glänzen konnte. Aodrén hatte seine Kunst auf weiten Reisen erweitert und vertieft. Er war in seinen jungen Jahren sogar an der berühmten Akademie von Salerno gewesen, die der römische Kaiser Friedrich II. von Hohenstauffen dort im Jahre 1224 gegründet hatte und auch an der maurischen Schule von Cordoba in Al Andalus. Er hatte die Welt bereist: Ägypten, das Land am Nil, Persien und sogar das ferne und geheimnisvolle Indien…obwohl er über diese Zeit seines Lebens niemals zu ihnen sprach.
Aodrén hatte von diesen weiten und abenteuerlichen Reisen Abschriften zahlreicher wunderbarer Werke mitgebracht, die er gemeinsam mit Sévran las, wenn er ihm Unterricht in der arabischen und der jüdischen Sprache erteilte. Avincenna - Abu Sina, der Vater der maurischen Heilkunst gehörte genauso zu Sévrans Lektüre, wie Djabir Ibn Haijan, der mit seinem Werk um die islamische Alchemie den bedeutenden Einfluss der Gestirne auf den Körper und die Gesundheit des Menschen erklärt hatte. Der junge Mann räusperte sich. Sein jugendlicher Wissensdurst hatte ihn auch dazu verleitet Ibn Masarra und Ibn Arabi zu lesen und in den Kopien der Tabula Smaragdina und der Ghajat al-Hakim herumzuschnüffeln, die Aodrén mitgebracht hatte, doch diese etwas anrüchigeren Dinge wollte er seinen Prüfern vorerst ersparen.
„Schon bei den Griechen spielten Schlaf- und Schmerzmittel eine herausragende Rolle“, erläuterte er selbstsicher, „so nennt Gaius Plinius der Ältere in seinem Werk Naturalis Historia unter anderem den Mandragora-Wein und unterscheidet das Einsatzgebiet: soll Schlaf erzeugt werden, reicht allein schon das Einatmen des Weins; für eine betäubende Wirkung wird der Wein als Trank verabreicht. Als Mittel um nur eine bestimmte Stelle des menschlichen Körpers zu betäuben, gibt Plinius den sogenannten Stein von Memphis an, eine Paste aus Marmorstaub und Essig, welche auf die Haut aufgestrichen diese unempfindlich gegen Schmerzen macht, sowie die Asche von Krokodilshaut.“
Konogan nickte zufrieden. Auch Maod’ana und Berc’hed schienen von seinen Ausführungen angetan. Über dem runzeligen, verwitterten Gesicht der Bandrouiz lag ein katzengleiches, zufriedenes Lächeln und ihre von tiefen Falten umgebenen smaragdgrünen Augen glitzerten fröhlich, während Berc’hed ihr irgendetwas ins Ohr flüsterte und dabei mit einem spitzen, dünnen Finger etwas ungezogen direkt auf ihn deutete. Sévran fasste Mut. Er hatte selbst schon ein wenig herumprobiert und war dabei zu einer noch einfacheren Lösung gekommen, wie man ein Mittel zur Schmerzlinderung und Betäubung geschickt transportieren und auch verabreichen konnte. Aodréns Erfahrungen von der Akademie in Salerno, wo er Haschisch aus Persien, Opium aus dem Hindukusch und Belladonna erprobt hatte, hatten ihn dazu angeregt. Alle diese Stoffe ließen sich genau so leicht in eine Tinktur verwandeln, wie verschiedene Pflanzen, die er im heiligen Wald fand und die ähnliche Eigenschaften besaßen: „Verbo, nihil ut doceatur, discatur, sciatur, temere, ad curiositatem duntaxat, ut sciatur: sed ad artem, ut fiat..”, setzte er seine Ausführung auf Lateinisch fort, „Mit einem Wort; Nichts soll um des Lehrens Willen gelernt werden, nicht planlos als bloße Kuriosität gewusst werden, sondern für die Fertigkeit und damit es gemacht werden kann.“
Das Lateinische hatte mit der zunehmenden Christianisierung langsam aber bestimmt den Gebrauch der griechischen Sprache in den Wissenschaften verdrängt. Sogar die Drouiz hatten dies letztendlich akzeptiert, obwohl viele der Älteren immer noch vorzogen, das Wenige was sie schriftlich niederlegten, auf Griechisch zu verfassen.
„Wenn man nun aber die Auszüge von Papaver Somniferum, die die Araber allgemein „abu en nom“, den Vater des Schlafes nennen mit Alraunen- Bilsenkraut- und Schierlingssaft vermischt und einen ganz gewöhnlichen Schwamm voll saugen lässt, dann kann man diesen hinterher in der Sonne trocknen und ganz einfach mit sich führen. Wenn er dann verwendet werden soll, lege man diesen „spongium somniferum“ in eine Schüssel mit ein wenig warmem Wasser. Nach Beendigung einer Operation kann man durch erneutes Trocknen, den Schlafschwamm wieder in seine einfach zu transportierende Ausgangsform zurückverwandeln“, der junge Mann verbarg nach Abschluss seiner Erklärung seinen Stolz nicht mehr. Auf seinem Gesicht lag ein ausgesprochen selbstzufriedenes Lächeln.
Die Weisen, die um die Drouiz, die Sévran befragten versammelt saßen nickten alle anerkennend. Auch Maod’ana und Berc’hed gaben Konogan Zeichen, das er seine Prüfung nun beenden könne, denn Sévran hatte ausreichend bewiesen, dass er sich nach elfjährigem Studium das Recht auf den Titel eines Anruth erarbeitet hatte und sich endlich auf die letzte und schwierigste Etappe seines Weges begeben konnte. Tugdual winkte ihn heran.
Sévran atmete auf. Die Sonne wärmte angenehm seine nackte Haut. Die rostbraune Robe lag ordentlich zusammengefaltet vor ihm auf dem Boden und er hielt einen langen Stab aus hartem, glänzendem Eibenholz in der Rechten. Noch schmückten den Stab keine Zierden aus Silber und kein Kristall thronte auf seiner Spitze und der dunkelblaue Pflanzensaft, mit dem Hegareg die Konturen eines Triskel auf seine Brust gezeichnet hatte war noch feucht. Aber trotzdem: Es war beinahe zu Ende. Er würde sich bis zum Einbruch der Nacht ausruhen dürfen. Er hatte Hunger und war schrecklich durstig.
II
Nach dem Abendessen kehrten Jean de Craon und Gilles noch einmal in das Laboratorium des alten Mannes in den Gewölben von Champtocé zurück. Der Ritter aus Anjou, der seit einigen Wochen ihre Gastfreundschaft genoss, hatte diesen Teil der Festung noch nicht betreten. Er war in einem Gemach im Turm untergebracht. Der Raum war gut eingerichtet: ein großes, bequemes Bett, ein Schreibtisch, Stühle, eine Truhe, eine kleine Bibliothek mit interessanten Handschriften aus der reichen Sammlung von de Craon.
Nach seiner beschwerlichen Reise von Paris bis an die Ufer der Loire und den vorausgehenden Entbehrungen während der Kriegshandlungen und der anschließenden Belagerung der Hauptstadt, war der Mann nicht in einer Verfassung gewesen, sofort die vereinbarten Forschungsarbeiten aufzunehmen. Er hatte Dankbarkeit gezeigt, als de Craon ihm vorschlug, erst einmal wieder zu Kräften zu kommen.
Sorgfältig verschloss Gilles die schwere Eichenholztür, während sein Großvater drei Kerzen an einem großen Schreibtisch entzündete. Das Buch des Alchemisten lag dort aufgeschlagen. Sie hatten ohne größere Schwierigkeiten die meisten Anweisungen lesen können, die Abraham Eleazar der Jude für seine in alle Winde zerstreut lebenden Brüder und Schwestern damals niedergelegt hatte, um ihnen zu helfen, die Steuerlast zu ertragen, die die weltlichen Herrscher ihnen aufbürdeten. Erstaunlicherweise hatte der Leviterfürst und Priester für sein Werk die klassische, lateinische Sprache ausgewählt, wohl wissend, dass viele Israeliten im Exil der hebräischen Sprache kaum noch mächtig waren. Doch damit hatten Jean und Gilles das Rätsel um Nicolas Flamel und seinen unglaublichen Reichtum natürlich noch lange nicht gelöst.
„Großvater, habt Ihr damals während der Ermittlungen, als Ihr noch im Dienste von Staatsrat Cramoisi gestanden habt nicht vielleicht doch irgendein Detail übersehen...oder im Verlauf von drei Jahrzehnten einfach vergessen“, der junge Laval besaß einen außergewöhnlich scharfen Verstand. Seine Ausbildung war vom ersten Tag an, als Jean de Craon das Kind seiner ältesten Tochter nach Champtocé geholt hatte vom Besten gewesen: Gilles sprach und schrieb die lateinische und die griechische Sprache. Er hatte Mathematik und Astronomie studiert und sämtliche bedeutenden philosophischen Werke gelesen, die auf dem Markt für gutes Gold erworben werden konnten. Jean selbst hatte ihn nicht nur in der Schwarzen Kunst unterwiesen, sondern ihn auch die Ars Alchimia und das Sternedeuten gelehrt. Natürlich war Gilles' Unterweisung im Waffenhandwerk immer an erster und wichtigster Stelle gestanden, doch der Junge war begabt und ausgesprochen wissbegierig. Das Lernen fiel ihm leicht.
Der alte Mann zog sich einen Stuhl an den Tisch und bedeutete auch seinem Enkel sich zu ihm zu setzen. Seine Rechte strich Gilles liebevoll über die dunkelbraunen Locken und de Craons hellgraue Augen, die ür gewöhnlich kalt und hart blitzten, wurden für einen kurzen Augenblick weich und zärtlich: „Wir haben den Fall Flamel lange untersucht, mein lieber Junge. Ich befürchte, weder de Cramoisi noch ich selbst haben damals irgendetwas übersehen. Es war ein persönlicher Befehl des Königs gewesen, diese Untersuchung durchzuführen. In jenen Tagen, als Charles noch klar im Kopf war, konnte sich niemand Fehler leisten, nicht einmal de Cramoisi.“
In der Tat waren de Craons Erinnerungen an dieses Schlüsseljahr 1389 so klar und so präzise, als ob sich das Ganze erst gestern abgespielt hätte: Er war fünfunddreißig Jahre alt gewesen, energisch, ehrgeizig und gerissen. Sein Interesse an den geheimen Künsten und an der Ars Alchimia hatte die Aufmerksamkeit des Staatsrates de Cramoisi auf ihn gelenkt, obwohl er nur ein einfacher und unbedeutender Landedelmann von der Loire gewesen war. Dazu war es gekommen, weil der Notarius der Sorbonne Nicolas Flamel, von dem man hinter vorgehaltener Hand munkelte, er besitze ein Zauberbuch und studiere die Alchemie, sozusagen über Nacht angefangen hatte, für Unmengen von gutem Gold Spitäler, Armenhäuser und Kapellen in Paris und in der Hafenstadt Boulogne zu stiften. Zuvor war der Mann zu einer Pilgerfahrt nach Santiago de Compostella aufgebrochen und beinahe zwei Jahre vom Erdboden verschwunden gewesen. Viele andere Männer, die als Alchemisten auf der Suche nach dem Lapis Philosophorum waren, hatten diese Pilgerfahrt gleichfalls unternommen, doch keiner von ihnen war je zurückgekehrt und hatte plötzlich so viel Gold besessen, wie der Notarius des Collegium Sorbonianum. Und niemand hatte je aus Flamels Mund erfahren, was er auf seiner Reise nach Galizien erlebt, oder wen er getroffen hatte. Auch Jean de Craon nicht. Aber dank seines ausgeprägten Spürsinnes und einer großen Gabe komplizierte Intrigen zu spinnen, ohne dabei ertappt zu werden, war er ihm es schließlich doch gelungen, alles herauszufinden..im Verlauf der langen Jahre, die der Untersuchung durch den Staatsrat de Cramoisi gefolgt waren. Er hatte Paris und dem Hof den Rücken gekehrt, um mit seinen eigenen Nachforschungen kein Aufsehen zu erregen. Auf dem Weg, den er eingeschlagen hatte, um das Geheimnis von Nicolas Flamel zu ergründen, war er durch alle Ebenen der geheimen Kunst gewandert. Er hatte dabei unendlich viel gelernt…und schmerzliche Erfahrungen gemacht, die er seinem Enkel ersparen wollte.
„Damals“, fuhr er für Gilles mit seiner Erzählung fort, „mussten wir die Ermittlungen einstellen, denn wir konnten ihm nichts nachweisen. Flamel war nach außen hin ein ganz ehrlicher, gottesfürchtiger Mann. Sein Skriptorium lief höchst profitabel und das Stiften von Spitälern, Armenhäusern und Kapellen wurde nicht einmal von den misstrauischen Pfaffen als ein Verbrechen angesehen. Dazu kam noch: Flamels Lebenswandel und der von Dame Perenelle, seiner Gemahlin -die reiche Erbin eines bedeutenden Zunftmeisters - waren unauffällig.“
Gilles hing an den Lippen seines Großvaters. Sie hatten immer schon viel zusammen gearbeitet und experimentiert. Die Ars Alchimia als solche faszinierte ihn, obwohl er diese exakte Kunst, die ihn irgendwie an die Arbeit eines Apothekers erinnerte, oftmals als zu anstrengend und zu zeitaufwendig abtat. Er hatte immer gerne in den Werken geblättert, die sein Großvater im Verlauf eines langen Lebens angehäuft hatte. Doch die meisten dieser Handschriften bedienten sich einer sonderbaren, verschlüsselten Sprache und bildlicher Allegorien. Jean de Craon war davon überzeugt, das nur in ihnen, aber nicht in den zahlreichen anderen Werken die sich mit den schwarzen Künsten befassten, der Schlüssel zu wahrer Macht und zu Geldmitteln ohne Ende lag. Die schwarze Kunst, so predigte ihm der alte Mann dauernd, barg eine nicht zu verleugnende Gefahr eines Tages von den eigenen Dämonen und Geistern aufgefressen zu werden.
Seitdem Gilles sich bei Azincourt genommen hatte, was er haben wollte und den Sigillenreif an seinem rechten Handgelenk trug, vertiefte er sich trotz der ständigen Warnungen de Craons immer weiter in die schwarze Kunst. Der Großvater besaß in seiner Bibliothek nicht nur den Schlüssel Salomons –Clavicula Salomonis- der die Durchführung magischer Rituale schilderte, mit denen man Geister der Toten beschwören konnte oder Dämonen als Hilfskräfte aus dem Schattenreich rief. Er hatte auch ein eigenes Grimoarium begonnen, in dem er schon seit langem seine Erkenntnisse eintrug und all die Beschwörungsformeln, die ihm Erfolg gebracht hatten niederschrieb.
Der Sigillenreif war ein mächtiger Schutz. Nachdem Gilles herausgefunden hatte, wie er das Amulett handhaben musste, wagte er sich inzwischen auch an das einzigartige Grimoarium von Armadel heran, das die verschiedenen Ordnungen von Geistern beschrieb, deren Namen und Siegel zeigte und Formeln, mit denen man durch die Hilfe der angerufenen Wesen Bannzauber, Schadenszauber oder Todeszauber vornehmen konnte. Doch das Böse verlangte Blut und de Craon hielt ihn oftmals zurück, denn die Bauernkinder die Gilles zusammen mit seiner kleinen Schar Getreuer ab und an in der Nähe von Champtocé einfing, um einen der Zauber von Armadel zu versuchen, wurden von ihren Eltern vermisst und es entstanden bereits Gerüchte über einen Teufel, der unter der Festung hauste.
Gilles strich mit der Hand nachdenklich über die hauchdünnen Seiten von Abrahams Buch. Sie waren aus Baumrinde gemacht worden, denn Rinde überdauerte die Zeit besser als Pergament und fiel dem Hunger von Mäusen nur sehr selten zum Opfer. Er hatte den Fluch auf der ersten Seite der Handschrift auch gelesen und nur über ihn gelacht: Er war vielleicht kein Gelehrter und ganz sicher kein Priester oder blöder Pfaffe, aber er fühlte sich durchaus befugt, die große Arbeit um den Lapis mit allen Mitteln zu versuchen.
„Großvater, nachdem ihr herausgefunden hattet, dass der Jud Canches dem Flamel geholfen hatte, den Text und die Allegorien zu begreifen...warum sollen wir uns da mit diesem Rittersmann aus dem Süden aufhalten? Holt doch einen anderen Jud von Spanien oder treibt einen von den Konvertierten auf, die sich noch immer überall verstecken. Die wissen sicher eher die Bildnisse zu deuten, als dieser verträumte Schöngeist, der uns die Suppenschüssel leer frisst und mit feuchten Augen und verklärtem Blick über Gott und die Vollkommenheit von Seele und Geist doziert.“
De Craon schmunzelte. Gilles hatte nicht nur Verstand im Kopf, sondern auch Witz und eine scharfe Zunge. Dafür sah er ihm gerne seine kleinen Unvollkommenheiten und Fehler nach. Der junge Mann war inzwischen fünfzehn Jahre alt, aber Geschmack an den Weibern hatte er immer noch nicht gefunden, und das obwohl Jean ihm jede Gelegenheit dazu bot und ihm schon mehrfach gute Partien für eine Heirat vorgeführt hatte. Doch Gilles zog die Gesellschaft seiner kleinen Halunken oder die der Waffenleute von Champtocé vor und wenn es ihm nach Erleichterung war, dann holte er sich irgendeinen Bauernlümmel, den hinterher sowieso kaum einer vermisste…oder er teilte das Lager mit dem Hauptmann von Champtocé, Yves de Kerma’dhec, den er vergötterte und fast genauso innig liebte, wie ihn selbst.
De Craon seufzte bei dem Gedanken an dieses kleine Problem kurz auf, doch dann schob er es erneut von sich. Er nahm sich wieder einmal vor Gilles in ein oder zwei Jahren endlich energisch ins Gewissen reden...und es ihm gefiel oder nicht. Eine reiche Jungfer mit gutem Namen musste her und ab ins Bett, damit der Gilles einen Erben für das Vermögen de Laval-Craon-Montmorency zeugte. Dann antwortete er dem jungen Mann gutmütig und erklärte: „Claire de Saint Germain entstammt einer Familie, die seit den Tagen des ersten Kreuzzuges Handschriften über die Ars Alchimia nach Frankreich gebracht und übersetzt haben. Er ist für Deinen Geschmack vielleicht ein wenig zu philosophisch, doch glaube mir bitte: Der Mann versteht sein Geschäft und er weiß um die geheimen Lehren und Riten der Ungläubigen. Auch Flamel muss um sie gewusst haben…durch den Juden Canches. Es heißt, dass einst unweit der Stadt Mekka, die die Sarazenen heiligen, zur Zeit ihres Propheten Muhammad ein uralter Einsiedler mit Namen Ben Chasi gelebt hat. Dieser Weissager, Zauberer und Sternedeuter hat den Propheten der Sarazenen in der geheimen Kunst der Ars Alchimia unterrichtete. Als der Unterricht zu Ende war, schenkte Ben Chasi, Muhammad eine metallene Tafel, auf der die Formeln verzeichnet waren, deren Bedeutung der Prophet eben gelernt hatte. Ben Chasi eröffnete seinem Schüler damit die wahre Herkunft des Wissens; es stammte aus dem Lande Mizraims im alten Ägypten und war von dort aus nicht nur nach Chaldäa und Persien gelangt, sondern auch nach Indien und in jene Länder, wo die Sonne aufgeht. Auch den Griechen und den Römern waren diese Geheimnisse vertraut. Die Israeliten haben sie in der babylonischen Gefangenschaft kennengelernt, wo ihr Stammvater Abraham ein Schüler des Meisters der Meister, des Dreimal Großen Hermes Trismegistus geworden war. Abraham leistete Hermes den Schwur, dieses heilige Wissen –die Israeliten nennen es Kabbala- immer nur an wenige Auserwählte weiterzugeben. Durch Abraham und seine Schüler waren die Formeln schließlich bis zu den Wüstensöhnen gelangt und Ben Chasi, der Einsiedler wünschte, dass Muhammed seinerseits dieses Erbe weiterverbreitete und wahrte. Bald darauf verstarb der Einsiedler, und der Prophet würdigte den Eid, den er dem alten Lehrer geleistet hatte: Er lehrte im engsten Kreise seiner Anhänger das Geheimnis dieser heiligen Formeln. Abu Bekr, der erste Kalif, erbte schließlich die Tafeln des Ben Chasi. So verbreitete sich das uralte Wissen um den Lapis Philosophorum und seine Erschaffung bis nach Al Andalus. Du siehst, Gilles: Die Schlüssel zu unserem Manuskript sind allen bei den Orientalen – Juden und Sarazenen! Doch keiner dieser ungläubigen Ketzer vertraut Dir einfach so sein Wissen an, ganz gleich wie schrecklich Du ihn bedrohst oder erpresst. Saint Germain dagegen kennt diese Geheimnisse dank der Verwicklung seiner Familie in die Kreuzzüge. Seine Vorfahren haben lange Zeit im Heiligen Land gelebt. Vielleicht weiß er sogar, wie man das Buch des Propheten Muhammed –den Qur’an - deuten muss, um den Schlüssel von Ben Chasi wiederzuentdecken. In Outremer existiert eine Sekte, die Ahl al Haqq, über die man erzählt, sie seien auch Hüter dieses Wissens und man kann davon ausgehen, dass Saint Germains Vorfahren mit ihnen Kontakt hatten. Ich weiß, dass die Tempelritter so eng mit den Ahl al Haqq verbunden waren, dass manche von ihnen sogar ihren eigenen Glauben verleugneten und freiwillig die Lehren der Ungläubigen annahmen. Wenn es überhaupt möglich ist, das Buch des Leviterprinzen Abraham zu entschlüsseln und das Opus Major so durchzuführen, wie Meister Flamel es getan hat, dann ist es Claire de Saint Germain mit all seinen Kenntnissen und seiner Fähigkeit die Sprachen der Ungläubigen zu lesen und zu verstehen, der uns die beste Chance in die Hände legt. Er scheint im Israelitischen genauso bewandert, wie in der Sprache der Sarazenen…. Und im Augenblick ist der Mann willig und neugierig. Einen eingefangenen Juden musst Du zur Arbeit zwingen und schlau, wie die sind versuchen sie Dich sogar dann noch zu betrügen, wenn Du ihr Leben bedrohst. Und ein Sarazene würde eher sterben, als den Mund aufzumachen...oder ein kompliziertes, schwieriges Experiment vor den Augen seiner schlimmsten Feinde durchzuführen.“
Laval nickte de Craon zu: „Ihr habt gewiss recht, Grossvater. Er ist hier, er hat viele Erkenntnisse der Mauren und der Israeliten im Originaltext studiert und wenn wir es ihm nicht gestatten, dann kann er Champtocé niemals wieder verlassen...Benutzen wir ihn vorläufig, um zu sehen was er herausfindet. Doch daneben sollten wir nicht vergessen, das Eure Bibliothek noch andere Schlüssel enthält, mit denen es unter Umständen möglich ist, dem Geheimnis des Lapis ex Coelis auf die Spur zu kommen.“
De Craon erhob sich von dem Lehnstuhl, in dem er gesessen hatte und ging langsam und nachdenklich im Laboratorium auf und ab. Der Athenor lag still. Die langen Wandregale, in denen ordentlich aufgereiht die Substanzen standen, sahen verwaist und unberührt aus. Er nahm ein Stück weißer Kreide in die Hand und betrachtete es nachdenklich: „Du willst also versuchen, den Geist des Alchemisten Flamel aus dem Totenreich zu locken, Gilles?“
Der junge Mann nickte. Er würde mit seinen Halunken losreiten. Sie würden natürlich nicht im Gebiet seines Großvaters jagen, sondern durch den Wald und über die Grenze verschwinden. Dort konnte er finden, was er für den Versuch benötigte...unschuldige Kinderherzen. Für ihre Hilfe verlangten der Schattenfürst und seine Dämonen immer frisches Blut und reine Herzen. Gilles spürte, wie es anfing, in seinen Lenden zu pochen. Unschuldige, reine Kinderherzen! Er hatte schon seit Monaten keine mehr gehabt. Einen, der sich ihm nicht bereitwillig hingab und es mit sich geschehen lies und der ihm für diesen Gunstbeweis, die Nacht in seinem Bett verbracht zu haben auch noch die Hände küsste. Die, die sich willig nehmen ließen, erregten Gilles schon lange nicht mehr in dem gleichen Maß, wie die die vor Angst zitterten, um Gnade flehten, weinten und winselten.
Er hatte es zum ersten Mal in der Nacht von Azincourt getan, nachdem er den Barbaren aus Cornouailles totgeschlagen hatte. Sie waren damals mit ihrer Beute triumphierend von dem blutigen Feld verschwunden. Der Großvater hatte ihn gelobt und geherzt und er hatte ihm erlaubt, den Sieg mit den Waffenleuten zu feiern. Er hatte seinen ersten Mann eigenhändig totgeschlagen...ohne mit der Wimper zu zucken.
Sie hatten ihn in dieser Nacht als einen richtigen Mann in ihrem Kreis akzeptiert, mit ihm getrunken und gelacht. Und als de Kerma’dhec ihn umarmt, geküsst und gestreichelt hatte, da hatte er es zum ersten Mal gespürt, dieses Pochen. Es war so wild gewesen, dass er geglaubt hatte zu zerspringen. Doch de Kerma’dhec hatte ihn mit zu sich in sein Zelt genommen und ihn gelehrt, wie man sich Erleichterung verschaffte. Gilles hatte es genossen...auf die eine Art und auf die Andere. Hinterher hatte er es dann auch noch mit einem Mädchen ausprobiert, einer kleinen Küchenmagd aus dem Tross von Champtocé. Die Waffenleute hatten sie ihm gebracht. Zuerst hatte ihm einer von ihnen gezeigt, wie man es einem Weib richtig besorgte: Sie hatten alle zugeschaut. Der Mann hatte laut gegrunzt und gestöhnt, während die Kleine sich in de Kerma’dhecs Zelt unter seinen harten Stößen wie ein Aal gewunden und vor Lust geschrien hatte. Dann war Gilles an der Reihe gewesen. Die Kleine hatte noch ganz feucht, schlüpfrig und lüstern vor ihm gelegen und sie hatte sich viel Mühe gegeben ihm zu gefallen. Er hatte es genossen, obwohl es irgendwie nicht dasselbe war, wie mit einem echten Kerl. Ab und an, wenn sich niemand anders fand, dann lies er die Kleine aus der Küche von Champtocé holen und bestieg sie: Ihre prallen Brüste und ihr runder Hintern erregten ihn. Es gefiel ihr, wenn er sie hart anpackte. Sie ließ sich von hinten nehmen, wie eine Stute. Aber vor allem schreckte sie vor keiner neuen Erfahrung zurück, die man in einem Bett machen konnte. Gilles spürte schmerzhaft die Härte zwischen seinen Beinen. Allein schon der Gedanke an die Jagd hatte ausgereicht. Zuerst würde er sie holen lassen...für diese Nacht. Und morgen, beim ersten Tageslicht würde er mit seinen Halunken losreiten und sich richtig amüsieren. Der junge Mann atmete tief durch, um sich ein wenig unter Kontrolle zu bringen, dann grinste er de Craon an, dem die Erregung seines Enkels und die harte Schwellung in dessen enger Lederreithose natürlich nicht verborgen geblieben war.
„Der Mann aus Anjou kann ja auf seine Art arbeiten, und wir beide werden es nebenher zur Sicherheit noch auf unsere Weise versuchen“, er nahm dem Großvater das Stück Kreide aus der Hand und lies sich gutgelaunt auf den Knien nieder. Geschickt zog er die Linien eines Dreiecks der Kunst auf den Steinboden. In dessen Mitte zeichnete er einen Kreis. Dann schrieb er an jeder Seite des Dreiecks griechische Worte: Tetragrammon, Primeumaton und Anaphaxeton. Zuletzt spaltete er den Namen des Erzengels Michael in drei Silben und schrieb sie umgekehrt um den Kreis.
De Craon schüttelte belustigt den Kopf und wandte sich zum Gehen: „Ich werde Dich wohl nicht weiter stören, mein lieber Junge. Vergnüg Dich nach Herzenslust mit der Kleinen aus der Küche. Dir scheint es danach zu sein. Und morgen früh, bevor Du aufbrichst, denk daran zu mir zu kommen und einen alten Mann zu umarmen.“ Als Jean die schwere Eichentür zu seinem Laboratorium schloss, hörte er seinen Enkel bereits eine alten und bewährten Zauber murmeln, der einem Mann Ausdauer und einem Weib höllische Lust verlieh.
III
Sidonius hatte entgegen seiner früheren Pläne die kürzeste Strecke von Champtocé nach Concarneau gewählt und nicht die bequeme, gut ausgebaute Straße über Nantes und Vannes genommen. Während er sich in einem höllischen Tempo seinen Weg über Pisten und durch menschenleere Waldgebiete bahnte, die höchstens besonders tollkühne Kriegsleute oder verzweifelte Gesetzlose einschlugen, wenn sie keine andere Möglichkeit mehr hatten ihren Verfolgern zu entkommen, beglückwünschte er sich mit jeder zurückgelegten Leuge dazu, dass er damals in Paris den Mut gefunden hatte ein wirklich ausgezeichnetes Pferd zu stehlen. Das Tier war zäh, ausdauernd und trittsicher, wie ein Maultier und es trug seinen Reiter von Sonnenaufgang bis zum Einbruch der Nacht, ohne sich je zu beklagen.
Der Herzog von Cornouailles war im ersten Augenblick zwar leise verwundert gewesen an einem sonnigen Spätsommermorgen in der Halle seines Palas einen Mann anzutreffen, den er eigentlich wohlversorgt und sicher am Collegium Sorbonianum in Paris geglaubt hatte, aber er zögerte trotzdem nicht, den erschöpften, ungewaschenen und zerrissen wirkenden Sidonius sofort anzuhören. Nachdem der Benediktiner in wenigen, präzisen Worten erläutert hatte, warum er Paris hinter sich gelassen hatte, um alleine und unbewaffnet einen weiten und gefährlichen Ritt durch ein von Krieg zerrissenes Land zu unternehmen, wurde Ambrosius Arzhur mit einem Mal sehr bleich und sehr still. Als er den ersten Schrecken überwunden hatte, rief er nach dem Truchsess.
Sidonius staunte nicht wenig, als er am nächsten Morgen einem Mann vorgestellt wurde, in dem er mühelos den unheimlichen, raubvogelartigen Professor Anselmus von Vannes erkannte, dem er bei der Grablegung von Nicolas Flamel zum ersten Mal begegnet war. Doch Ambrosius Arzhur de Cornouailles gab ihm einen ganz anderen Namen.
Inquisitoren verfolgten Guy de Chaulliac seit ein paar Jahren erbarmungslos, weil er es einmal gewagt hatte, die Kirche direkt herauszufordern und ohne eine erzbischöfliche Genehmigung an der Universität von Montpellier eine öffentliche Autopsie an einem Hingerichteten vorzunehmen. Auch ohne diese Provokation hatte er damals bereits schlechte Karten gehabt: Die Chirurgie wurde nicht als gleichberechtigt mit der Medizin angesehen und Chirurgen galten als unziemlich und unehrenhaft. Außerhalb Italiens konnten Wundärzte nur noch in Montpellier eine eigene Universitätsausbildung genießen. Ansonsten blieb ihnen lediglich, bei einem fahrenden Bader oder Feldscher in die Lehre zu gehen und deren Ruf war für gewöhnlich noch miserabler, als der eines Chirurgen. Als sogenannten Leichenschänder erwartete Chaulliac bereits von weltlicher Seite der Richtblock. Als Mann der Wissenschaften, der öffentlich Thesen vorgetragen hatte, die der kirchlichen Hierarchie verhasst waren, musste er zusätzlich damit rechnen, dass man im Falle seiner Festnahme die Autopsie von Montpellier eilig vergessen würde, um ihm sogleich den Prozess wegen Häresie zu machen, womit Guy der rotglühende Scheiterhaufen gewiss war.
Sidonius konnte nur annehmen, dass Chaulliac selbst an der großen und verhältnismäßig anonymen Pariser Universität am Ende der Boden unter den Füssen zu heiß geworden war. Er hatte verstanden, dass der Mann sich schon verhältnismäßig lange im Fürstentum von Ambrosius Arzhur aufhielt, wo er nicht nur Schutz vor seinen Verfolgern fand, sondern offensichtlich auch die äußerste Wertschätzung und Protektion des Herrschers hatte.
Ambrosius und sein verfemter und etwas unheimlich wirkender Freund hatten am Anfang lange die Köpfe zusammengesteckt und leise miteinander getuschelt. Sidonius fühlte, dass sie in diesen Stunden abgewogen hatte, wie weit man ihn ins Vertrauen ziehen konnte. Inzwischen hatte der junge Benediktiner begriffen, dass er seine Prüfung wohl mit Auszeichnung bestanden hatte: Nicht nur waren einen Tag nach Chaulliacs Ankunft und seinem vertraulichen Gespräch mit dem Herzog bereits Kuriere auf den besten Pferden aus den Ställen von Concarneau in alle vier Himmelsrichtungen losgaloppiert. Auch mehrere schnelle und bis an die Zähne bewaffnete Kriegsschiffe stachen in See. Die Wochen, die auf diese geschäftigen Tage folgten, waren dann allerdings ereignislos und ruhig.
Doch Sidonius genoss eine geradezu seltsam anmutende, großzügige Gastfreundschaft, die so gar nicht seinem Stand entsprach: Bei den gemeinschaftlichen Abendmählern in der großen Halle saß er nicht mit den Dienstboten und Gefolgsleuten, sondern nahm einen Platz neben Guy de Chaulliac an der herzoglichen Tafel ein. Und Ambrosius Arzhur selbst ermutigte ihn dazu, sein Studium, dass er wegen des Diebstahls von Saint Jacques gezwungenermaßen unterbrochen hatte, wieder aufzunehmen. Er hatte ihm ohne zu zögern seine beeindruckende Bibliothek geöffnet, in der sich eine erstaunlich große Sammlung seltener und seltsamer Manuskripte befand. Wenn der junge Mann nicht gerade seinen eigenen Interessen nachhing, wurde er oft in die Frauengemächer gerufen, wo Maeliennyd Glyn Dwyr, Ambrosius’ walisische Gemahlin sich mit einem eigenen, nicht weniger erstaunlichen und seltsamen Hofstaat umgab. Sidonius begegnete dort zwar auch einigen edlen Damen und ein paar jungen Frauen aus den besten Familien von Cornouailles, doch die wichtigste Gruppe bestand aus einem guten Dutzend hochgelehrt wirkender, steinalter Männer und Frauen. Er begriff schnell, dass Maeliennyd Glyn Dwyr den üblichen, höfischen Vergnügungen kaum Aufmerksamkeit schenken mochte und nur ab und an dem Drängen der jüngeren Frauen nachgab, um zur Jagd zu reiten oder Zeit mit irgendwelchen vergnüglichen Spielen oder kurzweiliger Musik und Poesie zu vergeuden. Die Herzogin war eine ernste, streng wirkende Frau, die in ihrer ganzen Art stark an seinen Freund Sévran erinnerte. Sie disputierte mit den alten Männern und Frauen und war offensichtlich in den Wissenschaften genauso bewandert, wie in der Philosophie.
Auf den weichen Seidenkissen und bequemen Lehnstühlen der Kemenate lernte Sidonius in kurzer Zeit mehr über Aristoteles, Platon oder Plinius, als in all den Vorlesungen, die er am Collegium Sorbonianum je besucht hatte. Und er machte überraschende Bekanntschaften mit naturwissenschaftlichen Werken obskurer Gelehrter aus aller Herren Länder, die er an der Universität und während seines Studiums der Theologie und der Philosophie höchstwahrscheinlich niemals anzufassen gewagt hätte. Auch verheimlichten Maeliennyd Glyn Dwyr und ihre Vertrauten ihm – dem Freund ihres jüngsten Sohnes – nicht, dass die sogenannten Ars Notoria am Hof von Cornouailles blühten.
In der Kemenate sprach man genauso über das Auslegen von Träumen, wie auch über Formen der Magie, in denen die geheimnisvollen Kräfte der Natur eine große Rolle spielten und die der junge Benediktiner aus dem Bauch heraus, als dem Reich der Legenden entstammend abgetan hätte, wenn er nicht mit eigenen Augen den Ernst der Debattierenden beobachtet hätte. Intuitiv wusste er, das er es hier mit Angehörigen der geheimnisvollen weißen Bruderschaft von Brocéliande zu tun hatte, zu der auch Sévrans alter Lehrer Aodrén und der Herzog von Cornouailles selbst gehörten.Gewiss, alles war ein bisschen fremd und sonderbar, doch er konnte nicht behaupten, dass diese Gespräche unheimlich waren, oder ihm in irgendeiner Form Angst einflößten, denn er erinnerte sich noch sehr gut daran, wie seine eigene Mutter, als er noch ein Kind gewesen war auf ähnliche Zauberkünste zurückgegriffen hatte, um seine kleinen Krankheiten und Verletzungen zu heilen, oder um dafür zu sorgen, dass der Hausgarten reiche Ernte schenkte und die Kuh immer genügend Milch gab. Und dann war da natürlich auch noch sein Freund Sévran...
Gelegentlich erholte sich Sidonius von der herzoglichen Gastfreundschaft in Gesellschaft seiner Mutter und begleitete sie bei Besuchen von Verwandten, Freunden und Bekannten in der Stadt Concarneau und in der Umgebung. Allerdings fühlte er sich bei diesen geselligen Zusammenkünften nicht immer ganz wohl, denn diejenigen, die sich noch gut an den kleinen Fischerjungen Szenec erinnerten, behandelten ihn in seiner strengen, schwarzen Kutte mit einer verwirrenden Mischung aus Ehrfurcht und Scheu und die anderen beobachteten ihn mit neugierigen Augen, wie ein besonders exotisches und seltenes Tier. In diesen Augenblicken wurde ihm immer bewusst, wie groß die Kluft war, die die Klosterschule von Hennebont und das Collegium Sorbonianum zwischen ihm und seiner Vergangenheit aufgerissen hatte. Daran änderte auch der sichtbare Stolz seiner Mutter über seinen gesellschaftlichen Aufstieg nur wenig.
Sidonius’ Verwunderung über seine eigene Situation am Hof von Concarneau wurde noch zusätzlich verstärkt, als Ambrosius Arzhur ihn an einem schönen Sommerabend zu einem Spaziergang in den Gärten der Ville Close einlud, alleine und unter vier Augen. Nicht einmal Chaulliac war irgendwo zu sehen und selbst der allgegenwärtige, diensteifrige Truchsess des Herzogs machte sich rar, nachdem er den jungen Mann zu seinem Herren gebracht hatte.
Ambrosius Arzhur wählte eine gemütliche, kleine Steinbank unter einem schönen, rot blühenden Rosenbusch als den besten Ort, um seinen jungen Begleiter darüber aufzuklären, wen er mit solch großem Aufwand nach Cornouailles holen lies, um über den Diebstahl des Flamelschen Manuskript zu beratschlagen. Die Geschichte, die der Herzog erzählte, war lange, verwirrend und gelegentlich so unheimlich, dass sie fast unglaublich schien. Es war eine Reise zurück in der Zeit...weit zurück in der Zeit und in die prächtigen Gärten und auf die blutigen Schlachtfelder von Al Andalus, in den Tagen der Blüte und des Niedergangs der maurischen Herrschaft.
Dieser geheime Bund, dem außer Ambrosius und seinem Freund Guy de Chaulliac noch neunzehn weitere Männer und Frauen angehörten, verbarg sich hinter dem Namen eines einstmals berühmten Ritterordens: Der Orden Santiago vom Schwerte. Diese Ritterschaft war von König Alfonso VIII. von Kastilien gegründet worden, um den unablässigen Pilgerstrom über den Jakobusweg nach Santiago de Compostella vor den Übergriffen maurischer Krieger und den Überfällen allgegenwärtiger Räuberbanden in der wilden Gebirgswelt von Astrurien und Kantabrien zu schützen.
Es war eine dunkle und hoffnungslose Zeit gewesen: An allen Fronten häuften sich die Rückschläge und Niederlagen der christlichen Fürsten gegen den Islam. Der zweite Kreuzzug ins Heilige Land war gänzlich gescheitert, nachdem zuerst die deutschen Kreuzfahrer in Anatolien in einen Hinterhalt geraten und vollständig aufgerieben worden waren und dann die Franzosen direkt nach ihrer Landung von einem ähnlichen Schicksal ereilt wurden, so dass drei Jahre später nur ein jämmerlicher und demoralisierter Haufen Jerusalem erreichte. Als auch noch der Versuch Damaskus zurückzuerobern in einem gewaltigen Blutbad endete, verließen die letzten Überlebenden gedemütigt und erschüttert Outremer und überließen die dort ansässigen Christen und Ritterorden ihrem Schicksal. Als Folge griffen die Truppen von Saladin gnadenlos sämtliche verbliebenen Stützpunkte und Trutzburgen der Europäer im Heiligen Land an: Einer seiner Feldherren - Schirukh von Homs - nahm Kairo ein und besetzte ganz Ägypten. Die verzweifelten Bitten um Hilfe gegen die Sarazenen, die der Patriarch von Jerusalem, Amalrich de Nesle und der Erzbischof von Cäsarea an die europäischen Herrscher richteten, stießen nach dieser letzten Demütigung lediglich auf taube Ohren. Der misslungene, zweite Kreuzzug hatte einen riesigen Blutzoll auf Seiten der europäischen Adelsfamilien gefordert. Die Ränge ihrer Vasallen und Kriegsleute waren erbärmlich ausgedünnt. Niemand konnte oder wollte noch zu einem weiteren Kreuzzug gegen die Sarazenen aufrufen Vier Jahre später landete zwar Graf Tankred von Lecce mit einer Gruppe Gefolgsleute in Outremer und der Konflikt mit den Sarazenen flammte vor Alexandria erneut auf, doch es musste erst zur katastrophalen Niederlage von Hattin und zum Fall von Jerusalem im Jahr 1187 kommen, um endlich die Lethargie der christlichen Herrscher Europas zu durchbrechen und Phillip II. von Frankreich, Friedrich Barbarossa den Stauffer und Richard Coeur de Lion von England zusammenzubringen, um ein mehr als dreihundertfünfzigtausend Mann starkes Kreuzfahrerheer aufzustellen und über das Mittelmeer zu schicken, damit endlich Saladin Einhalt geboten werden konnte.
Abgesehen von der Demütigung des zweiten Kreuzzuges erklärte sich das Desinteresse am Schicksal von Outremer allerdings zum Teil auch mit der Situation auf der iberischen Halbinsel: Der dortige Kampf gegen die Sarazenen war ein genauso heiliger Krieg, wie der Konflikt auf der anderen Seite des Mittelmeers, doch in diesem Fall häuften sich nicht die Niederlagen, sondern die Erfolge. Die Christen profitierten davon, dass die maurischen Fürsten untereinander ziemlich zerstritten waren und wenn es ihnen recht und billig schien, zeitweise sogar ganz schamlos mit ihren Feinden zusammenarbeiteten, nur um einem ihrer eigenen Glaubensbrüder ein Bein zu stellen.
Hier auf der iberischen Halbinsel war es einfacher und billiger den ständigen Aufrufen irgendwelcher Päpste im fernen Rom zu folgen, die den Heiligen Krieg forderten. Man konnte sich sozusagen vor der eigenen Haustür Gottes Gnade, Sündenerlass und seiner Seele Seligkeit erkämpfen und gleichzeitig auch noch finanziell ein gutes Geschäft machen. Traditionell bestanden enge wirtschaftliche und persönliche Verbindungen zwischen den Christen und den Muselmanen und der Kampf gegen die Araber hielt die christlichen Könige nicht davon ab, Handel mit ihnen zu treiben und gleichzeitig auch noch untereinander Krieg zu führen. Nicht einmal die allerchristlichsten Heerführer, wie zum Beispiel der Baske Don Rodrigo Diaz de Bivar, den man auch „El Cid“ nannte, scheuten davor zurück aus Gründen eigener Machtpolitik oder schlichtweg um des Goldes Willen Verträge mit den Königen der Taifas abzuschließen, um zeitweilig auf Seite der Muselmanen zu kämpfen und bei dieser Gelegenheit gleich noch ein paar Privatfehden zu regeln.
Alles in allem: Die iberische Halbinsel und die Reconquista erwiesen sich als weitaus ertragreicher und interessanter, als der mühsame und höllisch kostspielige Krieg im Heiligen Land selbst.
Auch die Ritter von Santiago kehrten dem Camino kaum fünf Jahre nach ihrer Gründung und Bestätigung durch eine Bulle von Papst Alexander den Rücken, um sich eifrig an dem widerwärtigen Spiel um Gold und Macht zu beteiligen. Doch selbst die grauenhaftesten Blutvergießen auf beiden Seiten vermochte die traditionelle Toleranz zwischen Mauren, Christen und Juden nicht zu zerstören. Spanien war einfach schon zu lange ein Land, in dem drei Religionen zusammenlebten, insbesondere in jenen Gebieten, in denen die maurische Herrschaft immer noch unangefochten war.
Inmitten der Kämpfe setzte sich ein reger intellektueller Austausch fort und zahllose Gelehrte aus dem nördlichen und östlichen Europa zogen auch weiterhin unbekümmert über die Pyrenäen, um in Granada, Cordoba oder Toledo ungehindert durch die Zwänge der römischen Kirche zusammen mit muslimischen, jüdischen und mozarabischen Gelehrten das kulturelle Erbe des antiken Griechenlands und des Islam zu studieren.
Mehr als eine halbe Million Schriftrollen und Manuskripte eröffneten eine völlige neue und faszinierende Welt für diese gelehrten Männer, die zuhause oftmals mit schwierigsten Hindernissen und bigotten Beschränkungen kämpfen mussten, um nicht im Kerker oder gar auf dem Scheiterhaufen zu landen. Die Spannbreite der Übersetzungen reichte von landwirtschaftlichen Handbüchern bis hin zur Astronomie Mathematik und Philosophie. Sogar religiöse islamische und jüdische Schriften wurden plötzliche jedem, der das Lateinische lesen konnte zugänglich und die gut organisierte Übersetzungsschule in Toledo sorgte dafür, dass das gesamte Medizinwissen der Araber den europäischen Naturwissenschaftlern ohne irgendwelche Einschränkungen oder Auflagen zur Verfügung stand. Diese Zusammenarbeit eröffnete ungeahnte, wunderbare Möglichkeiten und sogar eine Gruppe von Ordensritter von Santiago, die in ständigem Kontakt mit Mauren und auch mit Juden standen, legte plötzlich von einem Tag auf den anderen das Schwert nieder. Doch in ihrem Fall war es nicht nur die unermessliche Schatzkammer des Wissens in die sie geblickt hatten und von der sie verzaubert worden waren...
Es begab sich zu der Zeit, als bei Navas de Tolosa, einem kleinen Ort im Norden der Provinz Jaén, am Südhang der Sierra Morena ein riesiges Heer von zweihundertfünfzigtausend maurischen Kriegern aufmarschierte, um sich wieder einmal christlichen Herrschern entgegenzustellen.
Irgendein Erzbischof hatte es geschafft, die üblicherweise verfeindeten Könige von Kastilien, Léon, Navarra und Aragón zusammenzubringen und sie hatten einen Pakt unterschrieben, der sie dazu verpflichtete Seite an Seite zu kämpfen. Die Almohaden-Krieger wurden von Kalif Muhammad an-Nasir angeführt, der seine übliche Verachtung für die verfeindeten Könige, die nun erstaunlicherweise Freundschaft und Bündnis proklamierten nicht verbarg, als er die erbärmlich kleine Schar erblickte, die der Ordensgründer von Santiago, König Alfonso VIII. von Kastilien zusammen mit seinen neuen, königlichen Freunden in die Sierra Morena geführt hatte.
Muhammad an-Nasir befahl seinem riesigen Heer einen Lobgesang zu Ehren Allahs anzustimmen, der ihnen an diesem Tag einen leichten Sieg über ihre Feinde schenken würde, doch genau in diesem Augenblick löste sich aus dem erbärmlich kleinen Haufen auf der anderen Seite des Feldes eine Gestalt. Sie trug über dem Kettenhemd einen Waffenrock, der dem Almohaden-Anführer selbst über diese Entfernung deutlich zeigte, dass sich ein Kirchenfürst der Christen seinen Linien näherte.
Muhammad an-Nasir brach in schallendes Gelächter aus, als der Erzbischof von Santiago de Compostella Pedro Muñoz, die Streitaxt hoch erhoben, alleine auf die Übermacht der Wüstenkrieger zu galoppierte. Auch in den Reihen der Christen hörte man Lachen und ungläubige Ausrufe. Doch plötzlich, als Muñoz die halbe Strecke zurückgelegt hatte und sein Pferd aus dem Galopp anhielt, geboten Alfonso von Kastilien und die drei anderen Könige ihren Vasallen und Waffenleuten zu schweigen.
Die Almohaden-Krieger brüllten dem Erzbischof Beleidigungen entgegen, versuchten ihn zu provozieren, oder schimpften ihn einen Feigling, doch der Mann reagierte nicht. Er senkte nur ganz langsam seine Waffe. Dann sprach er laut, und für beide Seiten gut hörbar ein einziges Wort in der Sprache der Mauren. Die Christen verstanden ihn nicht, doch Muhammad an-Nasir und viele seiner Männer erbleichten. Einige wendeten sogar ihre Pferde, um sich durch die Schlachtreihen zurück hinter die Linien zu drängeln.
Wie aus dem Nichts erschien plötzlich an der Seite des Erzbischofs von Santiago de Compostella ein gewaltiges, bleiches Ritterheer auf Schlachtrössern, die aussahen, als ob sie erst Augenblicke zuvor aus ihren Gräbern auferstanden waren – farblos, erbärmlich und mager. Und dann hob Muñoz zum zweiten Mal seine Streitaxt und deutete auf Muhammad an-Nasir und seine Almohaden-Krieger. Wie ein Mann setzte sich das bleiche Ritterheer in Bewegung und beide Kriegsparteien begriffen endlich, was in der Mitte des Schlachtfeldes geschehen war und was der Erzbischof getan haben musste, um an diesem Tag einen Sieg gegen die maurische Übermacht zu erzwingen.
Viele der Sarazenenkrieger erwachten aus der ersten Erstarrung und rissen ihre Rösser herum, um zu fliehen. Doch der Aufruhr in den hinteren Reihen der Schlachtaufstellung machte jegliche Flucht unmöglich und noch bevor der allgemeine Tumult das Heer von Muhammad an-Nasir auflösen konnte, versank es auch schon in der schrecklichen Armee von Wiedergängern und Spektren aus längst vergangener Zeit, die Pedro Muñoz durch eine unaussprechlich abscheuliche, schwarze Magie heraufbeschworen hatte.
Der Untergang der Almohaden dauerte nur wenige Augenblicke und der Südhang der Sierra Morena glich einem Massengrab, noch bevor die Mittagssonne im Zenit stand. Muhammad an-Nasir gelang es im letzten Moment, sich zusammen mit einer Handvoll Getreuer in Sicherheit zu bringen. Doch damit war das Grauen noch lange nicht zu Ende. Als kein einziger Maure sich mehr auf dem schrecklichen Feld regte, forderten die dunklen Mächte, die an diesem Tag bereitwillig Kastilien, Aragón, Navarra und León ihre Hilfe gewährt hatten den Preis für den Sieg.
Pedro Muñoz war zu erschöpft von seinem schwarzen Zauber, um die Spektren noch zu kontrollieren, und anstatt nach getaner Arbeit wieder zurück in ihre kalten, feuchten Gräber zu verschwinden, wandten die zornigen Schattengestalten ihre grauenhaften Höllenpferde um und warfen sich mit derselben Grausamkeit und Bosheit, die zuvor das Ende der Almohaden-Armee gewesen war gegen die christlichen Ritter, die die vier verbündeten Könige mit in die Sierra Morena gebracht hatten. Für ihre schreckliche Hilfe forderten sie nun den üblichen Preis in Blut.
Die letzten Augenblicke der Christen bei Navas de Tolosa waren genauso grauenhaft, wie die der Mauren und lediglich eine Handvoll Ritter von Santiago, die König Alfonso als persönliche Leibwache gedient hatten entgingen dem blutigen Opfer. Überrascht bemerkten sie, das ihr Großmeister von diesem schrecklichen Schauspiel ganz und gar nicht beeindruckt war, sondern es sehr gelassen mitverfolgte, ganz so, als ob er in dem Augenblick, in dem der Erzbischof sein Wort der Macht gesprochen hatte, gewusst hatte, wie viel dieser Sieg ihn kosten würde.
Auch die drei anderen Könige beobachteten zynisch und ruhig, wie die Spektren ihre Getreuen niedermachten und sie mit sich in die Abgründe der Finsternis rissen. Keiner der vier schien dem Erzbischof von Santiago wegen seiner abscheulichen, nekromantischen Zauberei auch nur den geringsten Vorwurf zu machen. Ganz im Gegenteil. Als das Schattenheer sich endlich mit dem Blutgeld des Tages zufrieden in Luft auflöste, lobten und herzten sie ihn gemeinsam für seinen schlauen Streich und beglückwünschten sich gegenseitig, dass keine Zeugen übrig waren, die berichten konnten, um welchen Preis die vier christlichen Könige die Almohaden endgültig zerbrochen hatten.
Auch dem geringsten und niedersten Tölpel hätte ein einfacher Blick auf den Südhang der Sierra Morena gereicht, um zu verstehen, das die maurischen Herrscher von Al Andalus sich niemals wieder von dieser Niederlage erholen würden. Am Tag von Navas de Tolosa hatten die vier Könige um den Preis ihrer Seelen und des guten Blutes ihrer Ritter den Samen zum Untergang der Sarazenen gepflanzt. Nun konnten sie sich zurücklehnen und abwarten...und wie die Aasgeier den geschwächten Leib von Al Andalus zerreißen und untereinander aufteilen.
Ohne auch nur einen weiteren Gedanken an den christlichen Blutzoll zu verschwenden, begab man sich gemeinsam mit dem listigen Erzbischof Muñoz in das prächtige Zelt von König Alfonso, um den Sieg zu feiern. Nicht einmal der süßliche, ekelhafte Verwesungsgeruch, der bei Einbruch der Nacht von der Sierra Morena herüberwehte konnte die gute Laune der Verschwörer trüben und Pedro Muñoz hielt sich nicht zurück, sich zu brüsten, wie ihm dieser böse Streich so mühelos gelungen war und wie dumm die Mauren doch waren, jedem der es lernen wollte an ihrer berühmten Schule in Cordoba die Geheimnisse ihrer Schwarzen Kunst zu vermitteln.
Nicht nur der fatalistische Glauben der Sarazenen machte sie für Wahrsagekünste empfänglich; sie pflegten die geheimen Wissenschaften eifriger als irgendein anderes Volk und waren gewiss in ganz Europa die geschicktesten Lehrer und Jünger der Zauberei. An der Schule von Cordoba lehrten zwei Professores der Astrologie, drei der Nekromantie, Pyromantie und Geomantie und einer der Ars Notoria. Sie lehrten Muslime, Juden und Christen ohne Unterschied. Sie alle hielten tägliche Vorlesungen und er –Pedro Muñoz – hatte sich in seiner Jugend nicht zurückgehalten, seinen Durst nach verbotenen Kenntnissen am Busen der Schlange selbst zu stillen.
Dann brach der Erzbischof in schallendes Gelächter aus und erzählte weiter: Die dummen Sarazenen gestatteten nicht nur jedem diese wunderbare schwarze Schule zu besuchen und dort wahre Meisterschaft zu erlangen...und das obwohl auch bei den Mauren die Zauberei mit dem Tode bestraft wurde. Sie gestatteten es auch, dass all ihre schwarzen Bücher ohne Unterschied von den Übersetzern der Schule von Toledo in die lateinische Sprache und in die Vulgata übersetzt wurden, damit auch wirklich jedermann sie lesen und benutzen konnte.
Der Erzbischof war so stolz auf sich und seine Schlauheit, dass er es nicht einmal bemerkte, wie die kleine Gruppe der überlebender Santiago-Ritter das Zelt ihres Großmeisters König Alfonso VIII. verließen, um draußen im Schutz der Sterne und des zunehmenden Mondes mit ihrem Blut und auf ihr Leben einen heiligen Eid zu schwören.
Was diese Ritter am Tag von Navas de Tolosa gesehen hatten, hatte nicht nur ihren christlichen Glauben in seinen Grundfesten erschüttert, sondern auch den Respekt für ihren Großmeister Alfonso von Kastilien und die anderen sogenannten christlichen Könige zerstört, die bewiesen hatten, dass sie um den Preis eines Sieges sogar ohne zu zögern mit den Mächten der Hölle paktierten. Es hatte ihnen vor allem auch gezeigt, wie gefährlich es war, gewisse Dinge vollkommen skrupellos unter den Menschen zu verbreiten, nur weil der Zeitgeist es gerade gestattete.
Sie beschlossen darum, mit denen, die sie vor dem Grauen von Navas de Tolosa noch bereitwillig und ohne zu Zögern alleine wegen ihres Glaubens totgeschlagen hätten in Verbindung zu treten und anstelle des Kampfes suchten die überlebenden Santiago-Ritter nun einen vorsichtigen Austausch. Doch umso mehr sie von den geheimen Wissenschaften lernten, die zu bekämpfen und auszumerzen sie sich in der Nacht von Navas de Tolosa geschworen hatten, umso weniger waren sie gewillt, die uralten Schriftrollen und Manuskripte, die sie in ihren Besitz bringen konnten, einfach zu zerstören. Neben jenen grauenvollen und unheimlichen Grimoarien, die bis zum Rande mit schwarzer Magie angefüllt waren, stießen sie auch auf viele Werke, die den Aufmerksamen und im Geiste wachen den Weg zu den höchsten Geheimnissen der Menschheit öffneten. Doch diese wertvollen Schätze bargen in sich die gleichen Gefahren, wie die üblen Machwerke der Finsternis. Obwohl weder böse noch schlecht, boten auch sie denen, die von Selbstsucht und Machthunger getrieben wurden furchtbarer Schlüssel, um die Tore hinunter in die tiefsten Abgründe der Dunkelheit der Hölle zu öffnen und Wege in die Verdammnis aufzutun. Trotzdem beschlossen die Ordensritter, dass dieses Wissen um keinen Preis verloren gehen durfte, den sie fühlten intuitiv, das irgendwann einmal, wenn Zeit und Menschheit dafür reif geworden waren, mit ihrer Hilfe wunderbare Dinge möglich werden konnten...zum Nutzen aller Geschöpfe Gottes.
Nach dem Tod ihres ersten Großmeisters, jenes verruchten Alfonso von Kastilien, wählten sie darum in aller Stille einen Mann aus ihren eigenen Reihen, der weder von den Ränkespielen der Politik, noch von der Gier nach persönlicher Macht getrieben wurde und sie öffneten ihren Orden für ihre jüdischen und maurischen Freunde, während sie gleichzeitig den wahren Grund seiner Existenz vor den Augen der Welt verbargen. Ganz besonders nahmen sie sich vor den Fürsten der römischen Kirche in Acht, denn Navas de Tolosa hatte ihnen bewiesen, dass sich unter jenen, die Gottes Wort für sich beanspruchten oftmals die übelsten Diener der Finsternis verbargen. Sie erkannten genau, das hier –sollte das Geheimnis des Ordens von Santiago jemals offengelegt werden – ihre schrecklichsten und unerbittlichsten Feinde waren.
Langsam kamen die Ritter von Santiago zu der Erkenntnis, dass eine höhere Weisheit nur dann errungen werden konnte, wenn man sich frei machte von dem Ballast seines bisherigen, religiösen Glaubens, der meist nur auf Überlieferungen und Legenden ruhte und keiner sachgemäßen Kritik standhielt. In vielen der Schriften, die sie ausfindig gemacht und in ihren Besitz gebracht hatten, um sie sorgfältig an einem geheimen Ort aufzubewahren, stießen sie auf Hinweise und Fingerzeige, dass einst in grauer Vorzeit und in längst vergessenen Reichen das genaue Studium der Maße der Erde und der Laufbahn der Planeten den Weisen dieser vergessenen Völker ermöglicht hatte, das Mysterium der Seele und ihre Unsterblichkeit zu ergründen und mit diesem Wissen Tore zwischen den Welten zu öffnen, um zu Herren der Zeit zu werden.
Der Weg, den die Mitglieder des Ordens von Santiago sich zu gehen entschlossen hatten, war nicht leicht. Er führte sie zu den höchsten Gipfeln der menschlichen Erkenntnis, in eine fast vollkommene Einsamkeit ihres Denkens, frei und auch unerreichbar für die vielen hemmenden Suggestionen, die die Welt durchfluteten. Je weiter sie ihre okkulten Studien vorantrieben, desto sicherer wurden sie in ihrer Überzeugung, dass sie auf dem richtigen Weg waren und die Abgründe der Tiefe schrecken sie nicht mehr. Sie hüllten sich in Schweigen gegenüber den Unwissenden, denn ihre geschlossene Bruderschaft war ihnen genug.
Vor ewigen Zeiten war jenes Wissen, auf das sie gestoßen waren noch das Gemeingut aller Rassen und aller Menschen gewesen. Aber die Menschheit hatte sich vorwärts und abwärts zugleich bewegt, fort aus der Sphäre reiner Göttlichkeit und hinab in die Materie. Anstatt sich mit der Unsterblichkeit ihrer Seele und deren Wiedergeburt zufriedenzugeben, begannen die Menschen durch magische Handlungen zu versuchen, einen ebenso unsterblichen Körper zu erhalten, der den Fluss der Zeit überdauern würde. Das Wissen um die Tore zwischen den Welten und die Pforten der Zeit, das in den ersten Menschenrassen noch durchaus harmlos gewesen war, blieb es nicht mehr, als der physische dem geistigen Körper gegenüber zu dominieren begann.
Der Fall dieser Rassen, die in grauer Vorzeit gelebt hatten, und den die törichten Fürsten der christlichen Kirche den Sündenfall nannten, war damals eine Notwendigkeit in der Entwicklung des großen Ganzen gewesen, als die höheren Mächte erkannten, dass von nun an das magische Wissen um die Tore der Zeit nur wenigen Auserwählten und Eingeweihten gehören durfte. Darum ließen sie es zu, dass die alten Reiche sich selbst vernichteten und in den Fluten des Meeres versanken. Doch einigen wenigen Flüchtlingen dieser großen Katastrophe gelang es das alte Wissen zu retten und es für sich selbst und für ihre für würdig befundenen Nachfolger zu bewahren.
Die üblichen kirchlichen Lehren und Religionen bedeuten den Rittern von Santiago die in der Nacht von Navas de Tolosa ihren Eid geschworen hatten nichts mehr. Für sie gab es weder einen persönliche Gott, noch die Lehren des Christentums, des Islams oder des Judaismus. Auch gegen andere Religionslehren waren sie immun geworden, denn sie hatten gelernt, dass die Gottheit, ganz gleich, wie man sie nannte ein unerreichbares Ziel und Jenseits von Gut und Böse war. Spekulative Phantastereien lehnt sie strikt ab und versuchten auch bei den schwersten problematischen Fragen auf dem Boden der Wirklichkeit und der verstandesmäßigen, intellektuellen Durchdringung zu bleiben. Da in diesen Tagen die Macht der Templer immer größer wurde und viele junge Adelige aus ganz Europa diesem Orden beitraten, zogen sie sich mit ein paar fadenscheinigen Bemerkungen über einen Mangel an Kämpfern zuerst aus dem schmutzigen Geschäft des Heiligen Krieges zurück, um nur noch über die Sicherheit der Pilger auf dem Camino nach Compostella zu wachen. Dann entsagten sie ihren riesigen Besitzungen in Murcias und Andalusien und verließen ihr altes Hauptquartier, die Festung von Uclés im Herzen von Kastilien. Sie wählten sich ein vollkommen unzugängliches und uneinnehmbares Adlernest knapp unterhalb des Gipfels des Monte Ori im Tal von Roncal, wo sie ihr neues Hauptquartier aufschlugen.
Wo die Herren des Tempels in den nächsten fast einhundert Jahren alle Hebel in Bewegung setzten, um keiner weltlichen oder kirchlichen Macht mehr Gehorsam zu schulden, bemühte sich der Orden von Santiago öffentlich fügsam das Haupt zu beugen, zu schweigen und zu gehorchen. Und anstatt, wie die Tempelherren in ganz Europa und im Heiligen Land als Diplomaten und als Mittler zwischen Fürsten und Monarchen aufzutreten, geleiteten sie vor den Augen der Welt nur noch die müden, hungrigen und abgerissenen Gestalten mit der Jakobsmuschel am Pilgerstab sicher bis nach Compostella.
Als die Männer, die das berühmte, achtspitzige, rote Tatzenkreuz auf dem Mantel trugen den absoluten Höhepunkt ihrer Macht erreichten, hatte man den anderen Ritterorden, der als Erkennungszeichen ebenfalls einen weißen Mantel und ein rotes, gleichschenkeliges Kreuz trug schon beinahe vergessen und keinem jungen, abenteuerlustigen Adeligen wäre es je noch eingefallen, sich seinen mühevollen Weg durch die Pinien und Buchen des riesigen Bosquet de Irati zu bahnen, um an das Tor der Festung von Roncal zu klopfen und um Aufnahme in den Orden von Santiago zu bitten. Diese wurde nur noch denjenigen gewährt, die wahre Kenntnisse von den geheimen Mächten hatten und in der Lage war, die Kräfte und Gesetze der Magie zu verstehen.
Damit hatte der Orden von Santiago auf seinem langen, einsamen Weg den letzten und entscheidenden Schritt getan. Sie ahnten, dass außerhalb der engen Grenzen ihrer eigenen Gemeinschaft noch andere Eingeweihte existierten, die die alten Lehren von der praktischen Anwendung der niedersten Gesetze der Natur bis zu den höchsten Gesetzen des Geistes kannten und die diese Geheimnisse, wie sie, mit aller Strenge hüteten. Sie vermuteten, dass diese anderen zwangsläufig, wie sie selbst, Kenntnis davon hatten, dass einzelne Brocken und Bruchstücke dieses höchsten Wissens im Verlauf der Geschichte der Menschheit aus dem besonderen Kreis der Eingeweihten nach Außen durchgesickert waren...wie dieses eine Wort der Macht, dass vor vielen Jahren einmal dem skrupellosen Erzbischof von Santiago de Compostella erlaubt hatte, die Tore der Anderswelt zu öffnen, um ein Heer von grauenvollen Spektren und Untoten auf die Armee der Almohaden bei Navas de Tolosa loszulassen und sie fühlten, dass nun endlich der Augenblick gekommen war, mit diesen anderen in Verbindung zu treten, um gemeinsam zu versuchen, wenigstens die gefährlichsten und verhängnisvollsten Niederschriften des alten Wissens und insbesondere die Schlüssel zu den Pforten der Zeit und zu den Toren der Welten wieder aus dem Verkehr zu ziehen.
Eine höhere Macht hatte sie am Anfang der Welt geschaffen und sie den Weisen der alten Rassen anvertraut, doch als die Reiche der Vorzeit untergingen, waren diese Schlüssel genauso, wie die überlebenden Eingeweihten zerstreut worden. Jetzt galt es, Schlüssel und Eingeweihte wieder zu vereinen.
Ein Ordensbruder machte sich darum sogleich auf den Weg über die Pyrenäen gen Norden, wo er vermutete, dass einer dieser Schlüssel verborgen sein musste. Er kam nach Pen-ar-Bed und Breizh und spürte Drouiz auf, die von den Dienern Roms unerkannt im Verborgenen immer noch über geheimnisvolle Steinringe wachten. Als sie ihn zu einer winzigen Insel im Golf von Morbihan mitnahmen, die sie in ihrer Sprache Gavrinis, die Ziegen-Insel nannten, fühlte er im Herzen des seltsamen, uralten, unterirdischen Heiligtums, das sie ihm zeigten dass sie Herren der Zeit waren und trotz gnadenloser Verfolgung und blutiger Unterdrückung seit den Tagen der Eroberung Galliens durch die römischen Legionen außergewöhnliches Wissen über die Jahrhunderte hinweg gerettet hatten. Er erklärte ihnen zuerst ausführlich wer er war und woher er kam. Dann erzählte er offen von den Plänen und Zielen des Ordens von Santiago. Schließlich unterbreitete der Ritter den Weiße Brüdern das Angebot, einen der ihren auszuwählen, der sie im Kreis der geheimen Verbindung vertreten konnte.
Als er die Drouiz endlich überzeugt hatte, setzte der geheime Gesandte des Ordens von Santiago seinen Weg nach Osten fort. Dort lebten Brüder der spanischen Sephardim. Sie selbst nannten sich Ashkenazy, die Reinen. Er gewann am Ende auch ihr Vertrauen und sie führten ihn sogar hinunter in ein Gewölbe, das sich tief im Leib des Hügels befand, auf dem die Stadt Krakau errichtet worden war.
Durch zahlreiche Höhlen und dunkle Gänge führten sie den Ordensherren von Santiago bis zu einer Grotte, die sich zu einer Galerie erweiterte, die schließlich in das Innere des Wawel-Hügels führte und der Ritter verstand ohne Worte, dass dieses Labyrinth von mächtiger Hand erschaffen worden war: Ein sanfter, warmer Glanz erleuchtete das letzte Gewölbe. Es ging von einem großen Stein aus, der sich im Zentrum befand. Der Ritter fühlte, genauso wie zuvor auf der Insel Gavrinis, das er vor einer Pforte der Zeit, einem Tor zwischen den Welten stand.
Zahmer und vertrauensvoller als die Weiße Brüder von Penn-ar-Bed und Breizh erlaubten ihm die Ashkenazy, die ihn geführt hatten, näher zu treten, damit er den seltsamen Stein berühren konnte. Als seine Hand über die glatte Oberfläche strich, hörte er eine geheimnisvolle Stimme. Sie offenbarte ihm, dass er am Ende seiner Suche mit dem Wissen um die Existenz von sechs der sieben Steine der Weisheit in den Schoß seines Ordens zurückkehren würde. Doch der Weg zum letzten Stein würde ihm verborgen bleiben, denn der Stein war nicht von dieser Welt und konnte nur von einem wahren Eingeweihten erschaffen werden.
Der Ordensherr zog erschrocken und verwirrt die Hand zurück, weil er nicht verstand, aber sein Herz sagte ihm, das diese sonderbare Botschaft gleichzeitig eine Prophezeiung und eine Warnung war. Die slawischen Brüder der spanischen Sephardim verstanden ebenso wenig, wie er selbst die Bedeutung der Worte. Doch sie wussten um die Existenz anderer Gemeinschaften weiser Männern und Frauen, die ähnlich wie sie selbst uralte Pforten der Zeit hüteten. Einige von ihnen lebten in Ländern, in denen es immer kalt war und die sogar im Sommer von Schnee und Eis bedeckt wurden, andere verbargen sich im riesigen Reich des russischen Zaren oder in den von Wölfen verseuchten, kaum zugänglichen Wäldern, die die Ritter des Deutschordens für sich in Besitz genommen hatten: Soemundur der Isländer fand so seinen Platz im Orden. Sie nahmen Michael den Schotten auf, der damals Hofastrologe von Kaiser Friedrich dem Hohenstauffer war und den man besser unter seinem lateinischen Namen Scotus kannte. Der Dominikaner Albertus Magnus war in den letzten Jahren seines langen Lebens ein bedeutender Ordensherr von Santiago.
Selbst nach dem fernen und sagenhaften Indien sandten die Ritter ihre Einladung. Yaska, der die Rig Veda, das „Große Wissen“ als erster kommentiert und seine Erkenntnisse niedergeschrieben hatte, hörte ihren Ruf. Er brachte eine Abschrift des „Großen Wissens“ zum Geschenk und er trug ihnen auch aus dem Gedächtnis Sama Veda, Yajur Veda und Atharva Veda vor. Dann erzählte er von den „Nagakallu“, den uralten, stehenden Steinen, die sich von den grünen Hügeln Assams und Meghalayas und auf der Insel Nias in den Himmel streckten und davon, wie die Eingeweihten –Männer und Frauen- aus dem Volksstamm der Khasi sich immer noch mit U Blei Nong-thaw, dem Gott des Königreiches und Schöpfer des Universums unterhalten konnten. Als Yaska zum Ende gekommen war, hatten sie sich damals nur lange angesehen und plötzlich hatte sich vor ihnen allen das Tor zu einer tieferen Erkenntnis aufgetan. Die Drouiz waren die ersten gewesen, die wirklich verstanden, was Yaska ihnen mitteilte und der Bramane aus dem fernen Indien erkannte in ihnen seine lange verloren geglaubten Brüder.
In dieser Stunde wurde ihnen allen die tiefere Bedeutung der heiligen Geometrie vollkommen bewusst und sie begriffen, dass es nicht die Pforten der Zeit oder die Tore zwischen den Welten waren, die man beschützen musste, sondern alleine jenes Geheimnis um den ersten Stein der Weisheit, das um keinen Preis in falsche Hände gelangen durfte, denn dieser legendäre Stein hielt die letzte und größte Wahrheit jenes namenlosen Schöpfers in sich verborgen, der das Licht war und aus dem am Anfang der Zeit die Welt erschaffen worden war. In diesem Geheimnis lagen gleichermaßen das Leben und der Tod. Es war der erbarmungslose Kampf um den Besitz dieses Geheimnis gewesen, das damals in grauer Vorzeit dazu geführt hatte, dass die alten Reiche sich am Ende selbst vernichteten...
Als dann in Philippe IV. von Frankreich, den man auch den „Schönen“ nannte der Plan heranreifte, sein Königreich von den Rittern des Templerordens zu säubern, die sich immer hochnäsiger und ungebärdiger aufführten, besiegelte dies nicht nur das Schicksal von Jacques de Molay und Godefroi de Charnay, sondern auch das des Ordens von Santiago.
Kurz bevor Phillipe am 13. Oktober 1307 –einem Freitag- alle Herren des Tempels, die sich in Frankreich befanden als Ketzer, Hexer und gotteslästernde Diener Satans verhaften ließ, segelten achtzehn bis unter den Bug beladene Galeeren der Templer unter dem Kommando eines schottischen Ordensritters mit Namen Henry Sinclair auf Nimmerwiedersehen aus dem Hafen von La Rochelle und ein junger Ritter aus Anjou, der offiziell nur wenige Tage vor der Katastrophe aus dem Templer-Orden ausgeschieden war überquerte mit einem kleinen Fischerboot den Golf von Biskaya, um in Portugal an Land zu gehen, wo er umgehend von König Diniz empfangen wurde.
Niemand hatte je in Erfahrung bringen können, was der portugiesische König und der junge Ritter wirklich miteinander besprochen hatten, warum der portugiesische König von den geheimsten Zielen des Ordens von Santiago wusste und wie es ihm am Ende gelang, den damaligen Großmeister Arnoldo de Villanova zu kontaktieren. Schließlich trafen sich der junge Tempelritter und der berühmte Wissenschaftler aus Valencia unter dem Siegel der strengsten Geheimhaltung und Villanova versprach die Schriftrollen und Manuskripte, die Jacques de Molay kurz vor seiner Verhaftung aus dem Pariser Ordenshaus hatte schaffen lassen in sichere Verwahrung zu nehmen, bis das Schicksal des Templerordens geklärt war. Der Prozess gegen die französischen Tempelritter, gegen Jacques de Molay und Godefroi de Charnay dauerte sieben endlos lange Jahre und dabei wurden unter der Folter ganz merkwürdige Geständnisse zutage gefördert und noch seltsamere Beschuldigungen erhoben. Man warf ihnen vor, sie hätten einen Teufel namens Baphomet verehrt, Kinder gemordet, Frauen zur Abtreibung gezwungen und untereinander geschlechtliche Beziehungen wider die Natur unterhalten. Im Jahre 1312 wurde der Orden vom Papst aufgelöst, ohne dass je auf seine Schuld oder Unschuld erkannt worden war und im März 1314 wurde schließlich auf der Ile aux Juifs zu Paris der Scheiterhaufen für den ehemaligen Großmeister des Ordens und den ehemaligen Großpräzeptor der Normandie entzündet.
Mit dem Tod von Jacques de Molay und Godefroi de Charnay traten die Ritter im weißen Mantel mit dem Tatzenkreuz endgültig von der Bühne der Geschichte ab, während der andere Orden –Santiago- endlich die ihnen sieben Jahre zuvor anvertraute Truhe mit den Schriftrollen und Manuskripten aus dem Tempel von Paris öffnete.
Was Arnoldo de Villanova und die damaligen Mitglieder der geheimen Bruderschaft fanden, erschütterte sie alle zutiefst: Jacques de Molay hatte in seinem Testament ausführlich die Gründe für den Untergang seines Ordens beschrieben – Opfer des besessenen Eifers eines verblendeten und wahnsinnigen Königs, dem sie nicht nur unglaubliche Geldsummen geliehen hatten, sondern dem sie einmal, in einer Stunde der Not in ihrem Pariser Ordenshaus auch unvorsichtig Zuflucht vor einem aufständischen Pariser Mob gewährt hatten; Opfer ihrer eigenen Überheblichkeit und Ungebärdigkeit, Opfer ihres unglaublichen Reichtums und ihrer grenzenlosen Macht, die weder vor Königen, noch vor Päpsten haltmachte und vor allem...Opfer eines unglaublichen Fundes, den neun Ritter unter den sogenannten ‚Ställen Salomons’ auf dem Tempelberg von Jerusalem gemacht hatten, weil Fulko von Anjou, Graf der Champagne und Vater von Geoffroi Plantagenet im Jahre 1104 eine Reise ins Heilige Land unternahm und von dieser seinen Verwandten André de Montbard, Hugues de Payns und Bernard de Clairvaux ausführlich berichtete.
Als die Ordensherren von Santiago die uralte Schriftrolle öffneten, gefror ihnen beinahe das Blut in den Adern.
„Marantha. Fluch, über jeden, der diese Schrift aufschlägt und der nicht ein aus dem Stamme Judah ist. Fluch jedem, der nicht Priester oder Gelehrter und der diese Schrift in Händen hält. Er soll vernichtet und ausgelöscht werden. So wie Korah, Dathan und Airam soll er vernichtet werden oder im Feuer verbrennen. Ich bin Abraham Eleazar der Jude, ein Fürst, Priester und Leviter, Astrologe und Philosoph. Ich entstamme dem ältesten Geschlecht, denn meine Wurzeln gehen zurück auf Abraham, auf Isaac und auf Jakob. Meine Brüder, die ihr durch den Zorn des Großen Gottes in alle Winde zerstreut leben müsst, in Unterdrückung und Sklaverei: Ich wünsche Euch im Namen des Messias, der bald kommen wird und im Namen des großen Propheten Elias, der all seine Brüder auf diese Ankunft vorbereitet hat Erfolg und Glück. Deni, Adonai, Bocitto, Ochysche 60 F. Darum erwartet geduldig das Kommen des Helden. Ich bin Abraham Eleazar und dies ist die größte und höchste der uralten Weisheiten, die unser Stammvater Abraham einst in der babylonischen Gefangenschaft als ein Schüler des wahren Meisters, des Dreifach Großen, des Unsterblichen unter den Menschen - Thoth – gelernt hat. Dies ist die erste und größte Weisheit, nämlich die Weisheit von der Erschaffung des Steines in dem sich das Leben und der Tod zur Unsterblichkeit verbinden...und in diesem Stein liegt nicht nur das größte Geheimnis der Welt des Göttlichen, sondern auch unermesslicher Reichtum und grenzenlose Macht. Mit diesem Stein werdet ihr den Messias unsterblich, reich und mächtig machen, so wie einst Samuel der Weise den David in höchster Not unsterblich machte, damit er den Stamm Judah einen und retten konnte, um ihn aus Unterdrückung und Sklaverei zu höchster Macht zu führen. Dies ist das Gebot des Stammvaters Abraham, den Thoth lehrte, was einst Noah seinen Sohn Ham lehrte und Ham seinen Sohn Mizraim und Mizraim seinen Sohn Naphtuhim und dieser wieder lehrte seinen Sohn Ahmar,der Kom lehrte, der mit Serket, der Tochter des silbernen Mondlichts den Thoth selbst zeugte.“
Sie entzifferte langsam die klare, präzise Handschrift in aramäischer Sprache.....dann fanden sie den kleinen, silbernen Zylinder, in dem sich in tausend winzige, perlweiß glänzende Splitter zerschlagen der Lapis befand, den offensichtlich der erste Großmeister des Ordens zusammen mit seinem Neffen Bernard de Clairvaux geschaffen hatte.
Doch die Abschrift und Übersetzung der uralten Schriftrolle in die lateinische Sprache, die Bernard der Einfachheit halber für seine drei Vettern angefertigt hatte und die von Jacques de Molay in seinem schrecklichen Testament so detailliert beschrieben worden war, war verschwunden...genauso, wie der junge Tempelritter, der sich sieben Jahre zuvor König Diniz von Portugal und Arnoldo de Villanova anvertraut hatte.
Dies waren nun die Nachfolger der Nachfolger jener geheimnisvollen Ordensherren, die hinter den unbezwingbaren Mauern ihrer Festung von Roncal die Truhe von Jacques de Molay geöffnet hatten und die der Herzog Ambrosius Arzhur de Cornouailles zusammenrief, um über den Diebstahl von Saint Jacques de la Boucherie und seine Folgen zu beratschlagen.
Während Sidonius langsam anfing zu begreifen, was für ein sonderbares Zauberbuch der gütige und unscheinbare Meister Flamel wirklich mit in sein Grab genommen hatte, lebte er weiter in seinem schönen Gästezimmer des Palas und genoss den Zugang zur Sammlung alter Handschriften seines Herren Ambrosius Arzhur. Er speiste mit dem Herzog, Maeliennyd, den Drouiz und Guy de Chaulliac an der herzoglichen Tafel und nachdem sie ihre anfängliche Scheu und Zurückhaltung überwunden hatten, setzten die Weisen des Hofes von Concarneau sich sogar oft mit ihm zusammen und diskutierten. Natürlich war seine kleine Wissenschaft, die er sich in drei kurzen Jahren bei den Benediktinern und am Collegium Sorbonianum angeeignet hatte nichts im Vergleich zu ihrer Gelehrsamkeit, doch sie kannten alle die Geschichte, wie Marzhin, St.Columba die Hand gereicht und Sidonius’ Orden einen Platz in Cornouailles und in Breizh angeboten hatte. Sie erkannten schnell, dass der junge Mann unter seiner schwarzen Kutte immer noch Szenec, der Sohn von Meister Juizig dem Fischer war und Ambrosius Arzhur ohne je zu wanken und über die Grenzen der Religion hinweg die Treue hielt.
Manchmal tauschte der Benediktiner sein Ordensgewand gegen praktischere Kleidung und ritt mit der Herzogin und ihren Damen auf die Falkenjagd. Maeliennyd Glyn Dwyr war ihm gewogen, seit Sévran seinen Vater am Morgen nach der Vision von Azincourt gebeten hatte, den jungen Szenec und dessen Mutter seinem persönlichen Schutz zu unterstellen. Sie erinnerte sich gerne daran zurück, wie eng ihr Jüngster und der Sohn des Fischers befreundet gewesen waren und natürlich auch an die unbefangenen Spiele der Kinder, die sie oft heimlich und amüsiert beobachtet hatte.
Während Ambrosius Arzhur seinen Hof für den Winter von Concarneau nach Rusquec und in den Uhel Koad verlegte, waren endlich die gelehrtesten Mitglieder des Ordens von Santiago eingetroffen, oder hatten zumindest einen designierten Stellvertreter mit Handlungsvollmacht geschickt. Sidonius war tief beeindruckt, als man ihm diese außergewöhnliche Gruppe vorstellte, die über das höchste Wissen der Welt wachte. Anstelle des jungen Herzogs von Mailand, Philipo Maria Visconti war seine Schwester Valentina gekommen, die Gemahlin des ermordeten Herzogs von Orleans und eine außergewöhnlich gelehrte Frau, für die weder die Magie, noch die Wissenschaften der Natur Geheimnisse bargen. Den Herrscher von Savoyen vertrat eine andere erstaunliche Frau; Christine de Pisan, die Schriftstellerin und Astronomin. Sie lebte und arbeitete zwar schon seit vielen Jahren in Paris, weil ihr Vater seinerzeit als Astronom an den Hof von König Charles V. von Frankreich berufen worden war, doch sie hatte ihre italienischen Wurzeln nie vergessen. Yolande d’Aragón, die künftige Schwiegermutter des Dauphin Charles de Ponthieu, war selbst die kurze Strecke aus Angers an den Ufern der Loire nach Rusquec in Cornouailles gereist. Auch Professor Pawel W?odkowic, der hochgelehrte Rektor der Universität von Krakau, der auf dem Konzil von Konstanz im Jahr 1415 vehement die Interessen Polens gegen die Ritter des Deutschen Ordens verteidigt und das Selbstbestimmungsrecht der Nationen verlangt hatte, hatte trotz seines fortgeschrittenen Alters den langen Weg aus dem Osten auf sich genommen. Er war gemeinsam mit dem geheimnisvollen Christian Rosenkreutz und Johannes Nyder, einem schweigsamen, finster wirkenden Dominikaner eingetroffen.
Der weiteste und gefährlichste Weg war jedoch von einem Mann zurückgelegt worden, dessen Gesicht deutlich die Zeichen des Islams trugen; Yussef Aben Zeragh, Prinz der Benij Serai. Er kam aus Cordoba im maurischen Teil Spaniens - Al Andalus - und er hatte alleine reiten müssen, um die Aufmerksamkeit seiner christlichen, spanischen Feinde nicht auf sich zu ziehen. Obwohl Aben Zeragh das jüngste Mitglied des Ordens war und mit seinen breiten Schultern, Narben im Gesicht und den vom Führen eines Schwertes schwieligen Händen mehr einem Krieger, als einem Gelehrten glich, war er doch der amtierende Großmeister von Santiago. Sein Wissen schien grenzenlos und ging offensichtlich weit über die Kunst hinaus, deren Ambrosius Arzhur als Meur Drouiz oder Christian Rosenkreutz als Magier sich rühmen konnten.
Prinz Aben Zeragh stand einer mysteriösen Schule vor, die als die „Schwarze Schule von Granada“’ bekannt gewesen war und an der einst der verruchte Erzbischof Pedro Muñoz die Kunst der Nekromantie studiert hatte. Doch ähnlich, wie der Orden der Ritter von Santiago hatte sich auch die „Schwarze Schule von Cordoba“ nach der Schlacht von Navas de Tolosa vor den Augen der Welt versteckt , und niemand – nicht einmal Ambrosius Arzhur, der Sidonius zuvor in einer langen Sommernacht die ganze Geschichte des Ordens von Santiago anvertraut hatte - wollte auch nur ein Sterbenswörtchen mehr verraten, obwohl alle offensichtlich sehr genau darüber Bescheid wussten, was man an dieser Schule lehrte und wo sie sich befand.
Die beiden letzten Ritter von Santiago waren Don Pablo de Santa Maria, ein konvertierter Jude, Bischof von Burgos und Kanzler des Königreiches Kastilien und Leon und Hayyim Ibn Musa, der berühmte Kabbalist und Schatzmeister des Kalifen von Granada.
Die Nachricht, dass zuerst ein Unbekannter die Übersetzung der Handschrift von Abraham Eleazar aus dem Grab des erst kürzlich verstorbenen Nicolas Flamel gestohlen hatte, um sie dann dem Herren von Champtocé, einem gewissen Jean de Craon zu bringen, traf die Mitglieder des Geheimbundes, wie ein Schlag.
Für Sidonius war alles zuerst nicht viel mehr gewesen, als eine erbärmliche Grabschändung und ein geheimnisvolles Buch. Inzwischen begriff er, das nicht nur der Diebstahl selbst das große Problem darstellte, sondern ganz besonders der neue, unrechtmäßige Besitzer der unheimlichen Übersetzung.