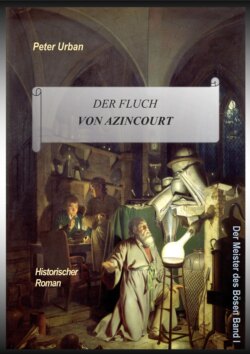Читать книгу Der Fluch von Azincourt Gesamtausgabe - Peter Urban - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 2 Das Blut von Saint Créspin
ОглавлениеI
Gilles stand ganz ruhig. Niemand würde ihn in der Nische direkt neben dem Türstock bemerken.
Die Taverne von Saint Pol war groß und hatte mehrere Räume und sogar einen zweiten Stock mit ein paar Zimmern, die in Friedenszeiten an Handelsreisende auf dem Weg in die Hafenstädte an der Küste vermietet wurden. Doch heute stand der Krieg vor der Tür und der Besitzer hatte sich schnell umgestellt. Jetzt hielten die Dirnen aus der Gegend oben ihren Markt der Lust und sein Haus quoll über von hungrigen und zahlungskräftigen Waffenleuten aus dem Heer des französischen Königs, das in der Umgebung lagerte. Im größten Raum der Taverne war eine lange Tafel für die Gesellschaft aufgestellt worden. Man hatte solide Bretter über kräftige hölzerne Böcke gelegt. Der Wirt war eifrig darauf bedacht, den Rittern und ihren Waffenleuten, die die kleine Stadt für ihr Nachtlager ausgewählt hatten, gefällig zu sein.
Der stiernackige Bretone Richemont und der langhaarige Kelte mit dem Sigillenreif am Handgelenk kamen gemütlich aus der Schankstube hereinspaziert, um sich zu ihren Waffenleuten an der langen Tafel zu gesellen. Amaury, den sein Großvater so leidenschaftlich hasste, hatte bereits seinen Sitzplatz an der Seite eines breitschultrigen, wettergegerbten Bären, den er Gud’wal nannte, eingenommen.
„Ich wünsche jedermanns Durst mit dem besten Bier zu löschen, das Ihr habt“, dröhnte Richemont, „so viel die Männer trinken können. Die, die lieber Wein trinken, sollen ebenfalls bekommen, soviel sie begehren. Und nach dem Essen bringt Ihr uns noch Apfelbrand.“
Gilles bemerkte den Ausdruck im Gesicht des Wirtes.
„Die Kosten spielen keine Rolle“, versicherte ihm Richemonts Begleiter und klopfte dabei vergnügt auf den prallen Lederbeutel, der an seinem Gürtel hing. Die Münzen klimperten lustig. „Gebt den guten Männern ruhig alles was sie begehren, Herr Wirt!“
„Und das Essen, Mesires,“ erkundigte sich der Mann nun etwas zuversichtlicher bei den beiden jungen Rittern, die inzwischen ihre vom Regen durchnässten Mäntel einem Burschen von vielleicht vierzehn oder fünfzehn Jahren in die Arme geworfen hatten, der das Wappen der Bretonen auf der Surcotte trug.
„Ich will Lamm“, dröhnte der Bär, den der Sohn seines Großvaters Gud’wal nannte, „vom Zartesten natürlich…und weißes Brot dazu.“
Arzhur de Richemont und der mit dem Sigillenreif, von dem Gilles inzwischen wusste, dass er Aorélian de Douarnenez gerufen wurde, stimmten ihrem Kriegsknecht zu.
Der Knabe sah von seinem Versteck aus immer mehr Gäste, die nacheinander in den großen Raum hereinströmten. Einige schienen von Adel und Geburt, was er an der Qualität ihrer Waffenröcke und Mäntel sah. Andere waren offensichtlich geringere Vasallen oder auch nur Waffenleute, aber an der Tafel schienen sie keinen Unterschied zu machen. Gelassen ließen die meisten sich auf ihre Plätze fallen, nachdem der gehetzte Knappe des Bretonen ihnen die nassen Mäntel abgenommen hatte. Der Wirt und zwei seiner Mägde zündeten die Kerzen an. Der Lichterkreis wuchs, bis Gilles von seinem Versteck aus die meisten der Gesichter erkennen konnte. Erstaunlicherweise saß sogar Graf Phillip von Nevers am Tisch der Barbaren; Blond, hübsch, ein halbes Kind, kaum neunzehn Jahre alt. Doch er hatte den Ruf ein mutiger Mann zu sein, einer der besten Ritter im Heer des Konnetabel d’Albret. Er unterhielt sich angeregt mit dem jüngeren Bruder von Douarnenez. Gilles hatte vor ein paar Tagen erlauscht, dass er Glaoda hieß und Graf von Leon war. Er trug sein Haar etwas kürzer, als der ältere Aorélian und hielt es mit Flechten aus dem Gesicht, doch seine Kleidung war genauso prunkvoll und pfauenhaft bunt und auch er behängte sich gerne über und über mit altertümlichem Goldschmuck. An diesem Abend blitzte auf seiner hellgrünen und gelben Surcotte ein Medaillon, das die Form eines Mannes mit einem Hirschgeweih hatte.
Neben Glaoda de Leon befand sich Jean, der Herzog von Alençon, nächster normannischer Nachbar der bretonischen Montforzh. Seine harten, glänzenden Augen starrten die festen Brüste einer der Mägde gierig an, als diese fast aus der Verschnürung ihres Mieders sprangen, während sie die schweren Bierkrüge - sechs Stück in jeder Hand – über die Köpfe der Männer hinweg auf den Tisch hievte.
Den meisten anderen Gästen konnte Gilles keine Namen geben, doch er wusste, dass sie zu den Truppen aus der Bretagne und aus Cornouailles gehörten, oder Männer waren, die seinem Großvater vor Jahren zusammen mit dem verräterischen Amaury den Rücken gekehrt hatten. Er beobachtete sie bereits seit dem Tag, als er im Heerlager vor Rouen das Amulett am Handgelenk des Kelten Douarnenez entdeckt hatte. Nachdem vor jedem etwas zu trinken stand, schauten alle Arzhur de Richemont, der am oberen Ende der Tafel saß erwartungsvoll an.
„Meine Freunde, macht nicht so gespannte Gesichter“, sagte der Bruder des Herzogs der Bretagne und erhob sich, „dieser Abend ist der Abend an dem sich das Schicksal unserer Länder vielleicht entscheidet. Der Lancaster hat einen Botschafter zu d’Albret und Boucicault geschickt. Sie wollen den friedlichen Abzug nach Calais verhandeln. Das hässliche Gespenst von Waffenklirren und sinnlosem Blutvergießen kann sich vielleicht immer noch auflösen. Ich danke Euch allen, dass Ihr Douarnenez und mich heute Morgen im Kriegsrat unterstützt habt.“ Er nahm seinen großen Bierhumpen. „Trinkt, ich bitte Euch! Trinkt auf die Freundschaft! Trinkt auf den gesunden Menschenverstand! Trinkt auf Umsicht und Vernunft! Trinkt auf die Ehre! Trinkt auf den Mut!“ Er setzte sich wieder neben den Barbaren mit dem Sigillenreif, der seinen Krug als erster hob und gegen den von Richemont stieß.
Gilles beobachtete, wie alle Männer ihre Krüge leerten und mit Heißhunger aßen, als ihnen endlich Lammbraten und Brot vorgesetzt wurden. Sie waren sichtlich erschöpft von der anstrengenden Verfolgung der Engländer durch das miserable Herbstwetter und die erbarmungslosen Regenstürme. Manche mussten sich mühsam beherrschen, um die Fleischbrocken von den Knochen nicht mit den Zähnen abzureißen, wie wütende Hunde. Das Gespräch verstummte und dann hörte der Knabe eine Zeit lang nur noch das Klirren der Messer auf den großen Tellern aus Zinn. Jeder aß mit seinem eigenen Dolch. Die pralle Magd und ein anderes Mädchen – hübsch, aber unauffälliger – brachten neue Wein- und Bierkrüge und räumten die Leeren fort.
„Gut“, dachte Gilles, „sie werden heute Abend viel trinken. Das macht die Sache vielleicht einfacher. Wenn der Douarnenez so weitersäuft, dann gibt es gewiss eine Gelegenheit, irgendwann in der Nacht in sein Zelt zu schleichen, und ihm das Amulett wegzunehmen...oder er kommt erst gar nicht so weit und ich kann es hier versuchen, sobald sie alle betrunken und besinnungslos sind.“
Krug um Krug wanderte zum Tisch. Der Lärm schwoll an. Die Männer lachten. Sie waren jetzt völlig entspannt. Ihre Dolche lagen auf den Tellern und sie lehnten sich mit vollen Bäuchen zufrieden zurück. Die ersten Köpfe gerieten bereits ins Schwimmen.
„Gut war es heute Abend“, lallte der Bär neben Amaury, bevor ihm der Kopf schwer auf die Brust sank und Gilles einen rasselnden Schnarchton ausmachte.
„Jetzt wollen wir hoffen, dass die Geister des Krieges morgen früh fortgezogen sind“, seufzte der junge Nevers. Wein tropfte ihm über das Kinn und auf seinen leeren Teller. Zehn Steingutflaschen voller Apfelbrand erschienen mit den beiden Mägden.
„Jetzt wollen wir erst einmal sehen, ob der Schnaps hier oben im Norden den Calvados aus den Kellern von Alençon wert ist“, schmunzelte der langhaarige Barbar mit dem Sigillenreif und nickte Herzog Jean am gegenüberliegenden Ende der Tafel freundlich zu. Der Herr von Alençon lief vom vielen Wein bereits feuerrot an. Die Korken wurden herausgerissen und die Flaschen machten die Runde. Die goldfarbene, stark duftende und hochprozentige Flüssigkeit brannte den Männern in den Kehlen und stieg ihnen geradewegs in die schon von Wein oder Bier vernebelten Köpfe.
Gilles grinste breit, als Arzhur de Richemont der Magd mit den prallen Brüsten und dem engen Mieder den Arm um die Hüfte schlang. Das Mädchen lief genauso rot an, wie der betrunkene Alençon nur wenige Zeit zuvor, als der Bruder des Herzogs der Bretagne ihr ins Ohr flüsterte. Es dauerte nicht lange und die beiden waren sich offenbar über den nächtlichen Zeitvertreib einig, denn Richemont verschwand bemerkenswert aufrecht und offenbar vom Alkohol unberührt mit dem Mädchen. Douarnenez sah den beiden anzüglich grinsend nach, bevor er die letzte volle Schnapsbrandflasche zu sich zog und öffnete. Gilles war gespannt wie ein Bogen. Er hatte die längste Zeit des Abends damit zugebracht, den Träger des Sigillenreif zu beobachten. Der Langhaarige hatte viel getrunken: Zuerst in schneller Folge ein paar Krüge Bier gegen den Durst. Dann Wein. Der Schnaps würde ihm vielleicht den Rest geben.
In der Tat fiel dem Barbaren aus Cornouailles der Kopf auf die Arme, als er die Apfelbrand-Flasche mit dem Ellbogen wegschob. Niemand an der großen Tafel war mehr in einem Zustand Widerstand zu leisten. Die ganze Gesellschaft unter Ausschluss des bretonischen Herzogsbruders, der es vorgezogen hatte, sich für die Nacht das pralle Weib in sein Bett zu nehmen, hing wie ein Haufen nasser Säcke am Tisch. Schnarchen übertönte den Rest des Lärms aus den anderen Räumen der Taverne.
Das Kind verharrte noch eine Weile unbeweglich in seinem Versteck. Die meisten Kerzen waren erloschen; nur das Feuer im Kamin spendete ein trübes Licht. Gilles ließ sich auf die Knie fallen und kroch unter die Tafel. Anstelle seiner schmucken Kleider trug er in dieser Nacht nur eine bequeme Hose aus Hirschleder und eine kurze, dunkelbraune Tunika, die ihm Bewegungsfreiheit gewährte. Wie eine Katze, schlich er auf allen vieren zwischen den ausgestreckten Beinen der Betrunkenen vom unteren Ende hinauf in Richtung auf sein Opfer. Doch genau in dem Augenblick, in dem er am Ziel seiner Wünsche angekommen war und auftauchte, packte ihn eine kräftige Pranke hart am Kragen und zog ihn hoch.
„Ein kleiner Dieb“, zischte ein sehr nüchterner Arzhur de Richemont dem jungen Laval ins schreckensbleiche Gesicht. Neben dem Bruder des bretonischen Herzogs stand die pralle Magd mit einer großen Holzschüssel, aus der es nach warmem, süßem Grießbrei duftete. Gilles bekam vor lauter Schreck den Mund nicht auf. Er hatte nach Richemonts plötzlichem Abgang damit gerechnet, dass der Kerl sich wollüstig mit dem Weib in einem Bett wälzen würde. Doch der bretonische Ritter stand hoch aufgerichtet vor ihm, war stocknüchtern und hielt ihn fest. Seine sonst so gutmütigen blauen Augen funkelten dunkel und zornig.
„Einem Dieb schlägt man die Hand ab, Bürschlein“, zischte Richemont gefährlich. Gilles spürte seinen heißen Atem im Nacken und alle Haare standen ihm zu Berg. In seinem Magen krampfte es sich zusammen, so als ob ihm jeden Augenblick vor Angst übel werden würde. Die pralle Magd hatte inzwischen den Grießbrei auf den Tisch gestellt und stemmte die kräftigen Arme entrüstet in die Hüften.
Das Letzte, was Gilles de Laval sah, war Richemonts geballte Faust. Er spürte weder das warme Blut, das aus seiner Nase über sein Gesicht und seine Tunika rann, noch den eisigen Nachtwind vor der Taverne im Schmutz der Gosse.
II
Sévran de Carnac rutschte leise vor sich hin fluchend die Böschung hinunter. Der Silberfluss tobte durch die Steine hindurch auf eine kleine Stromschnelle zu. Weiße Gischt spritzte ihm kalt ins Gesicht. Endlich fanden seine glatten Ledersohlen einen vernünftigen Halt auf einem flachen Stein mit rauer Oberfläche. Er betrachtete aufmerksam einen weiteren flachen Stein mitten im Fluss. Mit etwas Geschick würde er soweit springen können und wäre dann mit einem zweiten Satz auf der anderen Seite und bei den Schwertlilien die Aodrén unbedingt haben wollte.
Der Knabe vergewisserte sich, dass der kurze Dolch sicher in seinem Gürtel steckte. Dann fixierte er sein Ziel. Der Stein war moosbewachsen und gewiss glitschig, doch Sévran, der schmal und zierlich war, wie ein Mädchen wusste, dass er das Gleichgewicht einer Katze besaß. Geschmeidig ging er in die Knie und stützte sich nach der Landung nur ganz kurz mit den Händen ab, bevor er erneut sprang. Mit wenigen Stichen des breiten, kurzen Dolches hatte er die Schwertlilienwurzeln freigelegt. Er verstaute seine Beute in einem Lederbeutel, den er am Gürtel trug, und machte sich auf den Rückweg. Es würde nicht mehr lange dauern und die Nacht würde sich über den Wald von Uhel Koad legen. Ihm war kalt, er war müde und hungrig und er wollte so schnell wie möglich zurück nach Hause zu seiner Mutter und an ein wärmendes Feuer.
Auf die gleiche Weise, wie Sévran zuvor gekommen war, überquerte er hüpfend und balancierend den Silberfluss in entgegengesetzter Richtung, ohne auch nur ein einziges Mal ins Wasser auszugleiten. Dann kletterte er behände die steile Böschung hoch und rannte zu der Stelle, an der er Aodrén mit seinen Pony Finn zurückgelassen hatte. Doch anstatt den alten Mann und sein Reittier zu finden, fand er nur einen einsamen Waldpfad, der links und rechts von hohen Laubbäumen eingesäumt wurde.
„Aodrén! Ollamh“, rief das Kind, während seine schwarzen Augen die Umgebung absuchten. Die einzige Antwort, die Sévran erhielt war das leise Rauschen der Blätter im Herbstwind. Der Pfad lag im Dunkeln, denn die hohen Bäume versperrten dem letzten Tageslicht den Weg in den Uhel Koad. Kurz überlegte der Knabe, ob er sich nicht mit der Stelle geirrt haben konnte. Er rannte den Pfad entlang, zurück in die Richtung, aus der er vermutete, dass sie gekommen waren, bevor der alte Mann die Schwertlilien entdeckt hatte. Doch auch dort war keine Menschenseele zu entdecken. Schnell senkte sich die Nacht über den Wald. Der Wind wurde kälter und das leise Rauschen der Bäume verwandelte sich in der Einsamkeit und Dämmerung in ein unheimliches Brummen.
„Aodrén! Bitte, Meister, zeigt Euch“, schrie das Kind nun so laut es konnte, “wo seid Ihr?“
Sévrans Herzschlag wurde schneller. Als er den Pfad zurückgelaufen war, hatte er festgestellt, dass er diesen Weg überhaupt nicht kannte. Während Aodrén ihm die Geschichte vom Hermelin und König Conan erzählt hatte, mussten sie vom üblichen Rückweg nach Rusquec abgebogen sein. Er konnte sich nicht daran erinnern, je hier geritten zu sein. Er hatte plötzlich das Gefühl, das der dunkle Wald um ihn herum Augen besaß. Er fühlte sich mutterseelenallein und trotzdem beobachtet. Aber es war nicht sein alter Mann.
Aodrén hätte gewiss auf sein verzweifeltes Rufen geantwortet. Sévran strengte seine Ohren an, doch da schnaubten nirgendwo zwei Pferde und keine eisenbeschlagenen Hufe zertraten das bunte Herbstlaub auf dem weichen Waldboden. Er fühlte nur ein stummes Augenpaar, das ihn beobachtete.
Vom ersten Schreck den alten Mann und die Pferde verloren zu haben, hatte der Knabe sich inzwischen erholt. Er atmete ein paar Mal tief durch, um seinen Herzschlag wieder unter Kontrolle zu bekommen, dann lies er sich mit geschlossenen Augen auf die Knie sinken. Der Wald war sein Freund. Die Bäume sprachen zu ihm, wenn er nur still genug war, um ihnen zuzuhören. Die Augen, die ihn durch die Dämmerung beobachteten bargen keine Gefahr. Er spürte nichts Schreckliches an diesem Ort. Sein Atem ging ganz flach, sein Herz schlug sanft und regelmäßig. Alles, was der Knabe jetzt noch fühlte, war der Wind der über seine Wangen strich.
Sévran wusste nicht mehr, wie lange er mit geschlossenen Augen auf dem weichen, feuchten Waldboden gekniet hatte. Die Augen, die er zuvor noch in den Bäumen versteckt gespürt hatte, fixierten ihn nun direkt. Er öffnete auch seine eigenen Augen wieder. In der Dämmerung erkannte er den jungen Hirsch. Gelassen stand das zierliche, anmutige Tier vor ihm auf dem Pfad. Sévran lächelte. Dann streckte er vorsichtig seine Hand aus. Der junge Hirsch legte den Kopf schief und blickte ihn aus braunen Augen fragend an.
Sévran hielt seinem Blick stand: „Gehörnter Bruder, zeig mir den Weg“, dachte der Knabe, „zeig mir den richtigen Weg zurück nach Hause.“ Das junge Tier machte ein paar vorsichtige Schritte. Seine weiche Nase berührte die Hand des Kindes. „Zeig mir bitte den Weg, gehörnter Bruder“, Sévran konzentrierte sich ganz auf den Hirsch. Sein filigranes Geweih deutete darauf hin, dass er gerade seinen ersten Herbst in diesem Wald verlebte. Sein Fell glänzte trotz der Dämmerung, wie Kupfer. Als die weiche Nase seine Hand berührte, hatte der Knabe das Gefühl, den Herzschlag des Hirsches in seiner eigenen Brust zu spüren. Er hatte keine Angst. Er war ganz ruhig und gelassen. Sein Geist und sein Körper waren rein und Kraft durchströmte ihn, wie ein erfrischender Fluss. Langsam erhob Sévran sich aus seiner knienden Haltung, um seinen wilden Gefährten nicht zu erschrecken. Der Hirsch verließ im Schritt den Pfad und bewegte sich zurück zwischen die Bäume. Er folgte ihm. Das schöne Tier bewegte sich lautlos über das Herbstlaub auf dem Boden. Immer tiefer führte es den Knaben in den Wald hinein. Plötzlich beschleunigte es und Sévran spürte, wie sein Herz schneller in ihm schlug und der Geist des Hirsches sich mit seinem Geist verband. Er fing an zu Laufen, um seinem wilden Gefährten zu folgen. Schneller und immer schneller rannte das Tier vor ihm durch den Laubwald. Wendig sprang es über Wurzeln und andere kleine Hindernisse hinweg. Sévran tat es ihm gleich. Er hatte seine Cotte und Surcotte mit der Linken gepackt, damit die langen, weiten Kleidungsstücke ihn nicht störten. Er folgte seinem Hirsch ohne Anstrengung. Nur das Schlagen seines Herzens in der Brust wurde immer schneller und lauter.
Irgendwann hatten sie den dichten Wald von Uhel Koad hinter sich gelassen und Sévrans Augen, die sich gut an die Dunkelheit gewöhnt hatten, erkannten die Schatten einer Mauer und einen soliden, gedrungenen Turms. Oben auf dem Turm brannte ein Feuer. Der Hirsch verlangsamte seine Gangart und kam zum Stehen. Der jüngste Sohn des Herzogs von Cornouailles tat es ihm gleich. Er brauchte ein paar Augenblicke um wieder zu Atem zu kommen. Dann präsentierte er seinem Begleiter erneut vorsichtig die rechte Hand: „Danke, gehörnter Bruder, das Du mich sicher nach Hause zurückgebracht hast“, dachte er. Der Hirsch berührte mit seiner weichen, feuchten Nase vorsichtig die ausgestreckte Rechte des Kindes, bevor er wieder mit raumgreifenden, elastischen Sprüngen im Uhel Koad verschwand, in dem er seit Anbeginn der Zeit lebte.
III
Es hatte eine ganze Weile gedauert, bevor Gilles sich von der handfesten Warnung des Bretonen erholt hatte. Dann war er benommen und zutiefst in seiner Ehre verletzt aus der schmutzigen Gosse vor der Taverne in Saint Pol sur Turnoise verschwunden. Seine Nase schmerzte immer noch heftig von dem herben Schlag des verdammten Richemont. Und der Knabe war über alle Masse wütend auf den Mann, der ihn so gedemütigt hatte.
Natürlich wussten weder sein Großvater, noch der Waffenmeister von Champtocé Yves De Kerma’dhec etwas von der nächtlichen Niederlage. Der junge Laval hatte ihnen lediglich berichtet, was er in der Taverne aufgeschnappt hatte: Die Information bezüglich der Gespräche zwischen d’Albret und Henry IV. über einen kampflosen Abzug. Die Tatsache, dass sowohl der Bretone Richemont als auch Alençon, Nevers und der Barbar mit dem Sigillenreif gegen ein direktes Blutvergießen waren und Amaurys Teilnahme an dem Saufgelage.
Die wenigen Stunden der Nacht, die nach dem Ausflug des Knaben in die Taverne von Saint Pol noch übrig geblieben waren, verbrachte er in großer Unruhe. Der Wind trug das Donnergrollen eines schweren Gewitters von der See bis zum Feldlager des französischen Heeres. Der feine Regen, der ihn in der Gosse vor der Taverne aufgeweckt hatte war zu einer richtigen Sintflut geworden. Draußen bewegten sich die Wachen seines Großvaters, nur um ein bisschen warm zu bleiben.
In der absoluten Finsternis, die er ansonsten immer als so beruhigend empfand, erschienen ihm nur Bilder des Schreckens: teuflische Visionen, lebendige Skelette, die tanzten, lodernde Feuer, aus denen widerliche Dämonen ihn ansprangen, die verwesenden Köpfe von Knaben, die sein Großvater dem Leibhaftigen geopfert hatte, um ihn in seinen magischen Kreis in den Gewölben der Festung von Champtocé zu locken. Gilles wälzte sich von einer Seite auf die andere. Die knochigen Hände der tanzenden Skelette versuchten ihn zu packen. Die toten Augen der geschlachteten Knaben wurden plötzlich lebendig. Sie lachten ihn aus. Sie machten sich über ihn lustig. Sie verspotteten ihn in der gleichen Weise, in der ihn die Waffenleute des Bretonen und des Barbaren aus Cornouailles vor der Taverne verspottet hatten, als er sich aus der Gosse hochrappelte, um wegzulaufen. Sie hatten Richemonts wüstes Schimpfen gehört. Sie hatten gehört, dass er ihn einen kleinen, schmierigen Dieb nannte, dem er die Hand abhacken sollte, um ihn zu bestrafen. Sie hatten seine Demütigung mit angesehen.
Als endlich das Sturmgewitter nachließ und der Wind die Wolken weiter fort ins Landesinnere der Picardie trug, fiel die Morgensonne blutrot durch den schmalen Spalt, den die schweren Vorhänge vor dem Eingang zum Zelt von Jean de Craon offen ließen. Mit einem Satz sprang Gilles von seinem Nachtlager und zog seine Stiefel an. Ohne abzuwarten, bis auch sein Großvater wach wurde, rannte er aus dem Zelt. Der Wind der Nacht hatte abgeflaut und es regnete. Die eiskalten, dicken, schweren Tropfen erfrischten ihn, als er zu den Pferden und den Waffenleuten von de Craon hinüberging. Manche von ihnen hatten es vorgezogen, die Nacht auf dem Pferderücken zu verbringen, um nicht im nassen Schlamm schlafen zu müssen. Ihre Tiere sahen erbärmlich aus.
„Er hat Nein gesagt“, hörte Gilles einen in einem gelb-schwarzen Waffenrock mit einem Eberkopf auf dem Rücken sagen. Der Mann sprach Französisch, doch sein Akzent war hart.
„Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als sie totzuschlagen“, antwortete Sohier du Bois de Hoves, der Seigneur du Bucq, de la Motte d’Hérignies. Der Ritter aus dem Norden war erst vor wenigen Tagen mit seinen Waffenleuten zu d’Albret und Boucicault gestoßen war. Die Flamen hatten ihre Zelte neben denen der Craon-Laval-Montmorency aufgestellt, weil ihnen die Gesellschaft eines kleinen Seigneur von den Ufern der Loire offensichtlich eher behagte, als die des Grafen d’Ostrevent und Seigneur d’Hertaing, der dem Konnetabel und dem Marschall von Frankreich in der Festung von Ohain seine Gastfreundschaft gewährte.
Mit einem Schlag verbesserte sich Gilles düstere Laune und die Müdigkeit der schlaflosen Nacht und des Zusammenstoßes mit Arzhur de Richemont fielen von ihm ab. Sie würden sich aufstellen und kämpfen. Nachdem er seinem Großvater und dem Leutnant von Champtocé, Yves De Kerma’dhec berichtet hatte, hatte Jean de Craon bereits laut überlegt, ob es nicht am besten war, einfach abzuwarten: Das Heer der Engländer sah nicht so aus, als ob es d’Albret und Boucicault lange Widerstand leisten würde.
Die Regenfälle hatten sich seit Ende September in eine wahre Flut verwandelt und was Henry IV. mit einer Woche abgetan hatte, als er Harfleur aufgab, war zu einem endlosen, trostlosen, verzweifelten und hungrigen Monat für die Engländer und ihren jungen König geworden. Als dann auch noch jede einzelne sichere Furt durch die Somme von französischen Truppen besetzt vorgefunden wurde, war Lancaster nichts anderes übrig geblieben, als seine ausgelaugten Männer auch noch auf einen Umweg über Voyennes zu führen. Schließlich gelang es der kleinen Truppe aus etwa neunhundert Rittern und fünftausend Fußsoldaten gegen alle äußeren Umstände und vehementen französischen Widerstand am Ende doch über den Fluss zu setzen und damit die letzte Etappe auf das rettende Calais und zu den wartenden Schiffen nach England zu eröffnen.
Für den Konnetabel von Frankreich Charles d'Albret und Jean Le Meingre de Boucicault, seinem Marschall waren diese dreißig Tage seit Harfleur allerdings ausreichend gewesen, um im Namen König Charles' VI. diese riesige französische Armee von fünfundzwanzigtausend Mann aufzustellen und sich den englischen Plänen entgegenzuwerfen.
Henry hatte im Verlauf der Belagerung von Harfleur bereits zweitausend Männer verloren. Nicht die Franzosen hatten sie umgebracht, sondern das Sumpffieber und der Hunger. Der lange Marsch hatte ihn weitere eintausend Männer gekostet. Das Ende der englischen Episode im nördlichen Frankreich war nach Aussagen von de Craon nicht mehr fern und dann würde das riesige Ritterheer sich wieder zerstreuen und alle Adeligen würden mit ihren Waffenleuten für den Winter zurück nach Hause ziehen. Der Großvater hatte vorgeschlagen einfach abzuwarten, bis der Weg der Männer aus Cornouailles sich von dem der Bretonen und Jean d‘Alençon trennen würde. Dann könnte man sie mit den Waffenleuten, die er von seinen Ländereien abgezogen hatte, irgendwo in der Nähe des Zauberwaldes von Paimpont an der Grenze zwischen dem Vannetais und Cornouailles überfallen.
Gilles schüttelte nur den Kopf, als er endlich vor De Kerma’dhec stand. Der hochgewachsene Waffenmeister von Champtocé, der bereits seit zwei Jahrzehnten in de Craons Diensten stand, lächelte seinen Lieblingsschüler an.
„Meister Yves, ich habe eine andere Idee“, erklärte Gilles. Dann stellte das Kind sich auf die Zehenspitzen und flüsterte dem Mann ein paar kurze Sätze ins Ohr.
„Wenn der Seigneur de Craon damit einverstanden ist, Mesire Gilles“, De Kerma’dhec winkte ein paar seiner vertrauenswürdigsten Männer herbei.
Der junge Laval grinste böse: „Natürlich wird mein Großvater damit einverstanden sein, Meister Yves. Er möchte den Reif genau so sehr besitzen, wie ich.“
IV
An diesem 25.Oktober 1415, als die Nacht dem Morgen wich und den Blick auf ein riesiges, französisches Ritterheer freigab, das auf der Ebene zwischen den Dörfern Azincourt und Tramecourt in drei Reihen Stellung bezog, waren die Aussichten für die kleine, vom Hunger geschwächte und demoralisierte englische Armee, die um das Dorf Maissoncelles unweit der Küste und an der Grenze zwischen der Normandie und Flandern ihr Lager aufgeschlagen hatte bestenfalls düster gewesen.
Anstelle des Kampfeseifer und der hohen Moral, mit der sie sich noch vor wenigen Wochen, im Hochsommer des Jahres bei Calais ausgeschifft hatten, um für Henry die Normandie, die Hand von Catherine de France und den Anspruch auf die französische Krone zu erstreiten, regierten nun Furcht und Zorn die Soldaten aus England.
Als die Nacht am Tag von Saint Créspin auf der Ebene zwischen Azincourt und Tramecourt dem Morgen wich, hatte alles danach ausgesehen, als ob diejenigen, die Charles d‘Albret, dem Herzog Charles von Orléans und seinem Schwiegervater Bernard d‘Armagnac im Namen des französischen Königs Charles VI. gefolgt waren, ein leichtes Spiel mit dem Taugenichts Henry V. und seinen Bogenschützen haben würden, die der englische König aus der niedrigsten und übelsten Bevölkerung seines Landes rekrutierte und die überhaupt nur für ihren Sold und eine Aussicht auf fette Beute kämpften.
Arzhur de Richemont seufzte leise, als er von seinem Streitross stieg. Die Engländer auf der anderen Seite waren nicht die einzigen, die unter dem strömenden Regen und dem Herbstwetter an der französischen Atlantikküste gelitten hatten: Um nicht auf dem durchweichten Boden schlafen zu müssen, hatten die meisten der Männer, die mit d'Albret aus Rouen hinauf nach Flandern gezogen waren auf dem Rücken ihrer Pferde geschlafen. Jedem vernünftigen Mann musste klar sein, das dies völliger Unsinn war, da weder Reiter noch Montur am nächsten Morgen ausgeruht sein konnten: Das Tier litt unter dem Gewicht, der Reiter unter der unbequemen Schlafstellung.
„Vernünftig ist hier sowieso keiner“, grummelte der junge Bretone vor sich hin und beobachtete einen Aufruhr zwischen Sohier du Bois de Hoves, einem Ritter aus dem Norden und dem Grafen d’Ostrevent. Beide Familien hatten seit mindestens zweihundert Jahren Streit miteinander. Es ging um irgendeinen Flecken zwischen Valenciennes und Cambrai an der Grenze zur Grafschaft Hainault oder vielleicht auch zu Flandern. Arzhur wusste es auch nicht mehr so genau und es war in dieser Situation bedeutungslos. Doch anstatt sich nebeneinander zu stellen und gemeinsam der englischen Bedrohung Frankreichs ins Auge zu sehen, beschimpften du Sohier du Bois und Ostrevent einander laut. Jeder wollte dem anderen beweisen, dass er der wichtigere Mann war und aus diesem Grund das Anrecht auf den Platz ganz vorne in der Angriffslinie mit in die Wiege gelegt bekommen hatte.
„Lächerlich“, entfuhr es de Richemont, „wenn ich meinen Stammbaum hervorhole und anfange Ansprüche zu erheben, die auf dem Alter meines Hauses beruhen, dann könnt Ihr beide einpacken und Euch ganz nach hinten zu den Trossmägden Pferdeknechten begeben.“
Natürlich würde der Bruder des bretonischen Herzogs so etwas Dummes und Unschickliches nicht tun. Sie hatten sich dazu durchgerungen, für den Valois Partei zu ergreifen. In diesem Herbst hatten er und Yann gemeinsam beschlossen für einen kurzen Augenblick die bretonischen Interessen hinten an zu stellen. Was Arzhur allerdings sah, seitdem sie Rouen verlassen und die Verfolgung der Engländer aufgenommen hatten, ähnelte mehr einer griechischen Tragödie, als einer militärischen Operation. Nachdem sie alle mehr oder weniger willig dem königlichen Ruf um Hilfe gefolgt waren, hatte der Gemeinschaftsgedanke sich bereits in dem Moment wieder aufgelöst, in dem d'Albret und Boucicault zum Aufbruch geblasen hatten.
„Jeder für sich“, spie der jüngste Bruder des bretonischen Herzogs verächtlich, nachdem er sein Schlachtross mit einem Pagen zurück ins Feldlager geschickt hatte, und versuchte seine Arbaletiers und Bogenschützen so aufzustellen, dass sie möglichst außerhalb der Reichweite der kümmerlichen Culverinen waren, die d' Albret dickschädelig durch den Schlamm und den Regen mitgeschleppt hatte.
Er würde zwar für den Valois kämpfen, aber dies bedeutete nicht, das er seine sorgsam ausgebildete, treue Miliz Valois-Kanonen opfern wollte, die aus einer anderen Zeit zu stammen schienen und hier gewiss nichts mehr zu suchen hatten. Hätte Richemont sein Wort zu sagen gehabt, er hätte diese Dinger schon lange eingeschmolzen und sie erst gar nicht mit nach Azincourt gebracht.
Vorne in der ersten französischen Linie herrschte Aufruhr; d'Albret hatte ritterlich dem kümmerlichen Haufen Engländer die bessere Position auf dem Feld von Azincourt überlassen, nachdem er den Emissären von Henry V. standhaft verweigert hatte, die kleine, in die Enge getriebene Truppe in Frieden abziehen zu lassen. Natürlich verstand Richemont den Hintergrund der Entscheidung des Konnetabels: Es waren nicht unbedingt Loyalität und Selbstlosigkeit, die sein gewaltiges Heer zusammenhielten...
Der Bretone warf einen Blick über die Schulter: Aorélian schien genauso verwirrt, wie er selbst. Nach dem Saufgelage der letzten Nacht war der Mann wieder er selbst und völlig bei Sinnen. Nicht einmal nach der dritten Flasche Apfelbrand hätte Douarnenez eine ähnliche Dummheit begangen, wie ein stocknüchterner d’Albret sie gerade machte. Aorélian hatte all seine Reiter absitzen lassen und sämtliche Pferde weggeschickt. Also war auch ihm schleierhaft, wie man zu Pferd auf einem frisch umgepflügten, zu beiden Seiten von Wald begrenzten, abfallenden Feld kämpfen sollte, dessen Größe kaum den Grundriss der herzoglichen Festung von Rennes ausmachte. Von den fünfhundert Bogenschützen aus Cornouailles war auch nichts zu sehen...
Richemonts Augen suchten nach den Bogenschützen und Aorélians jüngerem Bruder Glaoda de Léon: Noch vor einem Jahr war der nun zwanzigjährige Glaoda Knappe am Hof zu Rennes gewesen. Seinen Ritterschlag hatte er am Weihnachtstag 1414 erhalten, weil diese Nacht des 25.Dezember auch für ihn und die Anhänger der alten Religion Bedeutung besaß... wenn auch nicht um der Geburt Christi Willen.
Tief in seinem Inneren hoffte Arzhur, dass der junge Mann sich zu keiner Dummheit hinreißen lassen würde, nur um es ihm und Aorélian gleichzutun und endlich eine Kriegsfahne zu haben, die erkannt und respektiert wurde. Dieser Tag von Azincourt, der so gut hätte anfangen können, fing an zu stinken, wie ein Schweinepfuhl, obwohl die Herbstsonne noch nicht einmal im Zenit stand. Für Arzhur stank es auf dem frisch umgepflügten Acker, den zur Rechten das Dörfchen Tramecourt mit seinem Dutzend Höfen begrenzte, verhängnisvoll nach Dummheit und mangelnder Weitsicht. Er bereute bereits seine hehren Worte vom Vorabend in der Taverne von Saint Pol, als sie alle noch gehofft hatten, die Vernunft könne siegen.
Die Engländer hatten eine einzige Schlachtreihe aufgestellt. An der linken und an der rechten Flanke erkannte Richemont die Bogenschützen. In der Mitte sah er, wie die meisten der Berittenen absaßen und ihre Pferde wegschickten. Lancaster besaß die Kühnheit, ohne Reserven zu kämpfen.
Hinter Richemont schnaubte ein Pferd. „Sie reden immer noch, Arzhur“, riss ihn eine vertraute Stimme aus seinen nachdenklichen Betrachtungen über den Sinn und Zweck eines bewaffneten Zusammenstoßes mit dem König von England. Die Stimme gehörte dem Konnetabel des Herzogs von Cornouailles, Gud'wal Le Floa'ch de Morlaix. Gud'wal war der einzige von ihnen, der behaupten konnte über mehr militärische Erfahrung zu verfügen, als Grenzschutz zur Normandie, Dauerfehden mit unvernünftigen Nachbarn, lokale Machtkämpfe oder die Vernichtung irgendwelcher Horden von Strauchdieben. Er hatte einst als junger Mann drüben auf der anderen Seite des Meeres zusammen mit seinem Herzog Ambrosius Arzhur gegen den Königsmörder Henry IV. gekämpft, an der Seite von König Cadwalladr Owain Glyn Dwyr, als die Waliser es endlich leid gewesen waren, sich wie Vieh von den sächsischen Eindringlingen abschlachten zu lassen. Yann, sein eigener Bruder hatte dem Cadwalladr damals ebenfalls Männer geschickt, doch er selbst war in diesen Tagen noch ein Kind gewesen. „Und?“
„Es ist wie immer, Arzhur“, antwortete Gud’wal mit hängendem Kopf, „der alte Berry rät einfach abzuwarten, bis das Lumpenpack da drüben verreckt. Zu beißen haben sie schon seit Tagen nichts mehr gehabt. Sie können weder nach vorne, noch zurück und an der Seite kommt nicht einmal eine Maus aus diesem Kessel.“
Richemont nickte. Berry hatte Recht. Berry erinnerte sich noch an das Debakel von Poitier im Jahr 1356, als die Engländer mit einer kümmerlichen Truppe Berittener und sechstausend Bogenschützen in einer ähnlich kühnen Angriffsformation ein anderes überhebliches, organisationsloses französisches Ritterheer von gut und gerne fünfundzwanzig tausend Mann in Grund und Boden gestampft hatten. Damals hatte der „Schwarze Prinz“ Edward Plantagenêt den französischen König Jean II. gefangengenommen. Ein böses Omen. Wieder waren sie fünfundzwanzigtausend und wieder stand auf der anderen Seite eine bessere Räuberbande mit knapp sechstausend Bogenschützen und wieder befehligte den Haufen… Nein, er war nicht mehr Thronfolger! Er trug nicht mehr provokant diesen Titel „Prinz von Wales“, diesen geraubten Titel, der alleine dem Erben des Owain Glyn Dwyr aus dem Haus Pendragon zustand. Henry war nun selbst König und sein Vater, der Thronräuber und Mörder, hatte Zeit genug gehabt, aus dem kleinen, nichtsnutzigen Bastard einen richtigen Kriegsmann zu machen.
„Es hilft nichts, Gud’wal“, sagte Richemont traurig zu Le Floa’ch de Morlaix, „sie werden nicht auf den alten Berry und seine Weisheiten hören. Sie sind gekommen, um sich zu amüsieren, um den anderen zu zeigen, wie wagemutig und unverwundbar sie doch sind. Sie sind hier, um ganz vorne zu stehen und den Engländer zu verspotten...“
„Das befürchten d’Albret und Boucicault auch, mein Freund!“ Der Konnetabel des Herzogs von Cornouailles wendete sein stämmiges, normannisches Kriegspferd. „Pass auf Dich auf, Arzhur“, rief er dem jüngsten Bruder des bretonischen Herzogs zu, bevor er sich auf den Weg zu seinen eigenen Leuten machte.
V
Gilles betrachtete das Schauspiel fasziniert von seinem Versteck aus. Sein Großvater hatte zugestimmt. Hinter ihm lagen sechs Männer und Yves De Kerma’dhec in den Büschen. Er hatte schon lange darauf gebrannt, eine echte Schlacht aus nächster Nähe zu sehen.
Weder der verfluchte Richemont noch der Kelte Douarnenez drängelten sich in der vordersten französischen Linie. Beide verzichteten auf ihre Pferde und kämpften zu Fuß. Die Bogenschützen und Arbaletiers aus der Bretagne und aus Cornouailles gingen in diesem Augenblick am Waldrand unweit von Gilles’ Versteck in Stellung.
Das Feld von Azincourt war im totalen Chaos versunken, nachdem die englischen Bogenschützen stumm und diszipliniert nach vorne gegangen waren. Dann hatten sich plötzlich Tausende von Pfeilen wie eine drohende Wolke vor die Herbstsonne gelegt und das Schlachtfeld verdunkelt. Als sie auf die wartenden, französischen Ritter in ihren schweren Rüstungen niedergeprasselten, war der Lärm beinahe unerträglich gewesen. Obwohl die Engländer ihre Langbogen aus der weitest möglichen Entfernung in den Feind geschossen hatten, schrien französische Pferde vor Schmerz, wo die Spitzen der Pfeile sich durch dünne metallene Schutzpanzer hindurch tief in ihr Fleisch gruben. Nach den ersten verheerenden Salven rammten die Engländer lange, scharf angespitzte hölzerne Speere in den Grund und versteckten sich dahinter, um den Angriff der französischen Ritter zu empfangen. Dann zogen sie neue Pfeile aus ihren Köchern und warteten gelassen. Schließlich geschah das Unvermeidliche: Die Franzosen beschlossen mit der schweren Reiterei nach vorn zu gehen.
Die englischen Langbogen schossen die erste Reihe französischer Ritter ab, wie beim Scheibenschießen. Die Pferde der nachfolgenden Reihe stürzten über die Gefallenen oder schlidderten im Matsch in die angespitzten Holzpflöcke hinter denen die Männer von Lancaster sich verbargen. Aus dem Chaos auf dem Feld von Azincourt wurde Panik. Leichen türmten sich übereinander auf, Pferdekadaver versperrten den Weg, verrücktgewordene, reiterlose Schlachtrösser zertrampelten gleichermaßen zu Fuß kämpfende Engländer und Franzosen. Ein neuer Hagel von Pfeilen prasselte auf alle herab.
Gilles leckte sich die trockenen Lippen. Er konnte kaum noch atmen; das Schauspiel das sich ihm bot war einzigartig und aufregend. Drei Engländer hatten einen französischen Ritter, der vom Sturz noch betäubt auf dem Boden lag mit ihren Beilen in Stücke gehauen, wie ein Stück Vieh auf der Schlachtbank. Sie hatten genau gewusst, wo seine Rüstung keinen Schutz vor ihren Waffen bot. Einen anderen massakrierten sie gerade mit Spießen. Der Mann stieß einen letzten heiseren Schmerzensschrei aus, bevor sein Kopf zur Seite fiel und Blut aus Mund und Nase in den braunen Schlamm floss. Obwohl der Knabe das grauenhafte Blutvergießen und schreckliche Sterben auf dem Feld von Azincourt genoss, verlor er doch nicht sein Ziel aus den Augen: Die Kriegsfahnen des verfluchten Richemont und des Barbaren Douarnenez.
Die weiße Fahne des Bretonen hing bereits in Fetzen. Pfeile hatten sie durchbohrt. Doch Arzhur de Richemont kämpfte, wie ein Löwe gegen die zahllosen Engländer, die auf ihn einstürmten. Offensichtlich hatten diese nicht im Sinn, den Bretonen abzuschlachten. Sie wollten ihn lebend gefangen nehmen. Herzog Yann würde für seinen jüngsten Bruder ohne lange zu fackeln ein kokettes Sümmchen Lösegeld bezahlen. Der langhaarige Barbar Douarnenez war in ähnlicher Bedrängnis, doch ihm gegenüber zeigten die englischen Angreifer sich weniger reserviert als mit Arzhur de Richemont. Gilles konnte nur annehmen, dass der Mann entweder weniger Lösegeld wert war, oder das Henry IV. spezielle Anweisungen gegeben hatte. Douarnenez hatte nicht nur einfache gierige Fußsoldaten mit Beilen und grob geschmiedeten Beidhändern zum Gegner. Das Kind sah, wie ein englischer Ritter mit einem auffälligen roten Waffenrock auf dem drei Löwen in Gold aufgestickt waren auf das Kriegsbanner des jungen Aristokraten deutete und seinen Männern zubrüllte, sie sollten den gottlosen Hexenmeister und Zauberer totschlagen und endlich Rache für den Earl of March und die Demütigung von Pilleth nehmen.
De Kerma’dhec, der direkt neben dem Knaben in den Büschen verborgen lag, pfiff anerkennend durch die Zähne, als Douarnenez einem seiner Angreifer mit einem einzigen Schlag den Schädel spaltete. Doch der geschickte Streich wurde dem Barbaren zum Verhängnis. Der Engländer fiel, wie eine vom Blitz gefällte Eiche nach vorne und brachte Douarnenez aus dem Gleichgewicht. Noch bevor der junge Mann sich wieder hochrappeln konnte, hatte sich der im roten Waffenrock auf ihn geworfen, der Rache für March gefordert hatte. Douarnenez besaß in diesem Augenblick der Lebensgefahr nur noch den Vorteil des leichteren Kettenhemdes und der größeren Beweglichkeit. Er sah den schwer gepanzerten Angreifer und packte seinen Anderthalbhänder mit beiden Händen. Damit rettete der Barbar zwar sein Leben, doch der zweite Tote der auf ihn gestürzt war und auf seinem Schwert, wie auf einem Pfahl aufgespießt steckte, verurteilte ihn zur Bewegungslosigkeit im tiefen Schlamm. Gilles grinste de Kerma’dhec an. Wie ein Opferlamm ausgestreckt auf der Schlachtbank. Der Mann hatte keine Chance mehr. Das Gewicht der beiden Toten und der weiche Boden waren sein Verhängnis.
VI
Gud'wal Le Floa‘ch de Morlaix öffnete mit zitternden Fingern die ledernen Schließen, die die Brust- und Rückenplatten seiner blutigen und dreckigen Kampfrüstung miteinander verbanden. Jeder Knochen in seinem Leib schmerzte. Seine Kehle war so ausgetrocknet, dass selbst das Schlucken ihm wehtat. Seine Augen brannten vom Schweiß, vom Blut, das aus einer hässlichen Wunde auf seiner Stirn über sein dreckiges Gesicht floss und von den Tränen, die er schon lange nicht mehr zurückhielt. Er hatte sie fallen sehen. Beide. Seine Lippen waren aufgeplatzt und brannten. Blut rann über sein glatt rasiertes Kinn unter den nassen, hohen ledernen Kragen, der seine Kehle und seinen Nacken schützte. Vorsichtig schob er die schweren Metallteile der Rüstung unter einen Weißdornstrauch. Er wusste, dass der leiseste Ton, das geringste Geräusch seinen Tod bedeuten konnten. Noch im Schein der Fackeln zogen sie über das blutige Feld. Die Schlachterei im hellen Licht der Oktobersonne, die einer stürmischen Regennacht gefolgt war, hatte ihnen offenbar nicht gereicht. Der Konnetabel von Cornouailles nahm seine Beinschienen ab und verbarg sie dort, wo schon die anderen Teile seiner Rüstung im Schlamm lagen. Dann lies er sich erschöpft gegen einen Baumstamm sinken. Er hatte jede Kontrolle über seine Augen verloren und ein langer, stetiger salziger Fluss grub tiefe Rinnen in den Schmutz auf seinen Wangen. Für einen kurzen Augenblick erlaubte Gud’wal sich, noch einmal um sie zu weinen.
Irgendwo dort draußen lagen sie alle im Schlamm: Beide Brüder des Herzogs von Burgund. Der mutige, junge Graf Phillipe von Nevers und Jean Herzog von Alençon. Edouard Herzog von Bar und Charles d‘Albret der französische Konnetabel. Marle und Fauquembergues, die im letzten Augenblick mit sechshundert Berittenen eine verzweifelte Attacke gegen Henry versucht hatten, um das Rad des Schicksals vielleicht doch noch herumzureißen. Amaury de Craon, der mit seinem eigenen Vater gebrochen hatte, um neben Arzhur de Richemont und für Breizh zu kämpfen. Aorélian de Douarnenez, sein eigener junger Herr, der noch am Morgen klug genug gewesen war, seine Pferde fortzuschicken und seine Reiter zu Fuß kämpfen zu lassen und Glaoda de Léon. Sein kleiner Glaoda, um den er das letzte Mal geweint hatte, als der Jüngling, stolz wie ein König den hübschen Roussin bestieg, den der Herzog Ambrosius ihm geschenkt hatte, damit er auch als Knappe am Hof zu Rennes eine gute Figur machte.
Gud’wal hatte plötzlich das Gefühl, es wäre erst gestern gewesen. Der Konnetabel von Cornouailles presste die schmutzige, zitternde Hand fest auf den Mund, um ein Schluchzen zu unterdrücken. Sein kleiner Glaoda, um den er zum letzten Mal geweint hatte, als er mit vierzehn Jahren losgezogen war, um ein Ritter zu werden. Gud’wal hatte damals Freudentränen geweint, denn er war so stolz auf den Jungen gewesen, so stolz, als Yann de Montforzh, der junge Herzog der Bretagne den Boten nach Concarneau entsandt hatte, der Glaoda einlud, seine Ausbildung in der Kriegskunst am Hof zu Rennes zu beenden. Glaoda dem das Schicksal nicht einmal die Gunst erwiesen hatte, wie ein wahrer Ritter im Kampf Mann gegen Mann zu sterben.
Gud'wal schloss kurz beide Augen und atmete tief durch: Das waren die, die er selbst in ihrem Blut hatte liegen sehen, weißes, zerschlagenes Fleisch gnadenlos dem bisschen Würde beraubt, das ein Mann im Tode noch haben konnte. So hatte er den Erben von Cornouailles gefunden; halb begraben unter den Leichen der Engländer, die er totgeschlagen hatte, bevor das Schicksal ihn selbst ereilte. Sein nackter Oberkörper von tiefen Hiebwunden übersäht, die Linke mit der er seinen Schild mit den stolzen Quinotauren und dem Pentagramm noch im Tode festgehalten haben musste abgeschlagen, der Schild und sein Schwert verschwunden... und genau so der rechte Arm und mit ihm der Sigillenreif des Cadwalladr.
Als der elende Lancaster den Befehl gegeben hatte wertlose Gefangene totzuschlagen, um den Zug nach Calais nicht zu belasten, hatte das englische Gesindel sofort, damit angefangen die gefallenen französischen Ritter auf dem Feld von Azincourt systematisch zu plündern, um damit den Verlust an Lösegeld wettzumachen, das die französischen Gefangenen eingebracht hätten. Was sich neben den Kadavern, die stellenweise in richtigen Haufen lagen noch regte erschlugen sie ohne Umschweife.
Als der elende Lancaster den Befehl gegeben hatte wertlose Gefangene totzuschlagen, da hatte sein kleiner Glaoda sich geweigert, die Seite seiner Bogenschützen zu verlassen und sich zu denen zu gesellen, die ein Lösegeld einbrachten. Er war zusammen mit den Bauern und Fischern seines Vaters gestorben, durchbohrt von den Pfeilen der englischen Söldner, die die Einzigen gewesen waren, die die Ehrlosigkeit besaßen, um einer Handvoll Goldstücke Willen und gegen die Vorschriften der Ritterlichkeit Unbewaffnete abzuschlachten.
An diesem Morgen waren sie achthundert Männer aus Cornouailles gewesen, einhundert fünfzig Berittene, fünfzig Armbrustschützen von der Festung von Concarneau und sechshundert aus der Bauernmiliz, die sich freiwillig gemeldet hatten, um den beiden ältesten Söhne ihres Herren in den Krieg zu folgen. Gud’wal wischte sich mit dem Ärmel die Tränen und den Dreck aus dem Gesicht, dann zog er sich langsam an dem Baum, der ihm Halt und Trost gespendet hatte auf die Beine. Dieses Feld des Elends und der Schrecken war nicht der Ort, um Aorélian und Glaoda zu betrauern und vielleicht auch um Arzhur de Richemont zu weinen. Er musste fort von hier, zurück zu seinem Herzog und ihm berichten was an diesem Tag von Saint Créspin in der Picardie geschehen war. Er musste nach Hause, nach Cornouailles, bevor Gerüchte seinen Herren erreichten; Gerüchte darüber, dass sie sich erbärmlich geschlagen hätten und von einer Handvoll halb verhungerter Engländer besiegt worden wären... Gerüchte über das Ende der Welt.
Ambrosius musste erfahren, wie über dem leblosen Körper seines Erben ein halbes Dutzend toter Sachsen aufgetürmt gelegen waren, die Aorélian mit nach Inis Gwenva, in die weiße Welt genommen hatte und er musste wissen, dass Glaoda die Seinen selbst im Tod nicht im Stich gelassen hatte, sondern hocherhobenen Hauptes und stolz zu seinen Göttern heimgekehrt war. Gud’wals ausgetrocknete, brennende Augen wanderten über das desolate Feld. Er brauchte ein Pferd um nach Hause zu gelangen, ein unverletztes, solides Tier das ihn die weite Strecke zurück nach Cornouailles tragen würde.
Der Fluch von Azincourt hatte sich über das Haus der Valois und über ganz Frankreich gelegt.
Der Konnetabel von Cornouailles schwang sich in den Sattel. Er hatte einen dunkelbraunen Hengst am Rand des kleinen Waldes, in dem er sich versteckt gehalten hatte beim Grasen überraschen können. Mit ein wenig Glück und der Gunst der alten Götter würde er noch vor dem ersten Schnee im Argoat und auf Rusquec sein, wo der Herzog Ambrosius Arzhur sich traditionell während der Wintermonate zur Jagd aufhielt. Und sobald er den heiligen Berg, den man jetzt nicht mehr Tombelaine sondern Mont Saint Michel nannte, erreicht hatte, würde er durch sicheres Gebiet reiten, in dem der Name seines Herrn für die Menschen immer noch wichtiger war, als der von Henry Lancaster oder Charles de Valois.