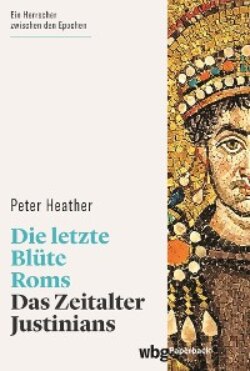Читать книгу Die letzte Blüte Roms - Peter Heather - Страница 16
Anastasios, der glücklose Kaiser
ОглавлениеEin ausführlicher Bericht über die Wahl von Anastasios zum Kaiser ist in einem Text aus dem 10. Jahrhundert, dem sogenannten Zeremonienbuch, überliefert. Nachdem im April 491 der isaurische Kaiser Zenon gestorben war, begab sich dessen Witwe Ariadne, die Tochter von Zenons Vorgänger Leo I., zum Hippodrom, das 100 000 Zuschauer fasste. Es war wahrscheinlich voll besetzt, wie bei einem Anlass wie diesem üblich, wenn die Kaiserin vor die versammelte Bevölkerung der Reichshauptstadt trat, um sie zu fragen, was sie von ihrem neuen Kaiser erwartete. Die Untertanen kommunizierten mit ihrer Kaiserin in Form von Zurufen. Es begann ganz konventionell:
Ariadne Augusta, mögest du siegen!
Heiliger Vater, gib ihr ein langes Leben!
Herr, erbarme dich!
Viele Jahre für die Augusta!
Bis hierhin erinnerte das Ganze stark an die Akklamationen, mit denen die versammelten Senatoren Roms am Weihnachtstag 438 die Veröffentlichung eines neuen kaiserlichen Gesetzesbuches, des Codex Theodosianus, bejubelt hatten.1 Doch genau wie bei der Codex-Zeremonie wurden die Akklamationen bald spezifischer. Die Bevölkerung der Hauptstadt erwartete von ihrem neuen Kaiser zweierlei: Er sollte ein orthodoxer Christ sein, und er sollte ein Römer sein. Diese Wünsche nahm Ariadne mit in den nahe gelegenen Kaiserpalast; ein geschlossener Gang führte von der Königsloge des Hippodroms direkt in den Palastkomplex. Es folgte eine Diskussion mit den versammelten Senatoren, und am Ende wurde vereinbart, dass die Kaiserin die endgültige Entscheidung selbst treffen würde. Ihr Votum fiel schließlich auf den sechzigjährigen Anastasios, einen langjährigen Palastmitarbeiter, der als silentarius für die Überwachung des Personals im Palast zuständig war. Kurze Zeit später heiratete sie ihn, um dem neuen kaiserlichen Regime den Anschein der Kontinuität zu verleihen und es damit zu legitimieren.
Wie bei den meisten öffentlichen Zeremonien der späten Kaiserzeit haben wir Grund zu der Annahme, dass der Austausch zwischen Ariadne und der konstantinopolitanischen Gruppe, der ihr Fokus galt, sorgfältig choreografiert war. Um bei einer solchen Versammlung die Antworten zu bekommen, die man hören wollte, musste man sich vorab an die Zirkusparteien wenden, die das Geschehen im Hippodrom kontrollierten. Diese (die Blauen, Grünen, Roten und Weißen) waren die Fanklubs der großen Wagenrennteams, zugleich aber Mafia-ähnliche Organisationen, die in »ihrem« Teil der Stadt eine ganze Reihe von Geschäften entweder selbst betrieben oder zumindest am Gewinn beteiligt waren. Im Gegenzug sorgten sie in der Stadt für Recht und Ordnung. Wenn man wollte, dass die Menschen im Hippodrom etwas Bestimmtes brüllten, musste man den Chefs der Zirkusparteien ein Angebot machen, das sie nicht ablehnen konnten. Meistens ging es um Geld, aber in diesem Fall deuten die Akklamationen auf etwas Spezifischeres hin.
Die wichtigste Schnittstelle zwischen den Zirkusparteien und der kaiserlichen Regierung war der Stadtpräfekt, so etwas wie Konstantinopels (ernannter, nicht gewählter) Bürgermeister. Die Art und Weise, wie der Präfekt die Stadt regierte, berührte stets die grundlegenden Interessen der Zirkusparteien. Bevor sie das Volk fragte, was es vom neuen Kaiser erwarte, hatte Ariadne es gefragt, was es von ihr erwarte. Die Leute riefen, sie wollten einen neuen Präfekten, und Ariadne – so war es mit Sicherheit vorher abgesprochen – stimmte zu.2
Die Forderung, der neue Amtsinhaber solle »Römer« sein, hatte in diesem Kontext eine ganz besondere Bedeutung. Sie bedeutete nämlich im Umkehrschluss, der Kaiser solle nicht wie Ariadnes verstorbener Mann Zenon ein Außenseiter aus Isaurien sein. Vor allem einen ganz prominenten Thronanwärter sollte diese Formulierung ausschließen: Longinus, Zenons Bruder. Longinus war mit Zenon durch dick und dünn gegangen – er hatte praktisch dessen gesamte Regierungszeit lang verzweifelt dafür gekämpft, seinem Bruder die Macht zu sichern; er verbrachte sogar zehn Jahre als Geisel in den Händen von Zenons Widersacher, dem isaurischen Kriegsherrn Illus. Als Longinus 485 endlich seine Freiheit wiedererlangte, wurde er von Zenon großzügig belohnt: Er wurde zum kommandierenden Feldherrn der höherrangigen der beiden Praesentalis-Armeen ernannt, bekleidete also nun den höchsten militärischen Rang im Reich, und zum Konsul für das Jahr 486. Zwischen 485 und 491 war er eine prominente Figur im öffentlichen Leben und eines der führenden Mitglieder des kaiserlichen inner circle aus Isaurern. Zu diesem gehörte noch ein weiterer Isaurer namens Longinus; dieser kontrollierte in der zweiten Hälfte von Zenons Regierungszeit (484–491) als oberster Verwaltungsbeamter (magister officiorum) einen Großteil der kaiserlichen Bürokratie. Die übliche Amtszeit für eine solche Stelle betrug tendenziell eher ein, zwei Jahre, nicht sechs oder sieben.
Wenn man also im Hippodrom 100 000 Menschen brüllen ließ, sie wollten einen »echten« Römer als nächsten Kaiser, dann bedeutete das nichts anderes, als dass Longinus aus dem Rennen war.3 Mit anderen Worten: Die Versammlung im Hippodrom war Teil eines sorgfältig inszenierten Staatsstreichs, den Ariadne und ihre Verbündeten in einem ganz entscheidenden Moment des Thronfolgeprozesses initiierten.
Trotzdem war die Strategie der Kaiserin keine sichere Bank: Denn es war immer möglich, dass jemand anderes den Zirkusparteien ein noch besseres Angebot machte; daher konnte man vorher nie genau wissen, was geschehen würde (wie Hypatius im Jahr 532 feststellen musste). Angesichts dieser brisanten Vorgänge ist es fast ein wenig ungerecht, Anastasios als »erfolglosen Kaiser« zu bezeichnen. Im Grunde war es allein schon eine große Leistung, dass er im hohen Alter von 87 Jahren friedlich in seinem eigenen Bett starb.
Dass in der Politik in Konstantinopel so viele Isaurer mitmischten, verdankte sich militärischer Notwendigkeit. Angesichts der massiven Übergriffe der Hunnen im 5. Jahrhundert brauchte Konstantinopel neue Truppen, und zwar schnell. Die Isaurer halfen, dieses unmittelbare militärische Problem zu lösen, aber ihre Rekrutierung in die Feldarmeen und die Beförderung ihrer Offiziere hatten enorme politische Konsequenzen. Ab dem Zeitpunkt, als mehrere Isaurer zu Feldarmeekommandanten (magistri militum) aufgestiegen waren, übten sie beträchtlichen Einfluss auf das Kaiserhaus aus. In den 460er-Jahren gab es unter Leo I., Ariadnes Vater, bereits sehr viele Isaurer bei Hofe, und sie waren so tief in die konstantinopolitanische Politik verstrickt, dass der Kaiser sogar seine Tochter mit einem Isaurer verheiratete – um ein Gegengewicht zu einem übermächtigen Feldherrn namens Aspar zu schaffen, der eine besondere Bindung zu der großen Gruppe der thrakisch-gotischen foederati hatte. Am Ende ließ Leo Aspar ermorden (daher Leos Beiname »der Schlächter«). Die thrakischen Goten wandten sich daraufhin von Rom ab, und die meisten von ihnen schlossen sich in den 480er-Jahren der neuen Koalition an, die der Ostgote Theoderich in den 470er- und 480er-Jahren auf dem römischen Balkan ins Leben rief und mit der er 488/489 kurz vor Zenons Tod in Italien einmarschierte. Um 491 waren die Isaurer nicht nur ein stabiles Element in der Politik von Konstantinopel, sie hatten auch jede Menge extreme Kampferfahrung, und sie nutzten ihre langjährigen Beziehungen zu einzelnen Gruppen isaurischer Soldaten dazu, ihre Macht zu sichern.4
Zenons Aufstieg zur Macht hatte in den 460er-Jahren begonnen, als er sich gegen rivalisierende Feldherren aus den Reihen der thrakischen Goten durchsetzte, um schließlich ins Kaiserhaus einzuheiraten. 474 wurde er alleiniger Kaiser, nachdem sowohl sein Schwiegervater als auch sein Sohn mit Ariadne, Leo II., gestorben waren; aber das war erst der Anfang der Misere. Bis aufs Messer musste er seinen Thron gegen seine Widersacher innerhalb des konstantinopolitanischen Establishments verteidigen – allen voran seine Schwiegermutter, Leos Witwe Verina –, aber auch gegen mehrere Goten und sogar rivalisierende isaurische Kriegsherren wie Illus, der Longinus zehn Jahre lang als Geisel hielt. Zenon selbst verbrachte während der Usurpation von Basiliscus, Verinas Bruder, Mitte der 470er-Jahre achtzehn Monate im Exil in Isaurien; dort hob er eine Armee aus, mit der er am Ende Konstantinopel wieder einnahm. Gegen einen anderen Usurpator, den Feldherrn Leontius, der sowohl von Verina als auch von Illus unterstützt wurde, führte er vier Jahre lang Krieg.
Zenons Herrschaft war geprägt von Exil wie auch von Krieg, Intrigen und Attentaten – alle diese mal mehr, mal weniger erfolgreich. Der springende Punkt ist, was die jetzt anstehende Thronfolge anbelangt: Die Isaurer würden niemals einfach so klein beigeben, nur weil Ariadne und ihre Spießgesellen am Morgen nach Zenons Tod die Menschenmenge im Hippodrom dazu brachten, nach ihrer Pfeife zu tanzen.5
Binnen eines Jahres trennte das neue Regime Zenons Bruder Longinus von seiner Familie und schickte ihn in die Verbannung in ein ägyptisches Kloster; die übrigen Angehörigen wurden gezwungen, nach Bithynien am Schwarzen Meer überzusiedeln. Aber der andere Longinus, Zenons ehemaliger magister officiorum, war nach wie vor auf freiem Fuß, und Zenons Schergen ließen sich nicht ohne Weiteres aus den inner circles der Macht entfernen.
492 erhob sich ein Großteil der Isaurer innerhalb des Militärapparats gegen den neuen Kaiser. Rädelsführer waren ein gewisser Konon, der früher der Bischof von Apameia gewesen war, und der damalige Statthalter von Isaurien, Lilingis. Es war eine gefährliche Situation, aber das Regime hatte in den östlichen und den Praesentalis-Feldarmeen ausreichend loyale Truppen zur Verfügung, um die Rebellen in der Schlacht bei Kotiaion (dem heutigen Kütahya) besiegen zu können. Lilingis fiel in dieser Schlacht. Der Versuch, mit Gewalt einen neuen Kaiser zu installieren, war nun passé, und die überlebenden Rebellen flohen zurück in die Berge, wo sie im verbliebenen Jahrzehnt immer wieder für Unruhe sorgten. Nach und nach wurden die Anführer der Rebellen aber zur Strecke gebracht. Konon wurde 493 getötet, vier Jahre später wurde Longinus gefasst; seinen Kopf steckten die Häscher auf eine Stange und schickten ihn nach Konstantinopel, wo er mit großem Jubel empfangen wurde. Zwei weitere Rebellenführer, die noch auf freiem Fuß waren (darunter schon wieder ein Longinus), gingen den Truppen des Kaisers schließlich im Jahr 498 ins Netz. Sie brachte man nun lebendig nach Konstantinopel und führte sie durch die Straßen, um sie der Lächerlichkeit preiszugeben; den dritten Longinus schickte man dann nach Nicäa, folterte ihn und richtete ihn hin. Erst jetzt war der Isaureraufstand endgültig niedergeschlagen.6
Dass Anastasios’ Regime gleich zu Beginn eine solche Krise meisterte, war keine geringe Leistung. Eine ganze politische Generation einflussreicher Isaurer, die dafür gesorgt hatten, dass im Herzen des Imperiums das Mächtegleichgewicht aus den Fugen geriet, war ausgerottet. Man darf durchaus behaupten, dass Anastasios’ weitere Herrschaft durch sorgfältige und – zumindest für spätantike Verhältnisse – relativ effiziente administrative Kompetenz gekennzeichnet war. Unter anderem gab es eine Steuerreform, im Rahmen derer ein Großteil der bisherigen Sach- in Barzahlungen umgewandelt wurden, was es erheblich erleichterte, Steuern zu erheben und zu verteilen (wenn auch nicht unbedingt zu bezahlen). Die Quellen urteilen durchweg positiv darüber, wie Anastasios das Imperium regierte.7 In einem ganz zentralen Punkt hatte er allerdings überhaupt kein glückliches Händchen: bei der Thronfolge.
Anastasios war sechzig Jahre alt, als er den Thron bestieg, und die Kaiserin, Zenons Witwe, ungefähr vierzig, also hätten sie vielleicht gerade noch einen Thronfolger hervorbringen können, doch das taten sie nicht (ob gezielt oder ob es einfach nicht gelang, wissen wir nicht, aber ich vermute Ersteres). Dass Anastasios keinen eigenen Erben hatte, hinderte ihn jedoch nicht daran, enge Familienangehörige auf prominente Positionen zu setzen. Er hatte drei Neffen, Kinder seiner zwei Schwestern: Pompeius, Probus und Hypatius, der sein Favorit war. Pompeius erhielt das Konsulat für das Jahr 501 und später, gegen Ende von Anastasios’ Herrschaft, ein wichtiges Militärkommando (wahrscheinlich als Oberbefehlshaber der thrakischen Feldarmee). Probus war 502 Konsul, doch das blieb bis zur Herrschaft Justins sein einziger hoher Posten. Hypatius hingegen war bereits während des Isaureraufstands ein bedeutender Militärkommandant, und er war der erste Neffe des Kaisers, der ein Konsulat erhielt (500); in den ersten zwei Jahrzehnten des 6. Jahrhunderts erhielt er diverse hochrangige Feldherrnposten: 503 und noch einmal zehn Jahre später war er magister militum praesentalis, dazwischen Oberbefehlshaber der thrakischen und der östlichen Feldarmee.
Zweifellos war er bei seinem Onkel besonders wohlgelitten, und zweifellos sah sich Hypatius selbst als rechtmäßigen Thronfolger – dieser Ehrgeiz sollte noch ganz deutlich zutage treten, später, Anfang der 530er-Jahre. Doch Anastasios unternahm keinerlei Schritte, seinem Lieblingsneffen die Thronfolge zu sichern. Der Kontrast zu Justin, der in den 520er-Jahren Justinian allmählich zu seinem Nachfolger aufbaute (525 war Justinian Caesar, 527 Augustus), ist deutlich. Anastasios’ Verhalten wird normalerweise – und korrekterweise, wie ich finde – so interpretiert, dass ihm das nötige politische Kapital fehlte, um einen solchen Schritt zu wagen, ohne dass er auf erbitterten Widerstand seitens der anderen Interessenten an seinem Hof gestoßen wäre.8 Sein Verhalten spiegelte teilweise die Art und Weise wider, wie er selbst auf den Thron gekommen war, wie auch die vielen unschönen Vorfälle während seiner Regierungszeit.
Als Kandidat für den Thron war Anastasios von vornherein ein Kompromiss gewesen. Ein sechzigjähriger Beamter bei Hofe ohne Kinder und mit wenig Zeit, noch welche zu zeugen: Der Grund, weshalb sich alle auf so einen Kandidaten einigten, lag wohl in erster Linie darin, dass man Longinus auf dem Thron verhindern wollte. Wie bereits erwähnt, starb Anastasios erst mit 87 Jahren und übertraf damit bei Weitem die damalige Lebenserwartung. Genau wie heute, wenn ein hochbetagter Kardinal zum Papst gewählt wird, gingen Anastasios’ Hintermänner im Jahr 491 wahrscheinlich davon aus, dass er es ohnehin nicht mehr allzu lange machen würde – eine kurzfristige Lösung für das Isaurer-Problem, weniger riskant, als wenn man eine Dynastie auf den Thron setzte, die den kaiserlichen Purpur auf lange Sicht nicht mehr aus den Händen geben würde (wie geschehen im Falle der Theodosianischen Dynastie, die Ende des 4. bis Mitte des 5. Jahrhunderts regiert hatte). Dass Anastasios so lange an der Macht blieb, viel länger, als irgendjemand hätte erwarten können, brachte es mit sich, dass er die Zügel der Macht im Laufe der vielen Jahre immer fester in Händen hielt. Doch es waren unruhige Zeiten – auch nach der Niederschlagung des Isaureraufstands kämpfte Anastasios den größten Teil seiner Herrschaft buchstäblich ums Überleben. Das Reich stand unter Druck, und zwar gleich aus zwei verschiedenen Richtungen.
Sein erstes Problem nach einer kurzen Ruhepause nach dem Aufstand in Isaurien war der erneute Krieg mit Persien im zweiten Jahrzehnt seiner Regierung. Der Aufstieg Persiens zur Supermacht Mitte des 3. Jahrhunderts hatte den Kontext, in dem das Römische Reich strategisch operierte, grundlegend verändert und dafür gesorgt, dass sich die politisch-administrativen Strukturen des Imperiums grundlegend veränderten (siehe Kapitel 2). Dank des Truppenausbaus (und der dazu nötigen Steuerreform) hatten sich die Katastrophen des 3. Jahrhunderts ab den 290er-Jahren nicht mehr in nennenswerter Weise wiederholt, obwohl es bis in die 370er-Jahre hinein immer wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Imperien kam. An diesem Punkt allerdings änderte sich das Muster: Hatten die zwei Großmächte bislang keine Gelegenheit ausgelassen, ihrem Erzrivalen Ärger zu bereiten, versuchten nun beide, die Auswirkungen ihrer Konflikte möglichst gering zu halten, auch wenn es solche Konflikte natürlich immer noch gab. Zum Beispiel im Jahr 456, als sich der römische Klientelkönig von Lasika am östlichen Ende des Schwarzen Meers immer mehr von Konstantinopel bevormundet fühlte und die Perser um Hilfe bat, um sich größere Unabhängigkeit zu verschaffen. Doch die Perser nutzten diese Chance, den Römern zu schaden, nicht, und so musste der König von Lasika seine Krone an seinen Sohn übergeben und selbst nach Konstantinopel gehen, um sich zu erklären. Ein so kooperatives Agieren zwischen den beiden Imperien bei einer möglichen Streitfrage war im 5. Jahrhundert absolut die Regel.9
Man sollte an dieser Stelle allerdings darauf hinweisen, dass diese lange kooperative Phase mitnichten ganz freiwilliger Natur war, sondern den notorisch verfeindeten Großmächten durch äußere Umstände aufgezwungen wurde. Aus römischer Sicht waren zwei bedeutende strategische Rückschläge in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts für diesen augenscheinlichen Frieden ursächlich. Der erste war Julians fehlgeschlagener Persienfeldzug im Jahr 363, der dazu führte, dass Rom den Persern Nisibis und eine Reihe römischer Territorien jenseits des Tigris überlassen musste. Der zweite Rückschlag war die Teilung Armeniens unter Kaiser Theodosius I. in den 380er-Jahren, bei der etwa drei Viertel des Staates in ein persisches Protektorat (Persarmenien) umgewandelt und damit der römischen Einflusssphäre entzogen wurden (siehe Karte 1).10
Dass diverse römische Regime des 5. Jahrhunderts diese beiden Rückschläge hinnahmen, ohne zu Vergeltungsmaßnahmen auszuholen, lag allerdings nicht etwa daran, dass unter den Kaisern plötzlich die Großzügigkeit ausgebrochen wäre. Vielmehr stellte der steile Aufstieg der Hunnen in Mittel- und Osteuropa eine völlig neue Gefahr für die Grenzen Ostroms dar, und folglich waren für irgendwelche »unnötigen« Streitigkeiten mit Persien einfach keine militärischen Kapazitäten mehr übrig.
Die Perser wiederum hatten im Grunde alles erreicht, was sie sich vernünftigerweise hatten erhoffen können, und auch sie sahen sich einer neuen Bedrohung ausgesetzt, in Form der Steppenvölker im Norden und Osten. Vor allem die sogenannten Hephthaliten oder »weißen Hunnen«, die zu Beginn des 5. Jahrhunderts von ihrer ursprünglichen Machtbasis (wahrscheinlich) im Nordwesten Afghanistans aus Sogdien und Chorasan eroberten, entwickelten sich zu einem äußerst aggressiven Nachbarn. Ob und auf welche Weise sie tatsächlich mit den Hunnen verwandt waren, die in beiden Teilen der römischen Welt für so viel Unruhe sorgten, wird nach wie vor kontrovers diskutiert.
Der entscheidende Punkt ist, dass die Hephthaliten, als sie Ende des 5. Jahrhunderts ihre Machtbasis erweiterten, die Perser mehrfach besiegten. Die schlimmste Niederlage erlitten die Perser bei der Schlacht von Herat im Jahr 484, die für sie ähnlich katastrophal verlief wie für die Römer damals die Schlacht von Adrianopel; der persische Großkönig Peroz (459–484) fand bei Herat den Tod.11
Beide Reiche hatten mithin gute Gründe, im 5. Jahrhundert keinen neuen Krieg miteinander vom Zaun zu brechen, und das änderte sich auch nicht über Nacht. Zur Zeit Zenons baten die Perser Konstantinopel sogar um Unterstützung gegen die Hephthaliten, und er scheint ihnen tatsächlich bisweilen unter die Arme gegriffen zu haben. In den 490er-Jahren forderten die Perser aber immer mehr. Doch selbst als der neue persische Herrscher Kavadh die Hephthaliten dafür bezahlte, ihm zurück auf den Thron zu verhelfen – eine unerhörte Provokation –, blieb Anastasios’ Regime dem Geist der friedlichen Zusammenarbeit treu, die das Nebeneinander der Großmächte im 5. Jahrhundert geprägt hatte. Er weigerte sich sogar, eine Revolte der christlichen Persarmenier in den 490er-Jahren zum Anlass zu nehmen, die nun immer dreisteren Nachbarn zur Rechenschaft zu ziehen. Doch zu Beginn des 6. Jahrhunderts war Kavadh schließlich so weit, dass er Rom nicht mehr nur drohte, sondern tatsächlich den Krieg erklärte.12
Dass dieser Krieg ausbrach, konnte man Anastasios’ Regime zwar nicht ankreiden, wohl aber, dass es sich nicht gut genug auf einen möglichen Krieg an der persischen Front vorbereitet hatte. Als Kavadh im Jahr 502 in den römischen Osten einmarschierte, traf seine Armee auf so gut wie keine Gegenwehr. Als Erstes fiel er in Armenien ein und ließ seine Truppen im Handumdrehen Theodosiopolis, die Hauptbasis der Römer, zerstören. Anschließend wandte er sich nach Süden und kam nach Martyropolis, das er verschonte, als der dortige Statthalter den Eindringlingen das Doppelte seiner jährlichen Steuereinnahmen aushändigte. Als Nächstes überfiel das Perserheer Amida. Es gab zwar keine römischen limitanei in der Stadt, aber die Einwohner verteidigten ihre Häuser bis aufs Blut – erst nach drei Monaten gelang es den Persern, die Stadt zu stürmen. Jeder zehnte der überlebenden männlichen Einwohner von Amida wurde hingerichtet, die übrigen wurden als Sklaven verkauft; sämtliche Reichtümer der Stadt wurden nach Persien gebracht. Zur gleichen Zeit plünderten Kavadhs arabische Verbündete den römischen Osten, von Edessa bis Constantia.
Anastasios war so aufgebracht, dass er zur Feldzugsaison 503 eine gewaltige Armee nach Mesopotamien schickte. Mit 40 000 Mann war sie weitaus größer als irgendein Truppenverband, der jemals unter Justinian ins Feld geführt werden sollte, und sie operierte in drei Divisionen, von denen eine von Hypatius, einem Neffen des Kaisers, befehligt wurde. Zwei begaben sich nach Amida, das inzwischen von einer 3000 Soldaten starken persischen Garnison besetzt war, die dritte zur persischen Regionalhauptstadt Nisibis. Alle drei Divisionen erlitten im Laufe des Jahres entscheidende Niederlagen. Bei diesem persischen Gegenschlag gelang es Kavadh aber nicht, weitere römische Gebiete zu erobern – Constantia und Edessa waren zu gut befestigt. Der Krieg in Mesopotamien steuerte schnell auf eine Pattsituation zu. Für die dramatischste Aktion des Jahres sorgten die Lachmiden, Persiens arabische Verbündete unter Al-Mundhir, als sie in die römischen Provinzen Arabien und Palästina einfielen. Laut Kyrillos von Skythopolis legten sie »alles in Schutt und Asche, versklavten Tausende Römer und begingen viele gesetzlose Taten«.
Das war alles, im Großen und Ganzen. Nach diesen leichten Gewinnen hatte Kavadh kein Interesse mehr daran, den Krieg fortzusetzen. Die Römer versuchten noch einmal, Amida zurückzuerobern, aber es gelang ihnen nicht. 504 wurde ein Waffenstillstand vereinbart, und man verhandelte über einen dauerhaften Frieden; nennenswerte Kampfhandlungen gab es keine mehr. Das Friedensabkommen war für Anastasios keine allzu große Demütigung, denn jährliche Zahlungen, wie sie die Perser vor dem Krieg gefordert hatten, wurden nicht vereinbart, und die Römer erhielten die Kontrolle über Amida zurück.
Der Kaiser ließ nun die römischen Verteidigungsanlagen in Mesopotamien ausbauen, nicht nur in Amida, sondern auch in Edessa und Batnae, und richtete an der Grenze bei Dara einen ganz neuen römischen Stützpunkt für die Region ein. Im Gegenzug verzichtete man auf Vergeltungsmaßnahmen für die militärischen Niederlagen von 502/503. Es war Anastasios gelungen, Amida allein durch Verhandlungen zurückzugewinnen – und indem er seinem persischen Rivalen einen bestimmten Festbetrag zahlte. Nichts von alldem war besonders verhängnisvoll, doch weder der Kaiser noch sein Lieblingsneffe (dessen Feldzug zur Rückeroberung Amidas ein Fehlschlag gewesen war) konnten aus den Vorgängen ein derartiges politisches Kapital schlagen, dass es ihnen ermöglicht hätte, die Balance zwischen den verschiedenen Fraktionen bei Hofe in Konstantinopel entscheidend zu ihren Gunsten zu beeinflussen.13
Das Gleiche gilt für das zweite große Thema von Anastasios’ Herrschaft: die Spaltung innerhalb der oströmischen Kirche. Wie wichtig dieser Komplex war, klang bereits zu Beginn, bei der Szene im Hippodrom, kurz an, als die Menge – wahrscheinlich nach vorheriger Absprache – verlangte, der neue Kaiser müsse »orthodox« sein. Die gegenwärtige Spaltung war eine Reaktion auf die Definition des christlichen Glaubens beim Konzil von Chalkedon im Jahr 451, dem vierten großen ökumenischen Konzil der römischen Spätantike. Das grundlegende Thema war die anhaltende Debatte darüber, in welcher Form das göttliche und das menschliche Element in der Person Christi vereint seien – was wiederum erhebliche Auswirkungen auf die Frage hatte, auf welche Weise Christus die Menschheit gerettet hat. War Christus als Gott am Kreuz gestorben? War dies das Wunder, mit dem er den Tod besiegt hatte? Aber konnte ein unsterblicher Gott überhaupt sterben?
In der Generation vor Chalkedon war Nestorius, der Patriarch von Konstantinopel (428–431), von Leuten abgesetzt worden, die anderer Meinung gewesen waren als er und die von seinem Erzfeind Kyrillos, dem Patriarchen von Alexandria, aufgestachelt worden waren: Nestorius hatte den Standpunkt vertreten, der unsterbliche Gott habe nicht leiden können – und daher sei lediglich der menschliche Teil Christi am Kreuz gestorben. Als Reaktion darauf hatte Kyrillos behauptet, das sei Unfug und es könne nur ein unteilbares »fleischgewordenes Wesen von Gott dem Wort« geben; das göttliche und das menschliche Wesen Christi seien nicht voneinander zu trennen. Die meisten Christen waren der Ansicht, dass Nestorius nicht recht haben konnte, aber für manche ließ Kyrillos’ Gerede von dem einen Wesen Christi, insbesondere die Art und Weise, wie es von einigen seiner radikaleren Anhänger interpretiert wurde, zu wenig Platz für die Menschlichkeit Christi.
In Chalkedon sollte dieser Streit beigelegt werden. Auf dem Konzil wurde zum einen bekräftigt, dass Christus nach seiner Menschwerdung mit »zwei Wesen« fortbestand, zum anderen wurde Nestorius’ Lehrmeinung noch einmal offiziell verdammt. Die gewählte Formulierung ließ sich mit den Ansichten des Kyrillos in Einklang bringen, denn in einem Dokument, einer sogenannten Kompromissformel (433), hatte der Patriarch auf Druck seitens des Kaisers gegenüber Johannes, dem Patriarchen von Antiochia, erklärt, es sei nicht unbedingt illegitim, von den »zwei Wesen Christi« zu sprechen, man dürfe nur nicht behaupten, sein menschliches Element habe am Kreuz gelitten und sei dort gestorben. Der aktuelle Papst steuerte ebenfalls eine Abhandlung zur Diskussion in Chalkedon bei, den Tomus ad Flavianum; er hielt darin fest, wie die westliche Kirche die Angelegenheit sah: Bei Christus bestehe eine »Einheit der Person in jedem der beiden Wesen«.14
Wie zu erwarten, stimmten alle versammelten Bischöfe am Bosporus unter den wachsamen Augen von Kaiser Markian, der das Konzil einberufen hatte, und seinen Beamten, die es leiteten, den Beschlüssen von Chalkedon zu. Doch kaum hatten sie dem Kaiser den Rücken zugewandt, ging der Streit von Neuem los. Für viele östliche Bischöfe klangen die »zwei Wesen« einfach zu sehr nach Nestorius, und sie widersetzten sich dem, was sie als Prüfstein der kyrillischen Orthodoxie verstanden – Kompromissformel hin oder her.
Während die Debatte auch in der folgenden Generation weiterging, bestand die offizielle Strategie der römischen Kaiser einfach nur darin, das in Chalkedon Beschlossene durchzusetzen. Doch hinter den Kulissen wurde die Tragfähigkeit des Dogmas infrage gestellt, angesichts der innerkirchlichen Spaltung, die es provoziert hatte und auf die der Usurpator Basiliskos (474–476) wiederum reagierte, indem er die Beschlüsse des Konzils komplett ablehnte.
Der Graben, der durch die oströmische Kirche ging, wurde so tief, dass Zenon schließlich nicht mehr tatenlos zusehen konnte. 482 erließ der Kaiser, möglicherweise im Anschluss an eine in Palästina erprobte Friedensinitiative, ein Edikt mit dem Titel Henotikon (»Einigung«), das besagte, der christliche Glaube sei bereits im 4. Jahrhundert auf den ökumenischen Konzilen von Nicäa (325) und Konstantinopel (381) befriedigend definiert worden, und zwar ein für alle Mal. Das Dogma von Chalkedon wurde in dem Edikt nicht direkt verurteilt, sondern einfach ignoriert.
Zenon gelang es, die Ostkirche offiziell zu befrieden, denn alle vier östlichen Patriarchen (in Alexandria, Antiochia, Konstantinopel und Jerusalem) segneten das Henotikon inhaltlich ab. Doch seine Strategie hatte zwei wesentliche Nachteile. Erstens hatte das Weströmische Reich 482 aufgehört zu existieren, und Italien wurde von Odoaker kontrolliert, der mit Zenon tief verfeindet war, sodass der Kaiser auf den fünften Patriarchen der Kirche, den Bischof von Rom, keinerlei Einfluss hatte; und weil Papst Leos Tomus ad Flavianum formell in das Prozedere von Chalkedon einbezogen worden war, hatte Rom ein starkes Interesse daran, Chalkedons Legitimität als ökumenisches Konzil aufrechtzuerhalten. Alle Verhandlungen führten zu nichts, und zwei Jahre später hielt Papst Felix III. eine Synode ab, auf der das Henotikon verurteilt und Akakios, der derzeitige Patriarch von Konstantinopel, formell abgesetzt und exkommuniziert wurde. Damit befanden sich Rom und Konstantinopel offiziell im Schisma. Und zweitens bedeutete die Tatsache, dass die Kirchenobersten im Osten einander nicht mehr bekriegten, nicht etwa, dass der Streit innerhalb der Ostkirche beigelegt gewesen wäre. Die kaiserliche Hauptstadt beheimatete verschiedene Klöster, die die Beschlüsse von Chalkedon unterstützten, allen voran das Kloster der Akoimetoi (der »schlaflosen« Mönche). In Syrien und Palästina waren demgegenüber viele gegen Chalkedon.15
Insofern ist es schwer zu beurteilen, was genau die Menge im Hippodrom meinte, als sie Ariadne zurief, der neue Kaiser solle »orthodox« sein. Falls es sich um eine orchestrierte Veranstaltung handelte, war vermutlich gemeint, dass das neue Regime den Status quo aufrechterhalten sollte, wie er im Henotikon verankert war. Falls nicht, dann verlangte die Bevölkerung der Hauptstadt, die zum großen Teil in Richtung einer Chalkedon wohlgesinnten Einstellung tendierte, die Aufhebung des Henotikon. Wie dem auch sei: Das neue Regime hatte ein kaum lösbares Problem geerbt, für dessen Existenz es nichts konnte.
Es gibt durchaus Grund zu der Annahme, dass Anastasios mit den Antichalkedoniern sympathisierte. Vielleicht gelangten er und seine Berater in der zweiten Hälfte seiner Regierungszeit aber auch einfach zu der Überzeugung, dass sich der allgemeine Frieden in der Ostkirche am besten wiederherstellen ließ, indem man die Chalkedon-Sympathisierenden, die in der kaiserlichen Hauptstadt immer noch in der Überzahl waren, mit einer antichalkedonischen Position untergrub.
Im Jahr 508 durfte der Vordenker der Antichalkedonier, Severus, mit 200 auf seine Linie eingeschworenen Mönchen aus Palästina nach Konstantinopel, kommen, und später wurde er sogar von einem Neffen des Anastasios, Probus, der anscheinend Teil von Severus’ Netzwerk war, dem Kaiser vorgestellt. Dies bereitete den Boden für explizitere Aktionen. Am 20. Juli 511 musste die Gemeinde in der großen Kirche Hagia Sophia feststellen, dass in eines der Standardgebete der Liturgie, das Trisagion, mit einem Mal ein antichalkedonischer Teil eingefügt worden war. Dieses Gebet wurde stets vor dem täglichen Psalm gesungen und lautete ursprünglich: »Heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger Unsterblicher, erbarme dich unser.« Der neue Zusatz – »der für uns gekreuzigt wurde« – war in einigen Gemeinden im Rahmen der Reaktion gegen die Beschlüsse von Chalkedon bereits Ende der 460er-Jahre in das Gebet eingefügt worden. Kein Chalkedon-Sympathisant konnte sich dem anschließen.
Das Henotikon war im Jahr 511 offiziell immer noch in Kraft, aber die Politik des Regimes hatte eine klar antichalkedonische Richtung eingeschlagen, wie die Aussagen der Patriarchen von Konstantinopel und Antiochia, Makedonios und Florian, in jenem Sommer deutlich machten. Beide hatten sich dem Henotikon angeschlossen, hatten aber so viele Sympathien für die Chalkedon-Beschlüsse, dass sie radikalere Schritte zur formellen Verurteilung des Konzils ablehnten. Dass dies tatsächlich die Richtung war, in die sich das Regime bewegte, wurde spätestens dann klar, als Florian abgesetzt und durch Severus ersetzt wurde. Somit stand nun einem Bischofssitz, dessen intellektuelle Traditionen beim Konzil von Chalkedon besonders stark vertreten gewesen waren, ein offen antichalkedonischer Patriarch vor.16
So weit, so gut. Anastasios’ Regime hatte sich für eine Lösung entschieden und versuchte, sie durchzusetzen. Doch schon bald zeigte sich, wie schwach das Regime im Grunde genommen war. Nachdem es zunächst darauf gesetzt hatte, die religiöse Spaltung auf seine Weise zu beseitigen, ruderte es auf Druck der Bevölkerung wieder zurück. Im Jahr 512 erlebte das Hippodrom der kaiserlichen Hauptstadt heftige Ausschreitungen seitens der Chalkedon-Befürworter, die den Kaiser fast den Thron kosteten. Anastasios sah sich gezwungen, ohne sein kaiserliches Diadem persönlich im Hippodrom zu erscheinen und die Menge für seine unüberlegten religionspolitischen Entscheidungen um Vergebung zu bitten.17 Die Akoimetoi spielten bei der Orchestrierung der gewaltsamen Aktionen eine führende Rolle, aber höchstwahrscheinlich waren auch einflussreiche Personen bei Hofe daran beteiligt, denen die betont antichalkedonischen Politik des Regimes ein Dorn im Auge war – oder die einfach nur verhindern wollten, dass Anastasios seine Macht weiter ausbaute.
Schon bald entstanden dem Kaiser neue Probleme: Ein Großteil des Militärs auf dem Balkan unter der Führung von Vitalian probte den Aufstand. Vitalians offizieller Posten war damals wahrscheinlich Befehlshaber der zahlreichen foederati, die in den verschiedenen Teilen des Balkans Land besaßen. Die foederati hatten einen bedeutenden Anteil am Ausbruch der Revolte, die wie so viele Militärrevolten als Streit um ausbleibenden Sold und eine schlechte Versorgungslage begann. Sie erfasste rasch viele der limitanei- und Feldarmee-Einheiten der Region, deren Offiziere Vitalian entweder für seine Pläne gewann oder aber ermorden ließ. Anfang 513 drang er mit einer Streitmacht von rund 50 000 Mann bis nach Hebdomon vor, sieben Meilen vor Konstantinopel, wo oft die Inthronisierung neuer Kaiser stattfand. In Gesprächen mit Vertretern des Regimes unterbreitete Vitalian seine Forderungen: Er verlangte, dass seine Truppen endlich ihren Sold erhielten und dass die chalkedonische Orthodoxie wiederhergestellt wurde und der alte Patriarch Makedonios seinen Posten zurückbekam. Dass er selbst Kaiser werden wollte, behielt Vitalian noch für sich.
Anastasios ließ seine Vertreter verkünden, er lenke in allen Punkten ein, doch er hielt sich nicht an seine Versprechen; also rückte Vitalian 514 ein zweites Mal auf Konstantinopel vor. Mit 5000 Pfund Gold im Gepäck zog er wieder ab, nachdem Anastasios ihm konkret zugesichert hatte, er werde die beiden entlassenen Patriarchen (Makedonios und Florian) wieder einsetzen und im Jahr 515 ein Konzil einberufen, um die religiöse Einheit mit Rom wiederherzustellen. Der Tod von Papst Symmachus im Juli 514 schien neue Chancen zu eröffnen, denn wie immer, wenn ein Papst starb, bestand die Hoffnung, dass sein Nachfolger umgänglicher war als der Vorgänger, und so schrieb Anastasios in der zweiten Jahreshälfte dem neuen Papst Hormisdas einen Brief, in dem es um eine mögliche Aussöhnung der beiden Kirchen ging. Doch der Kaiser war nach wie vor ein Anhänger des Henotikon, und Hormisdas wollte keine Kompromisse eingehen. Das Akakianische Schisma, wie man die Situation im Westen nannte (nach dem von Papst Felix exkommunizierten Patriarchen Akakios), ließ sich also nicht beilegen, und 515 rückte Vitalian ein drittes Mal auf die Hauptstadt vor. Nur brachte er diesmal eine Flotte mit, die es ihm endlich ermöglichen sollte, die Stadt einzunehmen. Zur Landseite hin war Konstantinopel durch die dreifachen Theodosianischen Befestigungsanlagen geschützt, die kein Feind jemals überwinden konnte (bis die Kanone erfunden wurde).18
Es war ein wenig wie beim Perserkrieg: Das Endergebnis war nicht so katastrophal wie zunächst befürchtet. Unter der Führung eines der vertrauenswürdigsten Beamten von Anastasios, des Prätorianerpräfekten Marinus, nutzten die Streitkräfte des Regimes das berühmte Griechische Feuer – eine Waffe, die brennenden Schwefel verschoss, der auch auf Wasser weiterbrannte –, um Vitalians Flotte auf dem Bosporus in Brand zu stecken. Da dessen Armee auf anderem Wege nicht in die Stadt gelangen konnte, kam es zu neuen Verhandlungen, und am Ende erklärte Vitalian sich bereit, ins Exil zu gehen, wenn seine Soldaten ausbezahlt würden.
Dennoch hatte sich Anastasios nur ganz knapp die Macht sichern können, und im Folgenden wagte er keine weiteren Schritte mehr in Richtung Chalkedon. Zusammenfassend können wir festhalten: In religiösen Angelegenheiten zeichnete sich Anastasios’ Regime durch Wankelmütigkeit und ein völliges Fehlen konkreter Erfolge aus, seine Regierungszeit durch zunehmende Konflikte. Der Kaiser selbst war nun bereits Mitte achtzig, sein Regime war in politischer Hinsicht zum Stillstand gekommen, und bis ein neues Regime an die Macht kam, würde nichts Wesentliches mehr passieren. In diesem Zusammenhang leuchtet es durchaus ein, dass Anastasios keinen entscheidenden Einfluss auf die Thronfolge ausüben konnte. Bezeichnenderweise hielt man in den letzten Jahren des Kaisers, als man jeden Augenblick mit seinem Ableben rechnete, seine beiden prominentesten Neffen aktiv von der Hauptstadt fern. Pompeius saß als Kommandant in Thrakien, wo er ein Auge auf den exilierten Vitalian haben sollte, und Hypatius war als Oberbefehlshaber der östlichen Feldarmeen in Antiochia stationiert. Keiner von beiden hatte genug Anteil am Geschehen im Palast, um bei dem politischen Pferdehandel eine Rolle zu spielen, der dem Tod eines Kaisers, der keine direkten Erben hatte, zwangsläufig folgte.