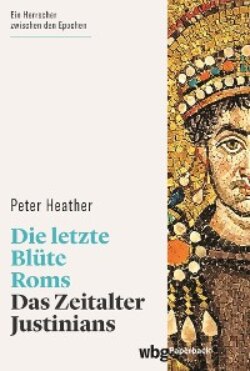Читать книгу Die letzte Blüte Roms - Peter Heather - Страница 17
»Der purpurne Tod«
ОглавлениеIn der Nacht vom 8. auf den 9. Juli 518 entschlief der 87-jährige Anastasios. In den Jahren zuvor wird man beim Heer, bei Hofe und im Senat über eine schier endlose Zahl verschiedener Thronfolger diskutiert haben, gerade weil Anastasios vor seinem Tod die nötige Autorität fehlte, um seine Nachfolge selbst zu regeln. Eine Maxime des Altertums, die später vom Papsttum aufgegriffen wurde, besagte, dass nur jemand des höchsten Amtes würdig war, der dieses Amt gar nicht anstrebte. Da der Kaiser von Gott auserwählt wurde, hatte menschlicher Ehrgeiz in dieser Gleichung keinen Platz. Zudem stellte die enorme Verantwortung, die das Amt mit sich brachte, zumindest theoretisch eine solche Last dar, dass es gar nicht als sonderlich erstrebenswert galt – in diesem Sinne soll Kaiser Julian, als er bei seiner Ernennung zum Caesar neben seinem Cousin, dem Augustus Constantius II., auf dem kaiserlichen Wagen fuhr, den (leicht abgewandelten) homerischen Vers gemurmelt haben: »Der purpurne Tod und das übermächtige Schicksal haben Besitz von mir ergriffen.«19 Insofern legte Justinians Onkel am Morgen des 9. Juli, wie man sich erzählte, eine geradezu absurde Haltung an den Tag. Der Chef der Palasteunuchen, der praepositus sacri cubiculi Amantius, übergab ihm eine große Summe Bargeld, um die Palastwachen zu bestechen, damit sie Amantius’ Kandidaten unterstützten, doch stattdessen verwendete Justin das Geld für seine eigene Kandidatur. Wahrscheinlich ist diese Anekdote nicht mehr als skurriler Klatsch,20 aber auch die höher zu bewertenden Quellen lassen Justin kaum in einem besseren Licht dastehen: 518 war er komplett auf den Thron fixiert.
Als bekannt wurde, dass Anastasios gestorben war, versammelte sich das Volk wieder im Hippodrom, und diesmal rief es, dass es einen Feldherrn als Kaiser wollte. Und rein zufällig war Justin Feldherr. Er stammte vom nördlichen Balkan, aus Bederiana in der Nähe von Naissus (dem heutigen Niš), und hatte sich beim Heer verpflichtet, um der Armut zu entfliehen. Justin ging zu den excubitores, einer der beiden Einheiten der Palastwächter (die andere waren die scholarii). Über seine spätere Karriere ist wenig bekannt, da unsere Quellen durchweg auf seinen weitaus bekannteren Neffen fixiert sind. Dennoch: Justin nahm während der Regierungszeit des Anastasios an allen wichtigen Feldzügen teil. Zur Zeit des Isaureraufstands in den 490er-Jahren war er ein ranghoher Feldarmeeoffizier (comes rei militaris, ein Rang unterhalb des magister militum). Er kämpfte im Perserkrieg von 503/504 mit und befand sich auf einem Schiff im Bosporus, als Vitalians Flotte ihre entscheidende Niederlage erlitt. Direkt danach wurde er zum comes excubitorum ernannt, zum Kommandanten der Palastwache, der er schon so lange angehörte. Im Rang war dieser Posten nicht so hoch angesiedelt wie Oberbefehlshaber einer Feldarmee, aber dennoch relativ weit oben und mit dem entscheidenden Vorteil, dass der comes excubitorum im Palast stationiert war – ganz nahe am Zentrum der Macht.21
Somit war Justin während Anastasios’ letzter Lebensjahre genau am richtigen Ort, um bei den einflussreichsten Personen bei Hofe seine Machtansprüche anzumelden. Aber genau dieser Umstand lässt einen nun die Rufe der Menschenmenge im Hippodrom hinterfragen. Nachprüfen lässt sich das heute nicht mehr, aber wahrscheinlich wussten Justins Hintermänner ganz genau, wem sie etwas Bargeld in die Hand drücken mussten, damit die Menge diese doch erstaunlich passende Forderung skandierte. Und Justin war es auch, der den in den Palast gerufenen Senatoren und Würdenträgern offiziell verkündete, dass Anastasios verstorben war. Auch die Tatsache, dass diese herausragende Aufgabe ausgerechnet ihm zufiel, deutet darauf hin, dass er bei Hofe in allerhöchstem Ansehen stand. Doch selbst bis ins Detail ausgetüftelte Nachfolgepläne konnten immer noch eine überraschende Wendung nehmen.22
Justin hatte beileibe nicht nur Freunde. Die andere Palastwächterabteilung, die scholarii, hätte viel lieber den einzigen anderen Feldherrn im direkten Umfeld des Palasts auf dem Thorn gesehen: Patricius, den Oberbefehlshaber der Praesentalis-Armee. An diesem Punkt hätte das Ganze leicht schiefgehen können, auch wenn der »loyale, aber geistig nicht allzu rege« Patricius den Job im Grunde gar nicht wollte, vor allem als die excubitores ihm mit dem Tod drohten, vermutlich weil sie ihren eigenen Kommandanten als Kaiser sehen wollten. Da schaltete sich Justinian ein und rettete Patricius das Leben, indem er ihn überredete, aus dem Wettlauf um den Thron auszusteigen; dieser Vorgang scheint den künftigen Kaiser allerdings düpiert zu haben. Inzwischen zog sich die ganze Angelegenheit bereits so lange hin, dass die Menschen unruhig wurden. In Sorge, dass das Volk am Ende noch einen eigenen Kandidaten ins Spiel brachte, stellten sich die Senatoren und Würdenträger schließlich einmütig hinter Justin, und nachdem die Palasteunuchen die kaiserlichen Insignien freigegeben hatten, betrat der Kaiser binnen weniger Minuten ordnungsgemäß gekleidet seine Loge und präsentierte sich seinem Volk. Es begrüßte ihn stürmisch. Allen Palastwächtern versprach er eine erhebliche Gehaltserhöhung.23
Insgesamt gab es so viele bezeichnende Zufälle, dass Justins Inthronisierung nichts anderes als das Ergebnis sorgfältiger Planung gewesen sein kann. Zweifellos hatten andere Leute alternative Pläne (einige Hinweise zu Details traten nach seiner Wahl zutage), aber Justin hatte seine Position als Palastwächter eben von vornherein dazu benutzt, sich für den Thron in Stellung zu bringen, und in ausreichender Zahl Unterstützer hinter sich geschart, um an diesem entscheidenden Morgen im Palast alle anderen potenziellen Herausforderer ausstechen zu können – vielleicht hat er zusätzlich auch einen großen Teil der Menge bestochen, um sicherzustellen, dass auch tatsächlich genügend Leute nach einem Feldherrn schrien. Viele seiner Unterstützer werden in ihm, wie vor ihm in Anastasios, einen guten Kompromisskandidaten gesehen haben, der die Zügel der Macht nicht allzu fest in Händen halten würde. Er war keiner der Neffen von Anastasios, er hatte zuvor kein hohes Amt in der Verwaltung innegehabt, und auch er war über sechzig und kinderlos (allerdings hatte er zu diesem Zeitpunkt seinen Lieblingsneffen Justinian wohl bereits adoptiert). Doch wer in ihm lediglich einen harmlosen alten Mann sah, der sollte schon bald merken, dass er sich getäuscht hatte. Das neue Regime wusste Anastasios’ politische Fehlgriffe zu nutzen, um nach der Macht zu greifen – ohne Rücksicht auf Verluste.
Oberste Priorität hatte zunächst einmal die Beseitigung jedes potenziellen Widerstands innerhalb des Palastes. Noch in derselben Woche verglichen wütende Kirchgänger in der Hagia Sophia den damaligen Chefeunuchen Amantius lautstark mit Chrysaphios, dem berüchtigten Chefeunuchen von Theodosius II., der im Vorfeld des Konzils von Chalkedon die religiöse Opposition unterstützt hatte. Diese Zwischenrufer waren wahrscheinlich vom neuen Kaiser beauftragt, von dessen Feindschaft mit Amantius auch die Tatsache zeugt, dass jener angeblich Geld aufwandte, um einen anderen Thronanwärter zu unterstützen. Palasteunuchen konnten extremen Einfluss ausüben, allerdings oft nur bis zum nächsten Regimewechsel. Weil sie kein breiter aufgestelltes Netzwerk an politischen Unterstützern besaßen, konnten sie im Grunde jederzeit hingerichtet werden, ohne dass dies irgendjemanden, der von Bedeutung war, gestört hätte. Amantius wurde binnen zehn Tagen nach Justins Thronbesteigung zusammen mit einem weiteren Eunuchen namens Andreas hingerichtet – ein ziemlich sicheres Zeichen dafür, dass er einen alternativen Kandidaten unterstützt hatte.
Einige von Anastasios’ bedeutenderen Unterstützern mussten den Palast ebenfalls verlassen, doch sie waren so gut vernetzt, dass sie immerhin mit dem Leben davonkamen. Anastasios’ Verwaltungschef, der seit 503 im Amt befindliche magister officiorum Celer, wurde praktisch sofort gefeuert, andere folgten ihm wenig später. Hypatius war 519 als Oberbefehlshaber an der Ostfront entlassen worden, genau wie Marinus, Anastasios’ Prätorianerpräfekt für die östlichen Provinzen. Die Quellen berichten, dass Marinus in Konstantinopel ein öffentliches Bad mit einer Darstellung von der Ankunft des verarmten Justin in der Hauptstadt dekorieren ließ. Mag sein, dass er sich damit für seine Entlassung rächen wollte. Nur: zu welchem Zeitpunkt? Wenn Justin zu diesem Zeitpunkt bereits Kaiser gewesen wäre, so wäre es wahrscheinlich kein allzu cleverer Schachzug gewesen. Ich vermute daher eher, dass die Maßnahme noch in die letzten Jahre unter Anastasios zu datieren ist, und vielleicht hatte Marinus zum Ziel, Justin als potenziellen Kandidaten für die Kaiserwürde zu diskreditieren.24
Diese Entlassungen weisen jedoch noch ein weiteres Muster auf, das zeigt, dass das neue kaiserliche Regime viel mehr im Sinn hatte, als sich lediglich die Kontrolle über den Palast zu sichern. Wenn jemand entlassen wird, wird ja auch immer jemand Neues eingestellt, und eine solche Ernennung war von höchster Bedeutung: Justin rehabilitierte Vitalian, den aufrührerischen comes foederatorum aus Anastasios’ letzten Jahren, und ernannte ihn sofort zum Oberbefehlshaber einer der Praesentalis-Armeen (der andere, Patricius, behielt seinen Posten, vielleicht als Belohnung dafür, dass er sich damals im Eifer des Gefechts aus allem herausgehalten hatte). In ideologischer Hinsicht hatte Vitalian seinen Aufstand damit gerechtfertigt, dass er das Schisma mit Rom aus der Welt schaffen wollte, und viele von Justins Aktionen wiesen ebenfalls in diese Richtung. Zur Erinnerung: Der Eunuch Amantius wurde wegen seines Widerstands gegen die chalkedonische Theologie mit Chrysaphios verglichen, und sowohl er als auch sein Kollege Andreas sollten am Ende als antichalkedonische Märtyrer gefeiert werden.
Auch Celer hatte im Sommer 511 großen Anteil an der Enthebung des Makedonios, des Patriarchen von Konstantinopel, aus seinem Amt. Und wo man schon einmal dabei war, entfernte man auch gleich noch Severus aus seinem Posten als Patriarch von Antiochia. Sowohl Justin als auch seine Frau Euphemia waren ausgesprochene Unterstützer der Beschlüsse von Chalkedon, und die Weichen wurden für eine rasche Kehrtwende gestellt.
Um ihn von seiner Thronbesteigung zu informieren, schrieb der Kaiser am 1. August zum ersten Mal einen Brief an den Papst. Am 7. September machte sich ein kaiserlicher Legat mit zwei weiteren Briefen an den Papst auf den Weg. Das eine Schreiben enthielt die Bitte, Gesandte nach Konstantinopel zu schicken, um das Schisma zu beenden, und der zweite eine persönliche Einladung Justinians an den Papst, Konstantinopel zu besuchen. Die Briefe erreichten Rom am 20. Dezember, und bereits im Januar befand sich eine päpstliche Delegation auf dem Weg in den Osten. Ihre Ankunft war sorgfältig geplant: Sie würde am Montag, dem 25. März, dem Beginn der Karwoche eintreffen. Die Legaten wurden am zehnten Meilenstein vor Konstantinopel von einem hochkarätigen Empfangskomitee begrüßt, das (wie zu erwarten) aus Justinian und Vitalian sowie (erstaunlicherweise) Pompeius bestand, einem von Anastasios’ drei Neffen. Drei Tage später unterzeichnete der Patriarch Johannes von Konstantinopel die Briefe aus Rom, und Akakios’ Name wurde für immer aus den Diptychen, der offiziellen Liste der wahren Patriarchen, gelöscht. Das Schisma war vorüber.25
Justins Regime konnte auf ein paar ganz außergewöhnlich erfolgreiche Monate zurückblicken (was mehr ist, als zum Beispiel Donald Trump je von sich wird behaupten können). Nach der einigermaßen reibungslosen Thronfolge hatte es eine rücksichtslose Säuberung unter den Palastmitarbeitern und anderen einflussreichen Personen im Reich gegeben, was mit einem entscheidenden Wandel in der Religionspolitik zusammenhing. Binnen eines Jahres war dieser Vorgang abgeschlossen gewesen. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass es dem neuen Kaiser nicht ernst damit war, an den Beschlüssen von Chalkedon festzuhalten. Die Absetzung von Severus war erst der Anfang. 519 erhielt Bischof Paulus von Edessa seine Entlassungspapiere, als er sich weigerte, Chalkedon anzuerkennen. Andere folgten ihm schon bald. In den Jahren bis 527, als Justin starb, wurden rund 30 antichalkedonische Bischöfe aus ihren Städten verbannt.
Der Gegensatz zur zögerlich-schwankenden Haltung des Vorgängerregimes hätte nicht deutlicher sein können. Wenn man einen Schritt zurücktritt, um das größere Ganze zu überblicken, so sieht man ein kaiserliches Regime, für das die Einhaltung seiner Richtlinien kein Selbstzweck war, sondern ein Mechanismus, der es ihm ermöglichte, die Zügel der Macht so fest wie möglich in Händen zu halten. Seine entscheidenden Aktionen in den folgenden zwei Jahren erweiterten das Muster und machten deutlich, dass die Konsolidierung der Macht ein ganz (selbst) bewusster Vorgang war.
Eine der außergewöhnlichsten Aktionen dieser ersten Monate war die Rehabilitation von Vitalian. Der Partisan von Chalkedon hatte die kaiserliche Hauptstadt angegriffen, und wäre seine Flotte im Jahr 515 nicht in Rauch aufgegangen, hätte sie eine veritable Katastrophe angerichtet. Nun holte Justin Vitalian nicht nur aus dem Exil zurück, sondern belohnte ihn auch noch mit einem wichtigen Militärposten und gewährte ihm für das Jahr 520 sogar das Konsulat, das höchste zivile Amt der römischen Welt. Vitalian genoss zu diesem Zeitpunkt solchen Einfluss, dass er, wie einer neuen Studie zu entnehmen ist, in Briefen von Papst Hormisdas, in denen es um das Ende des Schismas geht, quasi wie ein Mitkaiser behandelt wird. Im Juni 520 wurde Vitalian aber, nachdem er ein zu Ehren seines Konsulats abgehaltenes Wagenrennen besucht hatte, im Delphax, einem der großen Höfe des Kaiserpalasts, gemeinsam mit zwei hochrangigen Assistenten ermordet. Prokop schreibt, Justinian persönlich habe ihn getötet; diese Behauptung darf man durchaus bezweifeln, doch zumindest war Justinian der größte Nutznießer von Vitalians Tod. Bislang war Justinian nämlich – trotz seiner geschickten Winkelzüge im Hintergrund in Sachen Patricius und scholarii – nach der Thronbesteigung seines Onkels keine offizielle Beförderung zuteilgeworden, auch wenn seine Rolle bei der Beendigung des Akakianischen Schismas zeigt, dass er hinter den Kulissen großen Einfluss ausübte. Unmittelbar nach Vitalians Ermordung setzte der Kaiser den inzwischen 33-jährigen Justinian nun aber als neuen magister militum praesentalis ein und präsentierte ihn als designierten Konsul für 521. Zum ersten Mal wurde Justinians öffentliches Profil dem informellen Einfluss gerecht, den er innerhalb des Regimes ganz offensichtlich längst ausübte.26
Faszinierend an diesen Vorgängen ist vor allem, dass es Justin gelang, Vitalian zu eliminieren, ohne dass dies irgendwelche offensichtlichen Konsequenzen für ihn hatte. Das Militär auf dem Balkan zeigte keinerlei Anzeichen einer Revolte, was stark darauf hindeutet, dass ganz gezielt Bargeld und Vorräte eingesetzt wurden, um die Truppen auf Linie zu bringen, und auch bei Hofe hatte man den Weg für Vitalians Nachfolger geebnet. Ein weiterer bemerkenswerter Vorgang des Sommers 520 war, dass Anastasios’ Lieblingsneffe, Hypatius, plötzlich als Oberbefehlshaber an die Ostgrenze zurückkehrte; als er am 7. August einen Brief vom Kaiser erhielt, hatte er wieder das Kommando übernommen. Diese Chronologie der Ereignisse kann kein Zufall sein.27 Justin hatte auf Kosten von Anastasios’ Neffen Karriere gemacht, aber da diese innerhalb Konstantinopels nach wie vor extrem gut vernetzt waren, war es keine schlechte Idee, sich soweit als möglich mit ihnen auszusöhnen. Pompeius hatte sich schon früh mit Justin arrangiert und hatte, wie wir gesehen haben, bei der Beendigung des Akakianischen Schismas eine bedeutende Rolle gespielt. Hypatius’ plötzliche Rehabilitation im Sommer 520, kurz nach Vitalians Ermordung, deutet darauf hin, dass Justin gegen potenziell gefährliche Zerwürfnisse bei Hofe vorsorgen wollte, indem er das Attentat nicht nur dazu nutzte, Justinians Karriere voranzubringen, sondern auch dafür, die Beziehungen zu den einflussreichen Parteien zu verbessern, die mit Hypatius verbunden waren. Infolgedessen stieß es auch niemandem sauer auf, als offiziell verkündet wurde, Vitalian habe mit seinem Tod direkt im Anschluss an die Feierlichkeiten zu Ehren seines Konsulats den Preis für seine früheren umstürzlerischen Aktivitäten gezahlt. Dass Justin Vitalian, dessen Prominenz ein potenzieller Stolperstein für die Zukunft seines Neffen gewesen war, eliminieren ließ, während er zugleich dafür sorgte, dass Justinian endlich das öffentliche Profil erhielt, das ihm gebührte, selbst wenn er sich dazu mit Hypatius & Co. arrangieren musste, lässt kaum einen anderen Schluss zu, als dass Justin Justinian bereits zu diesem Zeitpunkt als seinen unangefochtenen Nachfolger aufbauen wollte.28
Ein weiterer Hinweis darauf, dass dies der Fall war, stammt aus derselben Zeit und hat eine ganz besondere Note. Der Lieblingsneffe des Kaisers hatte eine Affäre mit einer extravaganten blonden Ex-Schauspielerin namens Theodora. Es ist geradezu erstaunlich, welche furchterregenden Details Prokop in seiner Geheimgeschichte über Theodoras Vorleben zu berichten weiß, doch auf jeden Fall war sie Schauspielerin gewesen, und das allein stellte ein Problem dar. Schließlich war es Personen mit einem dermaßen geringen gesellschaftlichen Status wie dem einer Schauspielerin seit Langem per Gesetz untersagt, mit Personen von höherem Rang (wie dem illustren Justinian) eine legitime Ehe einzugehen. 521/522 änderte Justin aus heiterem Himmel das entsprechende Gesetz. Einige Details der neuen Rechtsprechung haben im Codex Iustinianus überlebt, mitsamt – was recht ungewöhnlich ist – ihrer rhetorischen Rechtfertigung.
Natürlich diente dieses neue Gesetz in erster Linie dazu, eine ganz bestimmte Ehe zu ermöglichen. Auf eine Einleitung, in der alle moralischen Mängel des Theaterberufs aufgezählt werden, folgt die erste wichtige neue Klausel, in der es heißt, es sei trotz allem nicht richtig, all jenen Frauen, die inzwischen ihrem früheren lockeren Lebensstils entsagten, eine legitime Ehe zu verwehren; daher dürften sie den Kaiser darum bitten, ihnen denselben Status zu gewähren wie einer Frau, die noch nie gesündigt hat. Eine zweite ganz signifikante Klausel besagt, dass Kinder, die aus solchen Ehen geboren werden, vollkommen legitim sind und ihre Väter beerben können. Es folgen sechs weitere detaillierte Klauseln, aber der springende Punkt des neuen Gesetzes dürfte bereits klar geworden sein: Justinian konnte seine Schauspielerin heiraten, und ihre gemeinsamen Kinder würden seine legitimen Erben sein.29
Es lohnt sich, an dieser Stelle einen Moment innezuhalten und sich genau klarzumachen, was Justin hier gerade für seinen Neffen getan hat. Justins Gattin, Euphemia, hasste Theodora wegen deren zweifelhafter Vergangenheit und antichalkedonischer Einstellung. Das Gesetz, das solche Ehen untersagte, war seit über zweihundert Jahren in Kraft, und die Haltung, die darin zum Ausdruck kam, war noch viel älter. Die landbesitzenden Eliten des Altertums hatten extreme Vorbehalte gegenüber jeder Art von Ehe, die gegen etablierte gesellschaftliche Verhältnisse verstieß. Dass der Kaiser so weit ging, Justinian eine vollkommen legitime Ehe mit Theodora zu ermöglichen, anstatt darauf zu bestehen, dass er sie sich bloß als Geliebte hielt (was niemanden gekümmert hätte), erzeugte in der rigiden, statusbesessenen Welt des konstantinopolitanischen Hofes enormen Widerstand, und zwar nicht nur seitens Justins Ehefrau: Prokop walzt diese Geschichte so genüsslich aus, dass man einen guten Eindruck davon bekommt, welch ein Skandal dieser Vorgang gewesen sein muss. Angesichts dieses Widerstands das neue Gesetz durchzusetzen, nur damit Justinian seine Schauspielerin heiraten konnte, bedeutete für das Regime den Einsatz eines gewaltigen politischen Kapitals. Dieser Umstand wie auch die Tatsache, dass Justinian nach der Eliminierung Vitalians seine neuen Posten als Oberbefehlshaber und Konsul erhielt, sandten ein deutliches Signal aus: Selbst wenn die Thronfolge zu diesem Zeitpunkt noch keine beschlossene Sache war, so war Justinian doch eindeutig Justins designierter Erbe.
Darauf, dass das Ehethema die Geduld des Kaisers strapazierte (oder man zumindest annahm, dass sie das tat), weist eine recht seltsame Geschichte hin, die in diversen Versionen auftaucht. Im Zentrum dieser Geschichte stand ein besonders blutiger Gewaltausbruch seitens der Zirkuspartei der Blauen im Jahr 523, vor allem in Konstantinopel, aber auch in einigen anderen großen Städten des Imperiums. Laut einigen Versionen, wenn auch nicht den frühesten, gab es hinterher eine offizielle Untersuchung, die zu dem Schluss kam, dass das Ganze von Justinian orchestriert worden war. Beinahe wäre sein Name öffentlich genannt worden, doch der wütende Justin intervenierte und beendete den Vorgang. Es ist schwer zu sagen, was man von dieser Geschichte halten soll, nicht nur wegen ihrer inneren Widersprüche, sondern auch, weil aufseiten Justinians ein glaubwürdiges Motiv fehlt. Aber es gab bei Hofe durchaus Leute, die Justinian nur allzu gern in Misskredit gebracht und Justin somit gezwungen hätten, noch einmal über die Thronfolge nachzudenken, und diese Geschichte könnte genau in dieses Szenario passen.30 Falls es diese Strategie gab, so ist sie nicht aufgegangen; 523 ist nämlich auch das Jahr, in dem Justinian den Ehrentitel des Patriziers erhielt – und damit Zutritt zur exklusivsten Statusgruppe des Imperiums. Die Beziehung zwischen Onkel und Neffe war zu diesem Zeitpunkt offensichtlich wieder gekittet, und als Mitte der 520er-Jahre die Beziehungen zu Persien – das zweite große Thema der Herrschaft des Anastasios – wieder auf die kaiserliche Tagesordnung zurückkehrten, waren sich die beiden erneut einig.
Einen ersten Hinweis auf die generelle Haltung des Regimes gegenüber Persien hatte es schon etwas früher gegeben, im Zuge eines Vorfalls im Jahr 521 oder 522. König Tzath von Lasika, einem persischen Klientelkönigreich, nahm plötzlich Kontakt mit Konstantinopel auf. Um seine regionale Dominanz auszubauen, wollte der persische Großkönig Kavadh Lasika zwingen, die zoroastrische Religion anzunehmen; Tzath hingegen wollte sich taufen lassen, also Christ werden, und bat Ostrom um Unterstützung, um eine weitere Ausbreitung der persischen Hegemonie zu verhindern. Es verhielt sich also genau andersherum als noch im Jahr 456, als Lasika ein römischer Klientelstaat gewesen war. Damals hatten sich die Perser geweigert, sich bei den Römern einzumischen. Justins Regime indes ließ keine Gelegenheit aus, sein Prestige zu mehren, und so empfing der Kaiser Tzath in Konstantinopel.
Der König von Lasika wurde mit allen denkbaren Ehrenbezeugungen getauft, gekleidet in ein aufwendiges Seidengewand, das mit dem Konterfei von Kaiser Justin bestickt war. Schließlich bekam er noch eine hochwohlgeborene Römerin zur Frau und kehrte dann nach Hause zurück, begleitet von einer römischen Militäreskorte. Als der persische Botschafter sich beschwerte, wurde er mit dem Hinweis entlassen, Lasika sei schon immer römisch gewesen. Das stimmte natürlich gar nicht – Lasika hatte immer wieder seine Allianzen gewechselt, je nachdem, unter wessen Schirmherrschaft es am eigenständigsten agieren konnte. Aber da die Tendenz des 5. Jahrhunderts hin zu einer Kooperation zwischen den Supermächten zumindest teilweise immer noch aktuell war, entschied Kavadh, Rom nicht den Krieg zu erklären.31
Der eigentliche Grund dafür sickerte durch, als wahrscheinlich im Jahr 525 eine neue persische Gesandtschaft in Konstantinopel eintraf. Auch wenn es sich vielleicht nur um eine Anekdote handelte, führten beide Reiche zu Beginn des 6. Jahrhunderts die lange Phase ihrer kooperativen Beziehungen darauf zurück, dass es Anfang des 5. Jahrhunderts eine Vereinbarung zwischen Kaiser Arcadius und dem persischen Großkönig Yazdegerd gegeben hatte, laut der Letzterer den kleinen Sohn von Arcadius, Theodosius II., adoptieren würde, falls Arcadius vorzeitig ablebte. Dieser Schritt sollte Theodosius dann die Thronfolge erleichtern – und genauso kam es. Als Arcadius 408 starb, war Theodosius gerade einmal sechs Jahre alt.32 Nun bat Kavadh Justin unter Berufung auf diesen Präzedenzfall, seinen Sohn Chosrau zu adoptieren. Chosrau war der dritte Sohn des Großkönigs, doch zu seinem ältesten Sohn hatte er den Kontakt abgebrochen, und der zweite war von der Thronfolge ausgeschlossen, weil er ein Auge verloren hatte. Jetzt war Chosrau Kavadhs bevorzugte Wahl, und der König befürchtete, dass dieser es nicht allzu leicht haben würde, seinem Vater auf den Thron zu folgen, wenn er selbst erst tot war.
Will man Prokop glauben, so waren Justin und Justinian vom Vorschlag der Perser mehr als angetan und ließen sofort die entsprechenden Dokumente anfertigen. Doch dann schaltete sich der oberste Jurist des Regimes ein, der Quästor Proculus:
Diese Gesandtschaft deutete ganz unverhohlen und direkt und mit den ersten Worten an, dass dieser Chosrau, wer auch immer er sei, zum Adoptiverben des römischen Kaisers gemacht werden soll. Und ich hätte gerne, dass Ihr in dieser Sache Folgendes bedenkt: Dem Gesetz der Natur zufolge geht der Besitz der Väter auf ihre Söhne über. Und obwohl alle Völker immer wieder wegen ihrer Gesetze miteinander in Streit geraten, da sich diese Gesetze voneinander unterscheiden, sind sich in dieser Angelegenheit doch die Römer und alle Barbaren einig: nämlich dass sie die Söhne zu den Empfängern des Erbteils ihrer Väter erklären. Nehmt diese erste Resolution an, falls Ihr wollt. Doch wenn Ihr das tut, seid Euch der Konsequenzen bewusst!33
Es ist eine ganz wunderbar dramatische Geschichte, aber für bare Münze kann man sie nicht nehmen. Proculus’ Argument ist blanker Unsinn: Um Kaiser zu werden, musste ein Kandidat über ausreichende Unterstützung verfügen, musste also die wichtigsten Männer im Reich – senatorische Großgrundbesitzer, leitende Verwaltungsbeamte, Hofbedienstete und hochrangige Offiziere – hinter sich scharen. Der adoptierte Chosrau hätte bei keiner dieser Gruppen einen Stein im Brett gehabt und hätte sich insofern genauso wenig Hoffnung auf den Thron von Konstantinopel machen können, wie Theodosius II. nach der Adoption durch Yazdegerd (falls sie wirklich stattgefunden hat) einen Anspruch auf den persischen Thron gehabt hätte.
Doch auf der Grundlage dieses fadenscheinigen juristischen Vorwands bot Justin, statt dem Wunsch der Perser in vollem Umfang nachzukommen, den Persern an, Chosrau als Schwiegersohn anzunehmen – diese Praxis wurde inzwischen oft von den Herrschern der westlichen Nachfolgestaaten Roms und anderen sogenannten Barbaren angewendet. Dieses Gegenangebot wurde den Persern im Rahmen eines formellen Gipfeltreffens am Tigris direkt an der Grenze übermittelt. Anastasios’ Neffe Hypatius, damals noch magister militum für den Osten, führte die römische Delegation an, und sogar der persische Königssohn Chosrau war persönlich anwesend. Prokop beschreibt die Reaktion auf den neuen Vorschlag:
Chosrau ging und begab sich zu seinem Vater. Er hatte nichts erreicht, und was geschehen war, hatte ihn tief verletzt. Und er betete, dass er für diese Beleidigung Rache nehmen könnte.34
Meines Erachtens kann man aus dieser Episode nur eine sinnvolle Schlussfolgerung ziehen: Justins Regime wollte die Perser bewusst provozieren. Kavadhs Annäherung auf der Grundlage einer solchen juristischen Absurdität abzulehnen und dann bei einem offiziellen Gipfeltreffen, an dem der Sohn des Königs persönlich teilnahm, eine dermaßen erniedrigende Alternative zu verkünden, war ein regelrechter Affront. Die Perser reichten Rom die Hand, doch statt sie zu ergreifen, entschied sich Justin dafür, das Perserreich zu destabilisieren, indem er Chosrau seinen formellen Segen verweigerte. Damit setzte Justins Regime die neue, aggressivere Haltung gegenüber Persien fort, die es bereits im Fall von Lasika an den Tag gelegt hatte, nur eben in einem viel größeren Ausmaß.35
Dass die Ereignisse auf diesen Weise korrekt interpretiert sind, bestätigt ein dritter Vorfall. Ungefähr zur selben Zeit, als Kavadh seine Bitte um Adoption seines Sohnes übermittelte, traf eine Nachricht von Gurgenes, dem König von Iberien in Transkaukasien, in Konstantinopel ein. Während Lasika immer mal dem einen, mal dem anderen Reich die Treue schwor, gehörte Iberiens Loyalität seit dem ausgehenden 4. Jahrhundert ununterbrochen Persien. In den 520er-Jahren drängte Kavadh die christlichen Iberer jedoch, zum Zoroastrismus überzutreten. Doch seine kulturimperialistischen Bestrebungen schlugen fehl. Ermutigt durch die enthusiastische Reaktion, die der Nachbarstaat Lasika aus Konstantinopel erfahren hatte, bat Gurgenes Justin nun seinerseits um Unterstützung. In der Praxis war Iberien zu weit vom Schwarzen Meer entfernt, als dass der Kaiser dort direkten militärischen Beistand leisten konnte, doch er ermutigte die Iberer dennoch, sich gegen die Perser zu erheben, und gewährte ihnen immerhin indirekte Unterstützung, in Form einer Intervention durch Nomaden aus der Region nördlich des Kaukasus. Leider zeigte deren Angriff gegen die Perser nur wenig Wirkung, und Gurgenes wurde aus seinem Königreich vertrieben. Letztlich war Justins Weigerung, Chosrau zu adoptieren, nur eines von vielen Details, die von einer kompletten Kehrtwende in der römischen Außenpolitik zeugen. Die Maxime Konstantinopels im Umgang mit seinem mächtigen Nachbarn lautete nun nicht mehr Kooperation, sondern Konfrontation.36
Diese zweite Hundertachtziggradwende unter Justin hatte möglicherweise auch eine innenpolitische Dimension. Prokop neigt dazu, die einzelnen Themen getrennt abzuhandeln, doch eigentlich hatte das Gipfeltreffen am Tigris dazu dienen sollen, mit Persien ein umfassendes Friedensabkommen zu schließen, das den Transkaukasus – Lasika und Iberien – umfasste und eine mögliche Adoption beinhaltete. Insgesamt deuten die verfügbaren Quellen (wie Prokops Erzählung von Proculus’ dramatischer Intervention) darauf hin, dass das Kaiserhaus Kavadhs Bitte anfänglich durchaus positiv begegnete, bevor es sich für einen härtere Gangart entschied. Die Frage ist: Wann genau vollzog das Regime diese Kehrtwende?
Die Tatsache, dass Chosrau persönlich am Gipfeltreffen am Tigris teilnahm, ist ein starker Indikator dafür, dass er von einer positiven Reaktion der Römer ausging. Dies deuten auch diverse Kommentare in unseren Quellen an: Man habe Hypatius, dem ranghöchsten römischen Vertreter beim Gipfeltreffen, später vorgeworfen, sich mit Chosrau gegen Justin verschworen zu haben. Die Beweislage lässt keine absolut sichere Schlussfolgerung zu, aber es sieht ganz so aus, als habe Hypatius, Justins Oberbefehlshaber im Osten, einen umfassenden Friedensvertrag ausgehandelt, der unter anderem Chosraus Adoption beinhaltete, sei dann aber in letzter Minute von den Hardlinern in der Hauptstadt ausgebremst worden. Falls das stimmt, haben wir hier ein weiteres Beispiel dafür, wie Justins Regime politische Initiativen als Mittel zum Zweck einsetzte, um seine politischen Rivalen in Konstantinopel zu isolieren und auszutricksen.37
Zu dieser Zeit, Mitte der 520er-Jahre, erreichte Justins Dominanz in den politischen Ränkespielen bei Hofe ihren Höhepunkt. Im Jahr 525 erhob Justin, während noch darüber diskutiert wurde, wie man auf Kavadhs Adoptionsbitte reagieren sollte, Justinian formell in den Rang eines Caesars. Dies signalisierte nicht nur, dass sich der Kaiser Justinian als Thronfolger wünschte – was hinter den Kulissen, wie ich vermute, längst klar war –, sondern dass sich Justin in politischer Hinsicht sicher genug fühlte, um dieses Arrangement offiziell zu machen, allen alternativen Präferenzen der anderen Parteien zum Trotz. Wenn wir Prokop Glauben schenken wollen, so zog Justinian während Justins Regentschaft ohnehin die ganze Zeit über die Strippen, und sein Onkel war kaum mehr als ein Strohmann.38 In Justins letzten Jahren im Amt mag das durchaus der Fall gewesen sein, aber letztlich war Justinians Prominenz das Ergebnis eines langen und komplizierten politischen Prozesses, den sein Onkel ganz aktiv gestaltet hatte, um zunächst selbst an die Macht zu kommen und später dann seinem Neffen die Thronfolge zu sichern.
Es hatte unterwegs viele Stolpersteine gegeben, für Justin selbst, noch unter Anastasios, und für andere unter ihm, die nicht wollten, dass Justinian das Zepter des Kaisers in die Hände fiel. Anastasios’ Unterstützer mussten ausgerottet, Vitalian eliminiert und Hypatius ausgetrickst werden. Wir sollten auch nicht die Möglichkeit außer Acht lassen, dass sich Onkel und Neffe über die Sache mit Theodora und die marodierende Zirkuspartei beinahe zerstritten hätten, so wie es damals bei Konstantin unruhig geworden war, als jener beschloss, Crispus aus der Thronfolge zu eliminieren.
Nun, selbst wenn wir nicht alle Details rekonstruieren können, sticht doch ein Punkt ganz deutlich hervor: Weder Justin noch Justinian sträubten sich gegen Julians »purpurnen Tod«. Beide hatten aktiv nach Macht gestrebt und bestimmte politische Entscheidungen zumindest teilweise zu dem Zweck getroffen, sich diese Macht zu sichern. Infolgedessen erbte Justinian im August 527 von seinem Onkel nicht nur den Kaiserthron, sondern zugleich eine Reihe bereits gefällter Entscheidungen, die die Anfangsjahre seiner Regierung entscheidend prägen sollten.