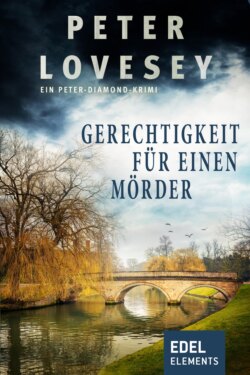Читать книгу Gerechtigkeit für einen Mörder - Peter Lovesey - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеAls Mountjoy vom Einkaufen im Supermarkt zurückkam, lag Samantha Tott reglos unter der karierten Decke. Tot? Nur einige rote Locken waren sichtbar, beängstigend reglos auf dem Kissen. Er stand in der Tür und überlegte, ob sie vielleicht erstickt war. Er hatte sie nicht mit Klebeband, sondern mit einem Stück Stoff geknebelt, das er von einem Bettlaken abgerissen hatte. Falls der Lappen bis zu den Nasenlöchern hochgerutscht war, hätte sie ihn nicht runterziehen können, weil ihre Arme gefesselt waren.
Er wollte gerade die Decke wegziehen und ihr den Knebel abreißen, als sie sich rührte.
Also doch kein Grund zur Panik.
Zieh dich zurück, sagte er sich, nach einer einschneidenden Änderung seiner Taktik. Laß sie schlafen. Nach dem Supermarkt lagen seine Nerven blank. Er brauchte mehr Zeit für sich, bevor er sich wieder auf ein Gespräch mit ihr einlassen konnte. Ehe er sich fortschlich, zog er die Schuhe aus, denn der Fußboden war wie ein gespanntes Trommelfell. Sachte stellte er die Einkaufstüte ab. Er hatte seit einer Ewigkeit nichts mehr gegessen, aber er würde warten. Warten war mittlerweile eine seiner Spezialitäten, eine Kunst, die er in Albany bis zur Meisterschaft vervollkommnet hatte.
Im Grunde war dieser Raum mit seinen Klappmöbeln einer Zelle nicht unähnlich. Sogar noch kleiner. An der Seite gegenüber ihrem Bett war eine schmale Bank, die man an die Wand klappen konnte. Er löste den Riegel, ließ die Bank herunter und nahm Platz, sehr sorgsam darauf bedacht, daß sie nicht quietschte.
Was für eine Wohltat.
Er saß unbeweglich in der Stille, wußte, daß er in Sicherheit war. Das Einkaufen war aufregend gewesen, und erst jetzt merkte er, unter welcher Anspannung er dabei gestanden hatte. Er hatte versucht, sich genauso selbstvergessen zu geben wie alle anderen im Supermarkt, und jedesmal, wenn jemand näher kam, hatte er angestrengt die Regale abgesucht. Zumindest war es sicherer, als in einem Tante-Emma-Laden einzukaufen. Das einzig größere Risiko waren die Kassen. Er hatte sich alle genau angesehen. An keiner war viel Betrieb, und so hatte er sich für eine junge Kassiererin entschieden, die mit einer Freundin an der Nachbarkasse plauderte, während sie die Waren über den Scanner schob. Er war durchgekommen, ohne ein Wort sagen zu müssen. Sein Gesicht hatte bei der Kassiererin keine Reaktion ausgelöst, da war er sicher. Und er war über einen Umweg zum Wohnwagenplatz zurückgefahren, obwohl das bedeutete, daß er das Motorrad über ein Feld schieben mußte; mühsam, aber notwendig.
Eine wirklich komische Freiheit, die er jetzt genoß. Wieder kam ihm der Gedanke, daß er die eine Zelle gegen eine andere eingetauscht hatte. Der einzige Unterschied war, daß er diese Zelle mit einer Frau teilte. Sei doch froh, du Glückspilz, würden die meisten in Albany sagen, wenn sie es wüßten. Bist du etwa schwul? Nein, bin ich nicht. Aber Sex gehört nicht zu meinem Plan. Ob ihr es glaubt oder nicht, ihr geilen alten Knackis, dies hier ist etwas Wichtigeres, um dessentwillen ich Samantha Tott mit Respekt behandeln muß. Ich kämpfe um Gerechtigkeit, und das andere kann warten.
Es war kalt hier drin, kälter als in Albany, und deshalb hatte er ihr die Decke gegeben. Vielleicht würde ihnen beiden wärmer, wenn sie etwas gegessen hatten. Er hatte mit dem Gedanken gespielt, Wodka oder Whisky zu kaufen, was lächerlich gewesen wäre, denn dafür hätte er sein ganzes Geld ausgeben müssen. Er hatte etwas über zwanzig Pfund dabeigehabt. Fünf, die er in Albany schwer verdient hatte, und fünfzehn aus der Gesäßtasche von Samanthas Jeans; schließlich verpflegte er sie. In den nächsten zwei Tagen würden sie sich von Corned beef, Brot, Tütensuppen, Bananen, Schokolade und Tee ernähren. Er hatte auch Milch und Zucker gekauft, und im Küchenschrank lag noch eine Packung Ingwerplätzchen, deren Verfallsdatum seit langem abgelaufen war. Außerdem gab es hier einen Kessel und einen Topf, die Gasflasche war Gott sei Dank nicht ganz leer, und er wußte, wo er Wasser herbekam. Wie ein alter Knacki einmal zu ihm gesagt hatte: Ohne Tee, ein Bett und ein Klo würden wir alle durchdrehen.
Ja, es war kein schlechtes Versteck für ein paar Tage, solange er auf der Hut war. Er hatte sich an den Platz erinnert, weil die Farm vor Jahren Erdbeeren verkauft hatte, die man selbst pflücken mußte. Die Wohnwagen, von denen keiner benutzt wurde, waren neben dem Erdbeerfeld aufgereiht gewesen. Die Besitzer zahlten dem Farmer eine Gebühr für den Stellplatz. Es hätte durchaus sein können, daß der Platz, seit Mountjoy in Albany war, anderweitig genutzt wurde, daher war er hingefahren und hatte sich vergewissert, bevor er Samantha entführte.
Samanthas Entführung. Es war wirklich ein hochriskantes Unternehmen gewesen, immer wieder die Stall Street entlangzulaufen, eine der belebtesten Straßen in Bath, und die Musiker zu beobachten, die dort in Quartetten, Trios, Duos und manchmal solo mit Orchesterbegleitung vom Band fiedelten. Die Stadt war überschwemmt mit klassischen Musikern. Alle zwei Stunden wechselten sie sich an den beliebtesten Standorten entlang der Fußgängerpassage ab. Schon am ersten Morgen hatte er genug Vivaldi für den Rest seines Lebens gehört. Als die gesuchte Dame nach zwei Tagen noch immer nicht aufgetaucht war, hatte er praktisch schon die Hoffnung aufgegeben. Dann, am Samstag nachmittag, hatte er sie entdeckt. Irrtum ausgeschlossen: Sie sah genauso aus wie auf dem Foto im »Express«. Blasses, ausdrucksvolles Gesicht, über das ein Lächeln glitt, wenn jemand eine Münze in ihren Geigenkasten warf. Tolles Haar – wirklich tolles Haar, ein Wust krauser Locken, die, was er nicht gewußt hatte, flammend rot waren; schließlich war in der Zeitung nur ein Schwarzweißfoto abgedruckt gewesen. Er hatte sich mehrmals angehört, was sie so geigte, und beschlossen, daß er sie am besten dann ansprach, wenn sie ihre Sachen zusammenpackte. Er hatte sich überzeugend als Besitzer eines neuen Restaurants in Batheaston ausgegeben und ihr zwölf Pfund die Stunde angeboten, wenn sie dort spielte. Es wäre vielleicht nicht ganz soviel, wie sie an einem guten Tag auf der Straße verdienen würde (wie er ganz richtig vermutete), aber im Oktober wäre es drinnen wärmer und angenehmer, und sie würde sicher Trinkgeld bekommen, wenn sie Musikwünsche der Gäste erfüllte. Er hatte seinem erfundenen Bistro einen französisch klingenden Namen gegeben, ihr erzählt, die Kellnerinnen wären alle Studentinnen, und sie eingeladen, es sich gleich anzusehen. Samantha war auf sein höfliches Getue hereingefallen und mit ihm zum Orange Grove gegangen, wo sie hinten auf sein Motorrad stieg, das sie in ihr Gefängnis brachte.
Jetzt bewegte sie sich wieder, drehte den Kopf auf dem Kissen und schob ihre rote Lockenpracht unter der Decke hervor. Die Augen öffneten sich, große blaugrüne Augen, die dunkel schattiert waren, aber nicht von Wimperntusche, sondern von Angst und Erschöpfung.
»Ja, ich bin wieder da«, sagte Mountjoy. »Ich mache Tee.« Und als sie ein Stöhnen von sich gab, offensichtlich damit er ihr den Knebel abnahm, erwiderte er: »Gleich.«
Er brachte ein paar Sachen in die Küche bzw. Küchenzeile, oder wie immer man diesen winzigen Bereich nannte, wo der Kessel und die Tassen standen.
»Hier ist frische Milch«, sagte er. »Die schmeckt wohl besser als das Zeug aus der Dose. Wenn Sie ein Sandwich möchten, kann ich Ihnen eines machen; ich habe Brot und Corned beef besorgt.«
Er ließ sich nicht aus Bosheit oder Sadismus Zeit damit, ihr den Knebel abzunehmen; er tat es, um sich auf die Situation einzustellen. Er war es nicht gewohnt, daß man mit ihm redete. Samantha war vermutlich nicht redseliger als andere Frauen ihres Alters. Aber ihm fiel es nun mal schwer nachzudenken, wenn jemand redete.
Als er das Teewasser aufgeschüttet hatte, ging er zu ihr und band den Knebel los, hielt dabei immer eine Armeslänge Abstand, um den unvermeidlichen Körperkontakt auf ein Mindestmaß zu beschränken. Das hatte er sich geschworen. Nach fast fünf Jahren Zölibat war das Risiko groß, daß irgendein unvorhergesehenes Ereignis seinen Plan zunichte machte. Jetzt schwach zu werden, wäre der reinste Wahnsinn.
Samantha rieb sich das Gesicht an der Schulter. Wo der Knebel gewesen war, zeichneten sich rote Striemen ab. »Wollen Sie mir nicht die Hände losbinden?«
»Dann drehen Sie sich um.«
»Ich weiß nicht, warum Sie mich geknebelt haben«, sagte sie, als sie mit dem Gesicht nach unten auf dem Kissen lag. »Hier ist bestimmt keiner in der Nähe, der mich schreien hören könnte. Wer wohnt im Oktober schon auf einem Wohnwagenplatz?«
Es war ein Trick, ein Versuch, ihm Informationen zu entlocken, und er antwortete nicht. Sie stellte ständig solche Fragen, wollte herausfinden, wo sie waren. Offenbar hatte sie die Angst überwunden, mit der sie verständlicherweise auf ihre Entführung reagiert hatte, und jetzt sprach sie in fast freundschaftlichem Ton mit ihm. Auch aus diesem Grund empfand er es als anstrengend, mit ihr zu reden. Er wäre besser klargekommen, wenn sie ihn mit anhaltender Feindseligkeit behandelt hätte. Aber sie war clever, entwaffnete ihn unablässig mit scheinbar spontanen Äußerungen.
Er goß ihr Tee ein. Sie setzte sich auf und umschloß die Tasse mit beiden Händen, um sich zu wärmen. »Haben Sie keine Zeitung besorgt?«
»In einem Supermarkt?«
Sie blickte ihn forschend an. »Die gibt es jetzt auch im Supermarkt zu kaufen. Gehen Sie denn nie einkaufen?«
Sie wußte nicht – oder konnte es eigentlich nicht wissen –, daß er aus dem Gefängnis ausgebrochen war. Aber schon ein paarmal wäre sie fast dahintergekommen.
Er sagte: »Zeitungen interessieren mich nicht.«
»Das sollten sie aber, wenn was über Sie drinsteht. Vielleicht haben sie ein Foto von mir abgedruckt. ›GROSSANGELEGTE SUCHE NACH VERMISSTER STUDENTIN‹.«
Mountjoy sagte: »Das hätten Sie wohl gern.«
»Mein Dad wird dafür sorgen. Er ist der Assistant Chief Constable, oder jedenfalls einer von ihnen.«
»Ich weiß.«
»Sie glauben wohl, bloß weil er ein hohes Tier bei der Polizei ist, schwimmt er in Geld, aber da täuschen Sie sich. Der Job wird nicht besonders gut bezahlt. Was machen Sie beruflich? Ich meine, abgesehen davon, daß Sie hilflose Frauen kidnappen?«
»Ich mache Ihnen Sandwiches, wenn Sie nicht allzu neugierig sind«, sagte Mountjoy.
»Okay.« Sie schlug die Decke beiseite. »Und ich muß jetzt die Beine frei haben.«
»Weshalb?«
»Seien Sie doch nicht so schwer von Begriff.«
»Schon wieder?«
Diese körperlichen Bedürfnisse waren für sie beide peinlich. Außerdem stellte das Losbinden ein zusätzliches Risiko dar. Sie war eine starke junge Frau, und jedesmal, wenn sie zum Klo ging, bestand die Gefahr, daß es nur ein Vorwand für einen Fluchtversuch war, daher mußte die Tür offenbleiben.
Er ließ sie das Kabel um ihre Knöchel lösen.
Sie sagte: »Was glauben Sie eigentlich, was ich machen würde, wenn Sie mich nicht fesseln? Ohne Schuhe würde ich wohl nicht weit kommen, oder?«
Er antwortete nicht. Öffnete bloß die Tür und hielt den Fuß dagegen, damit sie sie nicht schließen konnte. Bei seiner Planung war ihm der Wohnwagen für seine Zwecke ideal erschienen, ja komfortabel. Er hatte nicht vor, ihr unnötig Leid zuzufügen. Doch die Körperfunktionen hatte er nicht genug berücksichtigt. Jetzt erwiesen sie sich als zunehmend nervenaufreibend.
Als sie wieder rauskam, sprach sie fast genau das aus, was er dachte. »Wie lange soll das noch so weitergehen?«
»Kommt drauf an.«
»Worauf? Wie mein Vater reagiert?«
Er sagte: »Für mich kann es nicht früh genug aufhören.«
»Aber es muß so aufhören, wie Sie es möchten?«
»Natürlich.«
Nach einer Pause sagte sie: »Früher habe ich mir manchmal vorgestellt, gekidnappt zu werden, aber der Kidnapper war immer jemand wie Harrison Ford, und es waren auch genug Decken da, und ich habe nicht mal darüber nachgedacht, daß ich etwas Warmes essen oder mir frische Sachen anziehen möchte. Eine Geisel zu sein ist entwürdigend und widerlich. Haben Sie schon mit meinem Vater telefoniert?«
»Nein.«
»Wie haben Sie denn dann mit ihm Verbindung aufgenommen? Per Brief? Woher soll er denn wissen, daß ich entführt worden bin?«
»Es läuft alles nach Plan.«
»Haben Sie bei jemandem eine Nachricht hinterlassen?«
»So ungefähr.«
»Und Sie sind sicher, daß er Bescheid weiß?«
»Absolut.«
Sie grübelte eine Weile darüber nach.
»Spricht nicht gerade für meine Eltern, was? Wenn sie nicht Himmel und Hölle in Bewegung setzen? Verlangen Sie ein zu hohes Lösegeld?«
Er sagte: »Wollten Sie nun ein Sandwich mit Corned beef oder nicht?«
»Ja, hab ich doch gesagt. Sie haben nicht zugehört. Oder wollen Sie mich bestechen? Kriege ich erst was zu essen, wenn ich mit der Fragerei aufhöre? Ich kann mir das Sandwich selbst machen, wenn Sie mich lassen.«
Er ließ sie nicht in die Küche. Er sagte, sie solle sich wieder aufs Bett legen. Während er ihr das Kabel um die Knöchel wickelte, zog sie einen Kamm aus der Hosentasche und machte sich an ihren Haaren zu schaffen, zog die Strähnen auseinander und kämmte sie so, daß ihre üppige Lockenpracht wieder zur Geltung kam.
Mountjoy wollte etwas Nettes sagen, während er die unerquickliche Aufgabe erledigte, sie zu fesseln, und fragte: »Wie lange tragen Sie die Haare schon so?«
»Seit etwa sechs Monaten. Es müßte eigentlich weicher sein. Ich sollte es waschen.«
»Es sieht gut aus.«
»Es ist fettig und zerzaust, und es fühlt sich schrecklich an.«
»Ist es Natur?«
»Natürlich nicht. Ich sitze eine Ewigkeit beim Friseur.«
»Ich meine die Farbe.«
»Ach so. Ja, von Geburt an. Ich habe sie gehaßt, als ich klein war. Ständig wird man gehänselt.«
»Wenn Sie nicht auffallen wollen, warum tragen Sie dann so eine Frisur?«
»Ach, das stört mich inzwischen nicht mehr. Es ist ein großes Plus, bemerkt zu werden.«
»Von Männern, meinen Sie?«
Sie wurde rot und starrte ihn an, beunruhigt durch die Frage. Die sexuelle Bedrohung, die sie größtenteils aus ihren Gedanken verbannt hatte, war plötzlich wieder da. Sie sagte rasch und gepreßt: »Als Musikerin, meinte ich. In der klassischen Musik ist die Konkurrenz fast schon genauso groß wie in der Popmusik, was das Image betrifft. Man muß sich verkaufen können, genauso wie sein Talent. Also habe ich mich für eine Frisur entschieden, die Eindruck macht.«
Um das Vertrauen wiederherzustellen, sagte er beiläufig: »Sie machen Eindruck, ich mache das Sandwich.« Das Sandwich zu machen war nicht sehr aufwendig – eine quadratische Scheibe Corned beef zwischen zwei Scheiben Brot. Keine Butter oder Mayonnaise. Etwas Feineres gab die Küche nicht her.
Sie kämmte sich weiter die Haare. Sie arbeitete daran wie eine Katze, seit er sie hierhergebracht hatte. Sie fragte: »Was machen wir, wenn uns das Geld ausgeht? Sie haben doch bestimmt schon fast alles ausgegeben?«
Er antwortete nicht.
Sie sagte: »Sie werden meine Geige nehmen und auf der Straße spielen müssen. Spielen Sie Geige? Wenn nicht, müßte ich Ihnen Unterricht geben. Wäre auch ein guter Zeitvertreib.«
Er reichte ihr das Sandwich auf einem Teller und fragte, ob sie noch etwas Tee wolle. Es war noch ein wenig in der Kanne.
Sie sagte, ja. »Ich bin überrascht, daß Sie losen Tee gekauft haben. Teebeutel sind praktischer. Ich kaufe nur Teebeutel. Man kriegt sie mittlerweile in allen möglichen Sorten – Orange Pekoe, Earl Grey, Lapsang Souchong.«
Das »mittlerweile« war wieder ein Seitenhieb. Sie hatte sich ausgerechnet, daß er auf der Flucht war, da war er fast sicher. Er regte sich nicht darüber auf. Es spielte eigentlich keine Rolle mehr. Nur zu Anfang hatte er sie nicht in Panik versetzen wollen.
Sie fragte: »Was haben Sie sonst noch in der Einkaufstüte? Haben Sie was zum Naschen besorgt?«
»Schokolade.«
»Davon krieg ich leider Pickel, aber wenn ich richtig Hunger habe, esse ich welche. Darf ich mal sehen?« Sie ließ den Kamm fallen und streckte die Hand nach der Tüte aus, die noch immer auf dem Boden lag, mit einigen Sachen drin.
»Nein.«
»Wieso nicht?« Sie klang richtig gekränkt. »Was ist denn dabei, wenn ich sie mir ansehe. Ich esse Ihnen schon nichts von Ihrer kostbaren Schokolade weg, versprochen.«
Er hob die Tüte auf und brachte sie in die Küche.
»Es war mein Geld«, stellte sie klar. »Ich habe ein Recht darauf zu erfahren, was Sie dafür gekauft haben.«
In der Küche fing er an, die Sachen in dem winzigen Schrank zu verstauen. Um sie nicht mehr als nötig zu provozieren, sagte er: »Zwei geschnittene Brote, vier Packungen Hühnersuppe, ein halber Liter Milch, acht Scheiben Corned beef, sechs Bananen, etwas Tee und Zucker. Zufrieden?«
»Und die Schokolade.«
»Und die Schokolade.«
Sie sagte: »Ich begreife nicht, warum Sie aus einer Einkaufstüte so ein Staatsgeheimnis machen.«
Er sagte: »Weil es langweilig ist.« Und außerhalb ihres Gesichtsfeldes nahm er den letzten Artikel aus der Tüte und verstaute ihn so auf dem Küchenschrank, daß er nicht zu sehen war.
Es war eine Packung Haarfärbemittel mit der Aufschrift »Mocha«.