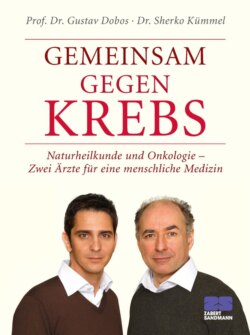Читать книгу Gemeinsam gegen Krebs - Prof. Dr. med. Gustav Dobos - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Integration statt Abgrenzung
ОглавлениеDie USA sind Vorreiter in der individualisierten Medizin, sowohl in der Tumorbiologie als auch beim Einsatz traditioneller Heilverfahren, die dort meist als »Komplementärmedizin« (CAM, complementary and alternative medicine) bezeichnet werden. Unter dem Druck des enormen Patienteninteresses wurde die Forschung auf diesem Gebiet staatlich gefördert: Seit 1992 gibt es ein National Center of Complimentary and Alternative Medicine (NCCAM), das allein im Jahr 2010 128 Millionen Dollar in Studien investierte.
Das Land wissenschaftlicher Eliten mit multiethnischen Wurzeln betrachtet traditionelle Heilverfahren nicht (wie in Europa häufig üblich) isoliert und in den engen Grenzen ideengeschichtlicher Dogmen, sondern praktiziert sie in Kombination mit schulmedizinischen Verfahren und wissenschaftlich überprüft. CAM ist also nicht mit den in Deutschland als »alternativ« bezeichneten Außenseiterverfahren gleichzusetzen.
Die Reaktion auf die Nachfrage der Patienten
Weil 80 Prozent der Männer mit Prostatakrebs nach ergänzenden Therapien fragen, sah sich die einflussreiche American Urological Association gezwungen, eine onkologische CAM-Arbeitsgruppe zu gründen. 2002 wurde der erste Fachartikel über Integrative Onkologie, die Kombination aus konventionellen und naturheilkundlichen oder traditionellen Behandlungen, in einem anerkannten Journal veröffentlicht. 2003 gründete sich als internationale Fachgesellschaft eine Society for Integrative Oncology (SIO), die seither entsprechende Forschungsansätze und Erfahrungen aus der klinischen Praxis koordiniert und diskutiert. 2007 wurden von ihr die ersten Leitlinien für die klinische Praxis veröffentlicht.
KREBS UND GENETIK
Im Rahmen des internationalen Humangenomprojekts wurden in 13 Jahren 30.000 Gene mit 2,9 Milliarden Bausteinen sequenziert und identifiziert. Analyse und Interpretation dieser ungeheuren Datenmenge werden noch viele Jahre dauern. Doch um 2020, so glauben Tumorbiologen, könnten die wesentlichsten Ergebnisse vorliegen, was den Zusammenhang zwischen Krebs und Genetik angeht.
Dass Krebs so schwer zu besiegen ist, hängt auch damit zusammen, dass das ihr zugrunde liegende Prinzip der Mutation schon uralt ist und im Laufe der Jahrmillionen evolutionär das Leben auf diesem Planeten geprägt hat. Ohne dieses gäbe es keine Vielfalt in der Natur: Alles Leben bestünde aus identischen Kopien.
Vor etwa eineinhalb Milliarden Jahren jedoch begannen sich in den primitiven Mehrzellern einzelne Zellen zu spezialisieren. Das war nicht nur der Beginn der Entwicklung höherer Lebewesen, sondern zugleich auch die Grundlage der Krebsgenese. Denn ein Tumor entsteht, wenn die Zellen in einem Organismus ein Eigenleben zu führen beginnen und sich unkontrolliert vermehren.
Krebs kann sämtliche Wirbeltiere befallen und sogar bei einigen Schnecken vorkommen. Der älteste bekannte Tumor wurde in einem 150 Millionen Jahre alten Dinosaurierknochen gefunden.
Schäden an der Erbinformation
Die Nukleotide, das sind Moleküle der Erbsubstanz, bilden im Zellkern Codes aus unterschiedlichen Kombinationen der vier Nukleinsäuren A, T, G und C. Diese fügen sich zu einem geschraubten Doppelstrang (Doppelhelix) zusammen – zur Desoxyribonukleinsäure (DNS).
Täglich treten durch die verschiedensten Einflüsse mehrere zehntausend Schäden am Erbgut auf, von denen die meisten repariert werden. Trotzdem trägt jeder Mensch in seinen Zellen Fehler mit sich herum. Bei jeder Zellteilung öffnet sich der Doppelstrang, wird abgelesen und kopiert; dabei werden diese Schäden auf die Tochterzellen übertragen. Manchmal passieren währenddessen auch Kopierfehler, und Abschnitte der DNS werden doppelt vervielfältigt. Lebt die Zelle in einer ungesunden Umgebung, kommen weitere Fehler hinzu – zum Beispiel durch Sonneneinstrahlung. Diese kann mit ihrer Energie die Doppelhelix auseinanderreißen. Auch Umweltgifte wie zum Beispiel Zigarettenrauch verändern das Erbgut: Das DNS-Molekül kann sich dadurch verformen. Wieder werden die Schäden bei der Teilung an die Tochterzellen weitergegeben.
Der Mensch besteht aus etwa hundert Billionen Zellen. Bei jeder Zellteilung und der Verdoppelung des menschlichen Genoms mit seinen drei Milliarden Bausteinen entstehen ungefähr 12 Fehler – das macht 1,2 Billiarden Fehler. Irgendwann führt diese Rechenlogik zu Krebs – wenn der Mensch nicht vorher an einer anderen Krankheit stirbt. Denn wenn sich die Fehler auf einem Abschnitt häufen, der für die Vermehrung der Zelle oder ihre Lebensdauer von Bedeutung ist, verliert diese eines Tages die Kontrolle und beginnt, sich unkontrolliert zu teilen: Der Zellhaufen wächst, ein Tumor entsteht.
Ausgangspunkt Stammzellen
Krebs befällt vor allem Gewebe, die sich häufig erneuern oder nach Verletzungen regenerieren müssen. Dazu verfügen sie über Stammzellen, die speziell dazu da sind, neue Zellen hervorzubringen. Sie sind langlebig, wenig spezialisiert, unbegrenzt teilungsfähig und können im Körper wandern. Diese Stammzellen sind ein idealer Ausgangspunkt für einen Tumor. In Muskeln, Knochen oder Augen sind Stammzellen nur so lange aktiv, wie der Körper im Wachstum begriffen ist. Deshalb tritt Krebs dort vor allem in Kindheit und Jugend auf.
Der Krebsgenom-Atlas
Im Jahr 2006 starteten Krebsgenetiker an amerikanischen Genomzentren und am britischen Sanger-Institut ein 100 Millionen Dollar schweres Pilotprojekt mit dem Ziel, defektes Erbgut von Tumoren zu decodieren. Erprobt wurde dabei die Logistik für ein epochales Unterfangen: »The Cancer Genome Atlas«, eine Bibliothek sämtlicher Gendefekte bei allen bekannten Krebsarten. Dafür werden in den kommenden Jahren die Gendaten von mehr als 100.000 Tumoren erfasst.
Weil dieses Projekt nicht im Alleingang zu bewältigen ist, gründeten Ende 2008 Genomzentren aus 22 Industriestaaten das International Cancer Genome Consortium. Das Ziel: Zunächst sollen die Zellfunktionen der 50 wichtigsten Tumorarten komplett dechiffriert werden. In Großbritannien und Frankreich werden Typen von Brustkrebs durchleuchtet, Chinesen kümmern sich um die Gendefekte von Magenkrebs, Japaner decodieren Leberkarzinome, Inder die Krebstypen der Mundhöhle. In Deutschland werden unter Führung des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg kindliche Hirntumoren »kartiert«. Das Bundesforschungsministerium und die Deutsche Forschungsgemeinschaft haben dafür 15 Millionen Euro zugesagt.
Ziel ist es, die Proteine kennenzulernen, die der Körper anhand von krankhaft veränderten Genen herstellt, um sie sodann zielgerichtet blockieren zu können. Auch sollen Prognosen möglich werden, wie schnell die Krankheit voranschreiten wird, um den Behandlungsplan daran anzupassen. Drittens möchte man herausfinden, ob ein Patient aufgrund seines individuellen Gencodes auf eine bestimmte Behandlungsform überhaupt ansprechen kann. Um diese Ziele zu erreichen, sollen für jede Krebsart 500 Proben von erkranktem und ebenso viele von gesundem Gewebe analysiert werden.
Die »prognostische Signatur«
Um schneller zu praktischen Erfolgen zu gelangen, hat der deutsche Genforscher Hans Lehrach vom Max-Planck-Institut für molekulare Genetik in Berlin gemeinsam mit Kollegen vom Charite Comprehensive Cancer Center (CCCC) und von der Harvard Medical School im Jahr 2009 das Treat-1000-Projekt gestartet. Es arbeitet mit Computermodellen, welche die wichtigsten tumorbiologischen Erkenntnisse der vergangenen Jahrzehnte enthalten, und will anhand individueller Genomdaten Prozesse in den Krebszellen simulieren und den Effekt von Wirkstoffen voraussagen. Im Zentrum stehen dabei Signalketten, eine Art Kommandostruktur, die das Geschehen in der Zelle steuert. Ob sich eine Zelle teilt, ob sie abstirbt oder sich auf Wanderschaft in andere Bereiche des Körpers begibt, hängt nach dem jetzigen Wissensstand von etwa einem Dutzend Signalketten ab, die wiederum aus verschiedenen Molekülen bestehen – Angriffspunkte für eine Krebstherapie. Gesucht wird nun nach einer Art »prognostischer Signatur«, die bei einzelnen Krebsarten ein Anzeichen für einen besonders bösartigen Verlauf darstellt.
In diesem Forschungsprojekt soll das Krebsgenom von 1000 Patienten untersucht werden. Der erste Patient, der sich für diese Forschung zur Verfügung stellte, verstarb, bevor das Computerprogramm zwei Vorschläge für Therapeutika machen konnte. Wie komplex das Krankheitsgeschehen bei Krebs ist, zeigte die Analyse seines Krebsgenoms: Dort fanden die Tumorbiologen 670 veränderte Gene, und mindestens 25 davon schienen unmittelbar am Krebsgeschehen beteiligt zu sein.
Unterschiedlichste Gendefekte
Die rund 230 bekannten Tumorarten, die nach zellbiologischen Besonderheiten unterschieden werden, sind wahrscheinlich auf unterschiedlichste Gendefekte zurückzuführen. In der Praxis bedeutet das, dass zum Beispiel Magenkrebs von Patient zu Patient unterschiedlich behandelt werden muss – wenn man die Genetik irgendwann entschlüsselt und ihre Auswirkungen verstanden haben wird. Oder das Glioblastom, ein meist tödlicher Hirntumor: Hinter dieser Krankheit, ergaben Genomanalysen, stecken mindestens vier unterschiedliche genetische Ursachen.
Im Moment jedenfalls scheint sich das bisherige Wissen der Onkologie im Fokus der Krebsgenetik aufzulösen: Jede Tumorzelle, schrieb das renommierte Wissenschaftsjournal Nature, sei ein genetisches Katastrophengebiet, übersät mit Mutationen, die sich nicht nur von einer Krebsart zur nächsten unterscheiden, sondern auch von Patient zu Patient.
Tests zur Medikamentenwirksamkeit
Ein erstes Praxisfeld für die Tumorgenetik sind Tests, die zeigen sollen, ob die Krebsgeschwulst auf ein Medikament überhaupt anspricht. Auch die großen Pharmahersteller arbeiten dabei mit den Verfahren der Genomanalyse: Sie testen zunehmend neue Präparate nur an solchen Patienten, bei denen das Genprofil des Tumors Wirksamkeit in Aussicht stellt. Vielleicht führt das auch zu einer Revision früherer klinischer Tests und so zu einer Fülle von »Lazarus-Medikamenten«. Denn Wirkstoffe, die wegen schwacher Wirksamkeit in der letzten Phase der Prüfung durchgefallen waren, könnten bei einzelnen genetisch definierten Patientengruppen dennoch wirksam sein.
Trastuzumab bei Brustkrebs zum Beispiel, aber auch Imatinib bei Leukämie oder Gefitinib bei Lungenkrebs wirken immer nur bei einem Teil der Tumorpatienten. In der vorklinischen Prüfung in Deutschland ist ein Test für Bauchspeicheldrüsenkrebs, der zeigt, ob eine Chemotherapie noch Aussicht auf Besserung bringt oder nur noch die Lebensqualität beeinträchtigt. Weil das Krebsgeschehen aber sehr komplex ist, erlauben auch solche Tests keine hundertprozentigen Aussagen.
Große Hoffnungen setzen Genforscher in die Entschlüsselung des Prozesses der Metastasierung. Tochtergeschwulste nämlich zeigen ein vom Ursprungstumor abweichendes Genprofil (Diskordanz), das zumindest bei Lungen-, Prostata- und Brustkrebs dasselbe zu sein scheint. Sollte sich diese Annahme als richtig erweisen, wäre es möglich, eine gemeinsame Strategie gegen die Tochtergeschwulste zu finden.
Hoffnungen für die Zukunft
Die Sequenziertechnik, die diese Genanalysen ermöglicht, entwickelt sich mit Lichtgeschwindigkeit: Schon 2013 sollen sämtliche Gendaten eines Patienten in wenigen Minuten zu ermitteln sein. Die Kosten dafür, so wird erwartet, werden von Tausenden von Dollar auf weniger als 100 sinken.
Mit der Geschwindigkeit im Ablesen von Genfehlern können die therapeutischen Antworten jedoch nicht mithalten: Obwohl man inzwischen Defekte in rund 350 Genen kennt, die mit Krebs in Verbindung gebracht werden, hängt es von vielen weiteren individuellen Faktoren ab, ob sich ein Tumor entwickelt. Erst wenn dieses »Mutationsspektrum« bekannt ist, kann eine Therapie zielgerichtet bestimmt werden.
Integration in ein gemeinsames Konzept
Donald Abrams, Medizinprofessor an der University of California und Leiter der Abteilung für Hämatologie/Onkologie am General Hospital in San Fransisco, betont, dass die Integrative Onkologie evidenzbasiert ist, das heißt, sie gründet sich auf wissenschaftlich überprüfte Studien. Wo sie nicht vorliegen, können auch gut dokumentierte Verfahren der Erfahrungsmedizin zum Einsatz kommen – wenn das mit einer Therapie verbundene Risiko gering ist.
In der Integrativen Onkologie versteht sich die Naturheilkunde nicht als Gegensatz zur, sondern als selbstverständlicher Bestandteil der onkologischen Heilkunde, wissenschaftlich evaluiert und abgestimmt mit den klassischen Methoden wie Operation, Chemotherapie oder Bestrahlung. Zugleich aber erweitert sie die herkömmliche Onkologie, indem sie neben der Krebszelle den ganzen Körper, neben der Psyche auch den Geist, neben der stofflichen Seite des Menschen auch seine energetischen Ebenen berührt.
Während sich die Hochleistungsmedizin auf ihre Weise immer stärker ausdifferenziert und personalisiert, nähert sich die Naturheilkunde diesem Ziel, indem sie die individuellen Stärken der Patienten zu wecken sucht und diese zu Mitstreitern gegen die Krankheit macht, Seite an Seite mit dem Arzt.
Krebskliniken mit Vorreiterrolle
Viele führende Krebskliniken der USA haben Abteilungen für Integrative Onkologie gegründet, wo dieser Ansatz praktiziert, weiter erforscht und auch multiprofessionell gelehrt wird. Ein Leukämiepatient war der Initiator der ersten – im Dana-Farber Cancer Institute in Boston. Leonard P. Zakim, als Leiter einer Menschenrechtsorganisation ein erfahrener Lobbyist, suchte 1995 gemeinsam mit seinem Arzt nach Möglichkeiten, sich selbst intensiver an seiner Behandlung zu beteiligen. Es gelang ihm, ein multidisziplinäres Team für seine Idee zu begeistern und eine Million Dollar an Spenden aufzutreiben. Er lebte noch drei Jahre. Ein Jahr nach seinem Tod eröffnete die Harvard Medical School 1999 das Leonard P. Zakim Center for Integrative Therapies. Dessen Ziel ist insbesondere die Integration komplementärer Behandlungsansätze (vor allem der chinesischen Medizin).
Eine der renommiertesten Krebskliniken ist das Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in New York. 1884 gegründet, ist es die älteste und größte private Institution dieser Art weltweit. Auch sie unterhält seit 1999 eine Abteilung für Integrative Medizin, in der ein Schwerpunkt die Behandlung von Krebskrankheiten ist. 17.000 Patienten werden dort jährlich von rund 50 Mitarbeitern betreut.
Ein wichtiger Schwerpunkt im »Sloan-Kettering« ist die Beschäftigung mit der Kräutermedizin. Eine auch für Laien verständliche Internetseite zu diesem Thema (www.MSKCC.org/aboutherbs) hat in den USA Schlagzeilen gemacht: Sie wurde bereits ein Jahr nach ihrer Gründung im Scientific American zu einer der fünf besten US-Medizinseiten gekürt. 2008 wählten sie die Wissenschaftsautoren der New York Times zudem zu einer von neun Top-Informationsseiten im Bereich Gesundheit. Die Internetseite bietet über 240 Monografien zu Kräutern, Vitaminen, Mineralstoffen, aber auch zu ungeprüften Verfahren im Bereich der Krebsmedizin auf der Basis nachvollziehbarer wissenschaftlicher Daten. Der Zugang ist kostenlos.
Im MD Anderson Cancer Center der Universität Texas stehen Kooperation und Kommunikation im Mittelpunkt eines patientenzentrierten Ansatzes der Krebsbehandlung. Neben den klassischen onkologischen Behandlungen kommen dort seit 1998 viele unterstützende Verfahren wie Akupunktur, Physiotherapie, Ernährungsmedizin oder Mind-Body-Medizin zum Einsatz. Die CIMER-Website (www.mdanderson.org/cimer) informiert nicht nur alle interessierten Laien über wichtige Studienergebnisse und unerwünschte Wechselwirkungen zwischen naturheilkundlichen und onkologischen Therapien. Sie liefert auch Basiswissen für die Therapeuten der Onkologie und der Naturheilkunde.
Die Johns Hopkins Medical Institutions in Maryland gehören zu den traditionsreichsten medizinischen Einrichtungen der USA, gegründet 1889 in Baltimore/Maryland. Inzwischen umfasst sie auch eine medizinische Fakultät, eine Akademie für die Pflegeausbildung und ein Institut für Public Health (Gesundheitswissenschaften). 1999 entstand der Plan, ein Forschungszentrum für komplementäre Medizin zu gründen. Dieses wurde durch stationäre und ambulante Kliniken ergänzt. Behandlungsschwerpunkte sind Akupunktur, Massage und Mind-Body-Medizin.
Die Mayo-Klinik in Minnesota ist berühmt für ihren besonders hohen Anspruch an eine wissenschaftlich fundierte evidenzbasierte Medizin. Sie pflegt darüber hinaus in besonderem Maße die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Ärzten, Physikern, Biologen und Labormedizinern. 2002 nahm sie die evidenzbasierte Forschung zur Komplementärmedizin auf sowie klinische Studien auf diesem Gebiet. Seit 2004 existiert eine Beratungsstelle für Patienten.