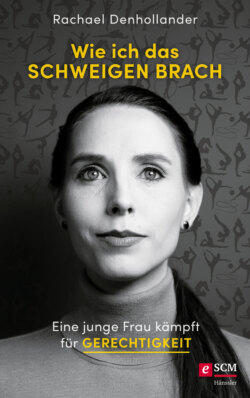Читать книгу Wie ich das Schweigen brach - Rachael Denhollander - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DREI
Оглавление»Du wirst enttäuscht sein«, sagte mein Vater ernst.
»Was ist?«, schrie ich fast durchs Telefon. »Haben sie verloren? Was meinst du damit?«
»Ich meine damit, dass du enttäuscht sein wirst.« Es kratzte in der Leitung.
»Oh nein …«, stöhnte ich. »Wie konnten sie verlieren? Sie lagen gestern Abend so weit vorn! Du musst mir erzählen, was passiert ist!«
»Auf gar keinen Fall«, lachte mein Vater. »Du musst warten, bis wir es heute Abend zusammen ansehen.«
»Du machst mich wahnsinnig!«
Es war der Sommer 1996. Die Olympischen Spiele fanden in diesem Jahr in Atlanta statt, und das Mannschaftsfinale der Turnerinnen war am Vorabend ausgestrahlt worden. Ich verfolgte den Sport schon seit einiger Zeit wie besessen. Die Turnerinnen, ihre Trainer, das Punktesystem, die internationale Konkurrenz … das alles war unglaublich spannend für mich. Ich kannte die Kürmusik jeder einzelnen Turnerin und meine Lieblingselemente ihrer Übungen, wusste, welche Turnerinnen so groß waren wie ich und welche bei diesen Spielen vielleicht Rekorde brechen würden. Ich hatte jeden Wettkampf verfolgt außer den vom Vorabend, an dem die Frauen im Mannschaftsfinale angetreten waren. Wie die ganze Nation hatte ich seit Monaten auf diesen vielversprechenden Wettkampf gewartet, es gab nur ein Problem. Das Mannschaftsfinale wurde spät nachts ausgestrahlt – und meine Eltern bestanden auf regelmäßige Schlafenszeiten.
Das muss man sich mal vorstellen. Es war das größte Ereignis im Turnen, unser Team würde vielleicht die erste US-amerikanische Frauenmannschaft aller Zeiten werden, die eine Goldmedaille gewann! Und meine Eltern schickten mich ins Bett.
Immerhin hatten sie mir versprochen, die Übertragung für mich aufzunehmen, damit ich mir jede einzelne Kür ansehen konnte. Wir würden es am nächsten Tag gemeinsam anschauen, sagten sie. Großartige Idee. Nur dass ich, als ich am nächsten Morgen aufwachte, aus dem Bett sprang und schrie: »Haben sie gewonnen? Was ist passiert? Haben sie gewonnen?« Die Antwort, die ich darauf erhielt, war: »Wir werden es alle gemeinsam ansehen«, was so viel bedeutete wie: »Und davor werden wir dir nichts verraten!«
Was noch schlimmer war: Gemeinsam bedeutete mit meinem Vater. Nach der Arbeit. Abends. Das hieß, dass ich den ganzen Tag warten musste, um zu erfahren, was passiert war.
Egal wie sehr ich drängte, meine Mutter weigerte sich, auch nur ein Wort darüber zu verlieren, wie das Finale am Vorabend ausgegangen war.
»Du musst es mir erzählen!«, jammerte ich mit beinahe verärgertem Unterton.
»Kommt gar nicht infrage«, antwortete sie, während sie ganz offensichtlich jeden Augenblick genoss. »Du wolltest das ganze Erlebnis, es unmittelbar mitverfolgen, also werde ich dir nichts sagen! Du musst es selbst herausfinden, wenn wir es heute Abend ansehen!«
»Ahh!«, rief ich.
Dann hatte ich einen brillanten Einfall. Ich wartete, bis Mama die Küche verließ, eilte zum Papierkorb und begann, die Zeitungen zu durchwühlen. In der Ausgabe von heute Morgen würde ich die Ergebnisse sicher finden.
Ha!, dachte ich triumphierend, während ich darauf achtete, keinen Lärm zu machen. Die Wahrheit war, dass ich Spannung hasste und es nicht ausstehen konnte, Dinge nicht zu wissen. Ich war eines der Kinder, die ein Wörterbuch benutzten, um jedes Wort nachzuschlagen, von dem meine Eltern sagten, dass sie es mir erklären würden, wenn ich älter wäre. Ich war eigenständig. Ich konnte die Antworten selbst finden. Ich würde einfach einen Blick auf die Ergebnisse werfen und meinen Eltern nichts davon erzählen, damit sie am Abend ihr Freude genießen konnten, mich zu »überraschen«. Wo war diese blöde Zeitung?
»Ach übrigens, wir haben die Tageszeitung versteckt«, rief Mama beiläufig vom Wohnzimmer herüber, »also such sie erst gar nicht.«
Meinen Eltern war wirklich alles zuzutrauen. Es dauerte eine Ewigkeit bis zum Abend. Endlich durfte ich in dem schwelgen, was das halbe Land – jeder, der keine Eltern hatte, die auf Schlafenszeiten bestanden – bereits am Vorabend genossen hatte. Begeistert kreischte ich bei jeder schön ausgeführten Serie von Überschlägen, jeder Reckübung und Schwebebalken-Kür, voller Ehrfurcht vor der absoluten Perfektion, die über unseren Fernsehschirm wirbelte. Der unglaubliche Fleiß und die harte Arbeit dieser jungen Frauen zahlten sich direkt vor meinen Augen aus, als sie eine Übung nach der anderen mit Bravour meisterten. Und wie der Rest der Welt schnappte ich erschrocken nach Luft, als Dominique Moceanu in der vorletzten Übung des Wettkampfs bei ihren beiden Sprunglandungen stürzte und somit drohte, das amerikanische Team in letzter Minute vom ersten Platz zu stoßen. Ich konnte mir kaum vorstellen, wie sie sich gefühlt haben musste. Ich wusste, dass sie sehr gut war, sehr hart gearbeitet hatte und ihr der Wettkampf sehr wichtig war. Jetzt blieb nur noch Kerri Strug übrig – mit dem letzten Sprung des Abends. Ich wusste, wie das Punktesystem funktionierte; noch ein gelungener Sprung würde dem Team den Sieg sichern. Aufgeregt beugte ich mich nach vorne. Jeder meiner Muskeln war angespannt, als sie die Anlaufbahn entlangsprintete, sich vom Sprungbock abstützte, darüberflog und dann … auch Kerri schaffte es nicht, präzise zu landen. Als sie für ihren zweiten Sprungversuch zum Startpunkt zurückhumpelte, war klar, dass sie sich am Fuß verletzt haben musste.
»Neeein. Nein, nein, nein!«, jammerte ich und hielt mir die Hände vors Gesicht. »Sie werden verlieren. Sie sind so nah dran und jetzt werden sie verlieren!« Das also hatte mein Vater gemeint. Aber es gab noch einen winzigen Hoffnungsschimmer. Noch war ein letzter Sprung ausstehend. Und wie am Vorabend sicher auch der Rest der Welt schrie ich vor Aufregung, als Kerri nach diesem letzten Sprung auf ihren Füßen landete, kurz stehen blieb und dann – offensichtlich von Schmerzen überwältigt – auf der Matte zusammenbrach.
Ich sah, wie die Trainer und ein Arzt zu ihr eilten. »Ich hab sie, ich hab sie, … ich hab sie«, hörte ich eine Männerstimme sagen.
Die Emotionen des Augenblicks waren förmlich spürbar. Diese jungen Mädchen hatten mit ihren perfekten Körpern geschafft, was keinem anderen US-amerikanischen Turnerinnen-Team je gelungen war. Sie hatten einen hohen Preis bezahlt, einschließlich der Verletzung einer Kameradin, aber sie hatten durchgehalten. Es war unglaublich.
Wieder einmal wusste ich, wie sehr ich diesen Sport liebte. Als ich klein war, hatte ich regelmäßig Turnstunden gehabt und war seitdem davon fasziniert. Ich konnte mich an vieles nicht mehr erinnern – nur daran, wie sehr die Schaumgrube gestunken hatte. Und wie gerne ich hatte weiterturnen wollen, als es aus finanziellen Gründen nicht mehr möglich gewesen war. Es war einfach zu teuer.
Inzwischen war ich elfeinhalb, also ein paar Jahre zu alt, um ernsthaft eine Karriere als Turnerin zu beginnen. Trotzdem wollte ich zurück in die Turnhalle. Alles daran faszinierte mich. Ich liebte die Kombination aus geistiger und körperlicher Fähigkeit, die der Sport erforderte. Den hohen Grad an Perfektion und die vielen Wiederholungen, die nötig waren, um jede Bewegung makellos und schön auszuführen. Ich staunte über die körperliche Stärke und Gelenkigkeit der Turnerinnen sowie über ihren Fleiß und ihre Entschlossenheit. Es gefiel mir, dass man diesen Sport nicht halbherzig oder nebenbei erlernen konnte. Ich war Perfektionistin und wollte einen Sport, der genau das von mir verlangte.
Nach diesem Abend, an dem ich zugesehen hatte, wie unser Team sich die Goldmedaille holte, begann ich, meine Eltern darum zu bitten, wieder Turnunterricht nehmen zu dürfen. Ich flehte und bettelte, bis meine Mutter bei ein paar Vereinen anrief. Aber die Gebühren waren selbst für Einsteiger ziemlich hoch und stiegen danach rapide an.
Als wir wieder einmal darüber diskutierten, platzte ich plötzlich heraus: »Ich werde mithelfen, das Geld dafür aufzutreiben.«
»Wie bitte?«, fragte meine Mutter ein wenig erschrocken.
»Ich werde helfen, dafür zu bezahlen«, wiederholte ich.
Sie schwieg einen Moment. »Du willst es wirklich so gerne?«
»Ja.« Ich atmete tief durch. »Ja, ich will es wirklich.«
Ich arbeitete schon seit einiger Zeit als Babysitterin und war es gewohnt, Geld beizusteuern, wenn ich etwas Besonderes haben wollte. Für meinen Klavierunterricht half ich Mama bereits, das Haus meines Klavierlehrers zu putzen – ein freundliches Entgegenkommen meines Lehrers, welches es mir und meinen Geschwistern ermöglichte, ein Instrument zu erlernen. Die Idee, für meine Turnstunden zu arbeiten, erschien mir also völlig logisch. Alles, was ich wollte, war eine Chance.
»Na gut«, antwortete meine Mutter. »Wenn es dir wirklich so viel bedeutet, werden wir einen Weg finden, es möglich zu machen.«
Ein paar Wochen später stand ich in einem kleinen Turnstudio, inmitten eines Einkaufszentrums. Ich sah zu, wie ein Mädchen einen Handstützüberschlag vorwärts übte – in einem winzigen Vorraum, der noch dazu mit Plastikstühlen vollgestopft war. Der renovierte Laden, in dem sich auch eine Turnhalle befand, war so klein, dass nur eine halbe Tumbling-Bahn, ein verkürzter Sprunganlauf, ein Stufenbarren und ein paar Schwebebalken hineinpassten. Einige Matten und die nötige Ausrüstung fürs Männerturnen rundeten die kleine, vollgestellte Arena ab. Es war kaum etwas los – nur eine Handvoll Mädchen im Wettbewerbs-Team und ein paar Freizeitkurse.
Nebenan boten die Angestellten von Claire’s Boutique duftende Lotionen und glitzernde Haarspangen feil, während einen Raum weiter Turnerinnen mit blutenden Händen und zweckmäßigen Pferdeschwänzen durch die Luft wirbelten. Man konnte den Kreidestaub in der Luft riechen. Ich liebte es.
Meine Mutter freundete sich sofort mit der Empfangsdame an, und später bemerkte sie, wie gut sie es fand, dass die Eltern alles sehen und hören konnten, was in der Turnhalle vor sich ging. Wir hatten beide noch keine Ahnung von der dunklen Seite, die mein Lieblingssport mit sich bringen würde, aber meine Mutter besaß eine große Portion gesunden Menschenverstand. Zu wissen, was mit ihren Kindern geschah, war für sie immer sehr wichtig. Sie hatte auch keine Scheu davor, die einzige Mutter zu sein, die immer dabei war, um alles zu beobachten, auch wenn andere Eltern sich deshalb über sie lustig machten.
»Es ist egal, was die anderen sagen oder denken«, sagte sie mir. »Dein körperliches und geistiges Wohl sind es mir wert, als Spinnerin angesehen zu werden!«
Als wir die Turnhalle an jenem Tag verließen, war ich für den Anfängerkurs angemeldet, besaß meinen ersten Turnanzug (aus Baumwolle, mit graublauem Karomuster) und war so aufgeregt, dass ich Schmetterlinge im Bauch hatte. Die fünf Tage, die ich auf meine erste Stunde warten musste, fühlten sich wie eine Ewigkeit an.
Als ich in der darauffolgenden Woche aus dem kleinen Studio trat, war ich erschöpft, aber beschwingt. Mein Trainer war der Betreiber der Turnhalle, ein ehemaliger Goldmedaillengewinner aus Osteuropa. Er übernahm die meiste Trainingsarbeit – angefangen bei dem großartigen Mädchen, das ich am ersten Tag über die halbe Tumbling-Bahn hatte wirbeln sehen, bis hin zu Anfängerinnen wie mir.
Was mich betraf, ich sah lächerlich aus und wusste es. Mit meinen fast zwölf Jahren war ich 1,67 Meter groß, schlaksig, mit langem Oberkörper. Ganz und gar nicht wie die winzigen Athletinnen, mit denen ich trainierte, die kompakte Muskeln und einen perfekten Körperbau hatten. Doch ich wusste, was ich wollte und dass ich alles erreichen konnte, wenn ich nur hart genug dafür arbeitete. Eigentlich reichte es mir schon, es einfach nur um der Freude willen zu tun, die es mir brachte.
Das erste einstündige Training verließ ich wie im Rausch. Nicht nur, weil ich endlich turnen durfte, sondern weil ich nun eine Vorstellung davon hatte, was ich tun musste. Mein Trainer war von der alten Schule, ich hatte vorher keinen anderen getroffen, der seine Athleten so konditionierte wie er. Als Hobby-Turnerin auf Level 1 bestand meine erste Trainingseinheit aus Sprints, sechzig Liegestützen, sechzig Rumpfbeugen, lächerlichen Klimmzug-Versuchen mit Ober- und Untergriff, Froschsprüngen, Relevés (wie eine Ballerina auf die Zehenspitzen stellen), ausgiebigem Dehnen und einer Einweisung in grundlegende Techniken. Ich wusste, dass ich eine unermüdliche Arbeitsmoral brauchte, wenn ich es jemals auf Wettkampfniveau schaffen wollte, und der Ablauf des ersten Trainings gab mir eine Vorlage, nach der ich arbeiten konnte.
An diesem Abend dehnte ich mich zwei Stunden lang und wiederholte das gesamte Konditionstraining. Es gab nicht viel, was ich zu Hause üben konnte, aber ich wollte so stark und gelenkig wie möglich werden, um meine knapp bemessene Zeit in der Turnhalle voll auszuschöpfen. Auch die darauffolgenden Abende dehnte und trainierte ich noch mindestens eine Stunde lang bis zur Schlafenszeit. Innerhalb von zwei Wochen beherrschte ich jeden Spagat perfekt und konnte die verlangten Konditionsübungen mit relativ korrekter Technik und Form ausführen. Es war nicht viel, aber es war ein Anfang.
Den ganzen Herbst, Winter, Frühling und Sommer lang übte ich in der kleinen Turnhalle im Einkaufszentrum und ergänzte mein Training zu Hause. Ich saß im Spagat, während ich meine Schularbeit erledigte, trainierte eine Stunde vor dem Schlafengehen und drehte Pirouetten auf unserem Küchenboden. Den größten Teil der naturwissenschaftlichen Literatur für die Schule las ich kopfüber, im halben Handstand an der Tür zum Wäschezimmer. Das Sofa nutzte ich häufiger, um Überspagat zu üben, als um darauf zu sitzen, und die rauen Holzbretter, mit denen neu gepflanzte Bäume in unserem Garten eingezäunt wurden, dienten mir als Schwebebalken.
Neun Monate nachdem ich zum ersten Mal die kleine Turnhalle betreten hatte, sage mein Trainer die Worte, auf die ich gewartet hatte: »Ich würde gerne darüber sprechen, dass Rachael dem Wettkampfteam beitritt.«
Für eine zwölfjährige Turnerin, die nicht »ins Profil passte«, konnte es nichts Besseres geben. Ich war nicht fürs Collegeturnen gemacht, geschweige denn für die Olympischen Spiele. Viele Trainer hätten mich links liegen lassen, aber meiner gab mir eine Chance. Endlich würde ich zu einem Mitglied von USA Gymnastics werden. Ich würde die Anstecknadel, den Mitgliedsausweis und einen echten Wettkampfanzug bekommen. Das war es, wofür ich so hart gearbeitet hatte, ich war begeistert.
»Was meinst du?«, fragte meine Mutter.
Wir waren beim Infotreffen gewesen, um zu erfahren, was es bedeuten würde, Teilnehmer des Wettkampfprogramms zu werden. Neben der Anzahl der Trainingstage und -stunden ging es vor allem um die finanziellen Anforderungen. Die Gebühren für die Turnhalle, die Wettkämpfe und die Kleidung sowie die »Nebenkosten« für Dinge wie Gelenkstützen und zusätzliche Trainingsanzüge waren zusammengenommen höher, als es sich meine Familie leisten konnte. Und meine Mutter hatte noch andere Bedenken. Sie wusste, dass zum einen Probleme mit dem eigenen Körperbild weit verbreitet waren und es zum anderen häufig Verletzungen gab. Aber ich wollte es. Ich wollte es unbedingt.
»Ich habe doch den Teilzeitjob als Babysitterin«, schlug ich vor. »Einen Teil von dem Geld brauche ich, um etwas zum Biologieunterricht beisteuern zu können. Aber der Rest könnte in meine Turngebühren fließen!«
Meine Mutter dachte eine Weile darüber nach, dann sagte sie: »Wir könnten fragen, ob es irgendwelche zusätzliche Arbeiten in der Turnhalle gibt, die wir übernehmen könnten, um die Gebühren zu reduzieren.«
Mein Puls beschleunigte sich. Ja! Es wird funktionieren!
»Aber was ist, wenn du dich verletzt?«, fragte sie dann und brachte mich wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. »Dein Vater und ich wollen, dass du das tun kannst, was dir Spaß macht. Aber nichts ist so wichtig wie deine Gesundheit und deine Sicherheit, mein Schatz. Wenn wir das durchziehen, musst du darauf gefasst sein, dass du dich so schlimm verletzen könntest, dass es unklug sein würde weiterzumachen.«
Meine Eltern scheuten sich nicht davor, auch schwierige Themen anzusprechen, also diskutierten wir an jenem Abend über alle Eventualitäten, bevor wir eine Entscheidung trafen. Wir sprachen über die Sicherheitsvorkehrungen, die wir treffen würden, um mich vor falschen Vorstellungen bezüglich meines Körperbildes zu bewahren, wie wir die Kommunikation offen gestalten würden, damit ich mit allen Bedenken zu meinen Eltern kommen könnte, wie ich mit dem Druck umgehen würde, einen »Turnerinnenkörper« zu erreichen und dem Wunsch, meinem Trainer gefallen zu wollen. Auch meine Bereitschaft, den Sport aufzugeben, wenn es in meinem besten körperlichen, geistigen oder emotionalen Interesse lag, kam zur Sprache, welche Grenzen es für die Trainer geben sollte, wenn sie mir Hilfestellung gaben oder mich dehnten, wie ich die Privatsphäre in der Umkleidekabine wahren würde und welche Arten von Themen ein Trainer nie mit mir als Sportlerin besprechen sollte. Wir sprachen über alles.
Am Ende entschieden wir, es zu versuchen, die Ermahnung meiner Mutter stets vor Augen: »Wenn dein Vater und ich irgendetwas sehen, das uns Anlass zur Sorge um deine Gesundheit oder Sicherheit gibt, bist du schneller raus, als du dir vorstellen kannst.« Sie wusste, dass es schwierig sein würde, mich von diesem Sport abzubringen. »Und ich bin bereit, wenn nötig deinen Zorn mir gegenüber zu riskieren, um dich zu schützen.«
Uns all dessen bewusst, unterschrieben wir den Papierkram, bezahlten die erste Rate der Gebühren und kauften meine ersten Zughilfen (ein spezieller Handschutz mit kleinem Holzstab in der Nähe der Fingerspitzen, mit deren Hilfe man sich besser am Stufenbarren festhalten kann – WIE SIE DIE OLYMPIATEILNEHMER TRAGEN! Ja, zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben dachte ich immer in Großbuchstaben an sie).
Um ehrlich zu sein, ich hatte große Angst, als ich zum ersten Mannschaftstraining ging. Die Turnhalle war erst kürzlich in eine ehemalige Autowerkstatt umgezogen und besaß nun eine Tumbling-Bahn in (fast) voller Länge, eine verlängerte Anlaufbahn für Sprünge, einen zweiten Stufenbarren und eine Mannschaftskabine. Diese letzte Besonderheit war eigentlich nur ein winziger Raum mit einer Wand voll hölzerner Ablagefächer, aber trotzdem war es die Mannschaftskabine.
Unser winziges Team bestand aus neun Mitgliedern, angefangen von aufstrebenden Athletinnen auf Level 5, wie mir, bis hin zu unserer einzigen Turnerin auf Level 9. Ich war fast die Älteste und mit Abstand die Schlechteste, eine Tatsache, die mich ziemlich unsicher machte.
Meine Nervosität ließ jedoch schnell nach, als die erfahreneren Mädchen mich durch das selbstständige Aufwärmen und die Stunde mit Konditionsübungen führten, mit der jedes dreistündige Training begann. Sie beantworteten alle Fragen, die eine brennende Perfektionistin mit der Angst, Fehler zu machen, beschäftigten, und erzählten freundlicherweise selbstironische Geschichten von ihren ersten Tagen in der Mannschaft. Daher fühlte ich mich nicht ganz so dumm, als sich meine Beine nach der ersten halben Stunde Muskeltraining in Wackelpudding verwandelten (obwohl das nichts war im Vergleich zu dem Muskelkater, den ich in den nächsten zwei Wochen haben sollte).
Nach und nach wurde das Mannschaftsleben zur Routine. Meine Hände waren von Blasen übersät, rissig und schwielig, auch dann noch, als meine Muskeln sich bereits an das intensive Konditionstraining gewöhnt hatten. Jeden Tag erledigte ich meine Schularbeit, ging babysitten und dann in die Turnhalle. Einmal die Woche – um einen Beitrag zu den Kosten meiner heiß begehrten Turnstunden zu leisten – half ich meiner Mutter, die ganze Einrichtung zu putzen.
Mit der Zeit fühlte ich mich immer mehr als Teil des eng geknüpften kleinen Teams, das meine Erwartungen übertraf. Es gab keine Ego-Kämpfe, keinen Wettstreit zwischen Turnerinnen, keine fiesen Bemerkungen und keinen Spott über diejenigen, die keinen absolut perfekten Rückwärtsüberschlag machen konnten (und ja, damit meine ich mich). Stattdessen halfen sich alle Mitglieder gegenseitig und boten einander freundliche Korrekturen oder Umarmungen an, wenn jemand entmutigt war. Wir freuten uns über die Erfolge der anderen, halfen uns gegenseitig weiter, und unser Trainer trug dazu dabei, das alles zu ermöglichen. Er war ein Mann der leisen Töne, sanftmütig, zurückhaltend und ruhig. Sein »Sehr gut …«, das mit einem allmählich schwächer werdenden osteuropäischen Akzent gesprochen wurde, war das höchste Kompliment, das wir für eine gelungene Übung bekommen konnten.
Die Turnhalle besaß keinen großen Schnickschnack, und es gefiel mir so. Wir machten das Beste aus dem, was wir hatten, auch wenn das im Winter hieß, bei unserer Ankunft einen Eiszapfen am Wasserhahn vorzufinden, weil die Heizung nur dann eingeschaltet war, wenn wir trainierten. Wir wuchsen enger zusammen, wenn wir »Mir ist so kalt, ich erfriere!« kreischten, und zitternd in die Umkleidekabine liefen, bis die Heizung in Gang kam. Dann stellten wir die wildesten Spekulationen darüber an, was wohl passieren würde, wenn auch das Wasser in der Toilette einmal gefrieren sollte. Glücklicherweise wurde die kleine Halle schnell warm. Innerhalb von wenigen Minuten schmolz das Eis, wir zogen unsere Jogginghosen aus und das Training begann. Im Sommer hatten wir das gegenteilige Problem – den Luxus einer Klimaanlage gab es nicht. Zu unserem Glück hatten wir dafür Garagentore, die sich vollständig öffnen ließen, sodass im vorderen Teil der Halle eine leichte Brise wehte. Aber wenn neun Turnerinnen drei Stunden lang bei über dreißig Grad trainierten, Brise hin oder her, konnte man die Luft in der Umkleidekabine schneiden.
Fast täglich wurden wir von unserem Trainer ermahnt, gut zu essen und viel zu trinken, etwas, von dem ich heute weiß, dass es nur wenige Trainer tun. Die anderen Mädchen tranken Gatorade, aber ich bevorzugte – zur Entrüstung aller anderen – V8-Eistee für einen schnellen Kalorienkick während des Trainings. Unterm Strich kam das Leben in einen festen Rhythmus, und es war gut.
Um am Ende des Sommers unseren Fortschritt zu beurteilen, ließ uns unser Trainer eine Reihe von Konditions- und Dehntests durchführen. Dazu gehörte das Seilklettern – eine Herausforderung, bei der eine Turnerin ihre Beine in perfekter L-Form ausstreckt und ein bodenlanges Seil nur mit der Kraft ihrer Arme hoch- und herunterklettert, ohne zwischendurch den Boden zu berühren.
»Komm schon, du bist fast da! Du schaffst es!«, riefen wir, als eine unserer Teamkolleginnen zum dritten Mal in Folge nur mit den Händen das Seil erklomm. Sie keuchte, pausierte und streckte immer wieder ihre schmerzenden Arme aus. Endlich schaffte sie es auch dieses Mal wieder bis nach oben und schlug gegen den Metallbalken, an dem das Seil hing. Das metallische Geräusch hallte bis zu uns herunter und signalisierte ihren Erfolg.
Auf ihrem Weg nach unten rief mein Trainer mit ruhiger Stimme: »Vorsichtig, vorsichtig.« Dann, mit einem leicht warnenden Unterton: »Pass auf deine Hände auf!«
Nachdem sie ohne Seilbrand unten angekommen war, rief er freudig aus: »Wo kam das denn her?« Er deutete auf ihre drahtigen Arme und drückte gestikulierend seine Überraschung darüber aus, dass ihr winziger Körper die Kletterübung so gut gemeistert hatte.
»Sie fühlen sich wie Wackelpudding an«, keuchte sie zurück.
Er nahm ihre Handgelenke und schüttelte sanft die Erschöpfung aus ihren Armen.
»Meine auch! Meine auch!«, fiel eine andere Teamkollegin ein und streckte ihre Arme aus. Er lachte und schüttelte bereitwillig auch ihre Arme.
Ich wusste nicht, wie ungewöhnlich das war, bis zwei Wochen später eine Gastturnerin aus einem anderen Verein mit uns trainierte. Sie war jung, etwa elf Jahre alt. Wir übten Tumbling (eine Reihe von Überschlägen, Flickflacks, Salti und Schrauben), wobei je eine Hälfte unseres Teams in zwei verschiedenen Ecken der Halle stand. Meine Partnerin und ich waren bereits an der Reihe gewesen und warteten, bis das restliche Team wieder auf der anderen Seite angekommen war. Als die neue Turnerin sich für den Anlauf bereitmachte, hielten wir den Atem an. Sie hatte Bandagen an beiden Handgelenken und am Knie, wir wussten, dass sie auch gegen Schmerzen im Rücken und an den Kniesehnen ankämpfte. Ihre Mutter hatte es dem Trainer gegenüber erwähnt, bevor wir begannen, und beharrt: »Sie ist es gewohnt, sich durchzukämpfen.«
Die Kleine lief los und warf sich mit unglaublicher Anstrengung in einen Salto mit einer ganzen Schraube. Meine Partnerin und ich schnappten nach Luft.
»Sie wird sich ernsthaft verletzen«, flüsterte meine Teamkollegin mir zu. »Das ist nicht in Ordnung.«
Und das war es auch nicht.
Die Gastturnerin sprang gefährlich tief, was dazu führte, dass sie bei jeder Landung hart auf die Matte aufsetzte. Ihre Knöchel und Knie waren überstreckt, um den Aufprall abzufangen, der durch den falschen Winkel viel zu heftig war. Schlimmer noch, ihr Kopf war viel zu nah am Boden.
»Sie könnte sich das Genick brechen«, sagte meine Partnerin kopfschüttelnd.
Sogar ich konnte sehen, dass ihr Salto nicht annähernd straff genug war, um eine Schraube zu üben, wenn sie gesund gewesen wäre. Geschweige denn in verletztem Zustand.
»Wer lässt sie so trainieren?«, fragte ich ungläubig. »Sehen die nicht, wie gefährlich das für sie ist?«
»Sie ist eins von Johns Mädchen«, antwortete meine Kameradin resigniert.
»Oh.«
Wir wussten beide, was das bedeutete.
»Eins von Johns Mädchen« bedeutete, dass sie eine Athletin bei Twistars war, einem der bekanntesten Turnvereine in unserem Bundesstaat. Der Leiter dieses Vereins war John Geddert, und in der Turnerwelt eilte ihm sein Ruf voraus. Seine Mädchen verletzten sich oft, meistens schwer. Fast alle von ihnen, sogar die Anfängerinnen, wurden von Problemen am Rücken, an den Knien und an den Kniesehnen geplagt. Teamkolleginnen und Eltern, die schon seit Jahren in der Welt des Kunstturnens waren, sagten, dass er seine Turnerinnen dazu drängte, Übungen zu machen, für die sie noch nicht bereit oder nicht stabil genug waren, was häufig zu noch schlimmeren Verletzungen führte. Er schrie, er schimpfte, manche Mädchen und Eltern in unserem Verein hatten gesehen, wie er mit Dingen warf, und es wurde gemunkelt, dass dazu auch manchmal seine eigenen Turnerinnen gehörten. Dieses Verhalten trat nicht nur während des Trainings auf – er tat es auch bei Wettkämpfen, direkt vor den Augen der Eltern, der anderen Trainer und der Richter von USAG.
Aber niemand stoppte ihn.
Weil John gute Ergebnisse erzielte.
Johns Turnerinnen waren nur ein Mittel zum Zweck. Wenn eine Athletin verletzt war, war eine andere bereit, ihren Platz einzunehmen. Nach einem Wettkampf gingen wir einmal als Team zusammen aus und sprachen dabei ernüchtert darüber, wie sehr Johns Mädchen sich fürchteten zu essen, sogar nach einem Wettkampf. Ein paar aus meinem Team, die schon mit einigen von Johns Spitzenturnerinnen unterwegs gewesen waren, erzählten im Flüsterton, dass diese Mädchen oft nur ein paar Salatblätter auf dem Teller hatten, obwohl sie den ganzen Tag in Wettkämpfen angetreten waren. Sie wussten alle, dass sie beim nächsten Training gewogen werden würden, und auch, dass John sie immer beobachtete. 2
Wenn diese Gastturnerin eine von Johns Athletinnen war, gab es nichts, was wir oder unser Trainer für sie tun konnten.
In jenem Jahr las ich das Buch Little Girls in Pretty Boxes von Joan Ryan, einer Sportredakteurin der San Francisco Chronicle. Es war eine verurteilende Anklage gegen die Welt des Wettkampfturnens und Eiskunstlaufs, die den physischen, emotionalen und sogar sexuellen Missbrauch offenlegte, den die Autorin beinahe als ein Kennzeichen dieser Sportarten ansah. Sie argumentierte, dass kleine Mädchen in diesem Sport nicht mehr wert waren als die Medaillen, die sie gewinnen konnten, sodass sie ausgehungert, misshandelt und benutzt wurden, damit ihre Körper und Fähigkeiten perfekt blieben – wie »schöne Schachteln«. Das war es, was das Publikum sehen wollte.
Mit jedem Kapitel, das ich las, spürte ich mehr einen Krieg in meinem Innern toben. Ich wusste, dass einige der Charakterisierungen von Trainern in diesem Sport wahr waren, weil ich selbst schon solche erlebt hatte. Doch als ich am Ende des Buches angelangt war, klappte ich es zu, setzte mich auf den kratzigen Berberteppich in unserem Keller und schüttelte den Kopf. Ich hatte ein ungutes Bauchgefühl und meine Gedanken überschlugen sich.
Das kann nicht wahr sein, dachte ich. Es kann nicht alles wahr sein. Die Autorin muss übertrieben haben. Sie muss die schlimmsten Beispiele herausgepickt und all die guten ausgelassen haben. Obwohl ich den Gedanken, ob die Realität wirklich so hässlich sein konnte, bewusst von mir wies, verspürte ich weiterhin ein nagendes Gefühl in der Magengrube. Immer wieder drehte ich das Buch in meinen Händen um.
Nichts, was sie sagt, ist ein Geheimnis, dachte ich. Wenn sie die Wahrheit sagt, sind die Beweise offensichtlich und nicht schwer zu finden. Sie hat sie gefunden. Wenn sie die Wahrheit sagt, weiß jeder bei USAG, dass diese Dinge passieren.
Ich atmete tief durch und schüttelte wieder und wieder den Kopf, als wollte ich meine Zweifel und Bedenken abschütteln. »Es kann nicht wahr sein«, wiederholte ich laut. »Denn wenn es wahr und wirklich so schlimm wäre, dann wüssten es alle. Und wenn sie es wüssten, würden sie es stoppen, oder? Ganz sicher glaubt niemand wirklich, dass Medaillen mehr wert sind als kleine Mädchen.«
Ich wiederholte es immer wieder und tröstete mich mit diesem Gedanken. Es kann nicht wahr sein, denn wenn es wahr wäre, würde es jemand stoppen. Jemand würde für diese Mädchen eintreten.
Jemand würde es stoppen.
Jemand würde es stoppen.
Oder?