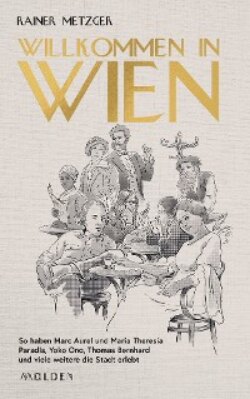Читать книгу Willkommen in Wien - Rainer Metzger - Страница 6
ОглавлениеDER SCHÖNE LEICH
WALTHER VON DER VOGELWEIDE
Ich saz ûf einem steine, dô dáhte ich bein mit beine, dar ûf sazte ích mîn ellenbogen …“: Das ist die vielleicht berühmteste Zeile von Meister Walther, der seine Herkunft mit einer nicht weiter lokalisierbaren Vogelweide verbindet. Die Zeile ist nicht so berühmt wie ihr Dichter, dessen Name sich so geländegängig gibt wie das Mittelhochdeutsch seiner Lyrik unwegsam. Wie er da auf einem Stein sitzt, die Beine übereinandergeschlagen, den Kopf auf den Arm gestützt, ist er dargestellt worden, als es für die Große Heidelberger Liederhandschrift, zusammengestellt um 1330 und damit ein Jahrhundert nach seinem Tod, darum ging, ein Autorenbild von ihm zu gestalten. Der Codex Manesse, so der landläufige Begriff für die Anthologie des Minnesangs deutscher Zunge, liefert die ergiebigste Quelle für Walthers Lieder und Sprüche: 138 Liedermacher listet sie auf, Walther ist mit fast 450 Einträgen der produktivste.
Die Zeile, in der Walther sitzend vor sich hin sinniert, ist in Wien zustande gekommen – womöglich in Wien, denn vieles aus dem Mittelalter muss Spekulation bleiben. Mit Walthers Sitzgelegenheit beginnen gleichsam als Einstieg die drei Strophen des Reichstons, in dem sich der Dichter mit dem Zustand der Welt ganz im Allgemeinen auseinandersetzt. Ton nennt man derlei Zusammenstellungen von dichterischen Sentenzen, womit der Bezug zur Musik hinlänglich erfasst ist. Wort und wise gehören zusammen, ihre Bedeutung erschließt sich allein im Vortrag, im Auftritt, in der Performance. Wenn es für die kulturellen Hervorbringungen Wiens charakteristisch ist, dass der Verfasser oder Komponist stets auch der Interpret und der bevorzugte Ort seiner Präsentation die Bühne ist, hätte sie in Walther schon einmal einen Präzedenzfall. Der Reichston ist um das Jahr 1198 entstanden. Das lässt sich aus den Bemerkungen erschließen, in denen die beiden weltpolitischen Gegenspieler Kaiser und Papst von Walther in Stellung gebracht werden. Letzterer, der eben 1198 ins Amt gekommene Innozenz III., „ist ze jung“, schreibt er. Der Kandidat für den vakanten Kaiserthron, der Staufer Philipp von Schwaben, hingegen wird aufgefordert, sich endlich zu positionieren: In eben diesem Jahr wird er zumindest römisch-deutscher König. An Selbstbewusstsein, den beiden Autoritäten schlechthin in die Parade zu fahren, mangelt es dem Dichter jedenfalls nicht.
Walther bringt sich auch selbst in Stellung. In Wien, gewissermaßen eine Etage tiefer, hatte ein neuer Herzog das Regierungsgeschäft übernommen. Leopold VI. aus dem Geschlecht der Babenberger residierte, seit sein Großvater Heinrich, dem die Historie den schönen Beinamen Jasomirgott mitgegeben hat, den Herrschersitz 1145 von Klosterneuburg nach Wien verlegt hatte, am Hof – jener Adresse, die es heute noch gibt. Und auch Walther wird in dieser Umgebung zu finden sein. Hier wohl hat er sein künstlerisches Handwerk in Angriff genommen: „Zu Oesterrîche lernde ich singen unde sagen.“ Bei Leopolds Vater, gleichen Namens und mit einer V. nummeriert, der geschichtsmächtigen Gestalt, die im Dezember 1192 Richard Löwenherz gefangen nehmen ließ. Mit dem Lösegeld, das die Engländer für ihren König zahlten, wurde der Ausbau der Residenz und die Errichtung einer neuen Stadtmauer finanziert. Wohl um diese Zeit begann Walther mit seiner Arbeit als Liedermacher in Wien. Eine erste Blütezeit erlebte er unter Herzog Friedrich I., der ab 1194 amtierte und 1198 auf dem Rückweg von einem Kreuzzug starb. Sein Bruder und Nachfolger Leopold VI. war offenbar nicht mehr so sangesaffin – in einer Strophenfolge, die sehr zu Recht unter Unmutston firmiert, lässt Herr Walther das durchklingen: „ich hân wol und hovelîchen her gesungen, mit der hövescheit bin ích nû verdrungen.“ Auf gut höfische Weise hatte er bisher gesungen. Nun wird er mit seiner höfischen Art zurückgedrängt. Walther sucht also den Absprung von diesem Hof.
„Saget mir ieman, waz ist minne?“: Dieser Frage, was Minne sei, nachzugehen, ist, könnte man sagen, die Hauptaufgabe eines Höflings. Man kann es dichterisch lösen, aber auch durch den Dienst an der Dame, der man mit höfischem, höflichem, courtoisem Benehmen die Ehre erweist. Walther hatte es offenbar am Wiener Hof zu einigem Renommee gebracht. Und wie es sich für einen Künstler gehört, hatte er ein paar Neuerungen eingeführt und sich in Provokation, Überschreitung, Ungebührlichkeit geübt. Reinmar, der nicht von ungefähr den Beinamen der Alte bekommen hat, durfte bis dahin den Ton angeben; er hatte der Hohen Minne gehuldigt, einer selbstlos-keuschen und eher unkörperlichen Tugendhaftigkeit im Angesicht der Angebeteten. Walther brachte nun eine andere Realität ins Spiel und mit ihr Lieder, die etwa davon handeln, „dô ich si nacket sach“. Womöglich entsprang eine solche Avantgarde einem gleichsam zeitlosen künstlerischen Kalkül mit der Andersheit. Vielleicht steht Walthers gewisse Wildheit auch in Zusammenhang mit einer Herkunft weit diesseits der Aristokratie. Aufsteiger, der er war, wusste er um seine prekäre Existenz. Sätze wie jene aus seinem Preislied (das bekannt und vor allem berüchtigt ist durch die Anrufung von „deutschen Frauen“ und „deutschen Männern“, was natürlich gewissen Regimes sehr zupass kam) wären dann durchaus typisch, wenn sie – in Übersetzung – lauten: „Fällt mein Lohn gut aus, erzähle ich euch unter Umständen etwas, das euch gefallen wird.“
„Wes Brot ich ess, des Lied ich sing“, gilt ganz buchstäblich für Walther. Man findet ihn im Lauf seines Lebens bei diversen Brotgebern, beim Staufer Philipp genauso wie bei dessen Widersacher, dem Welfen Otto. Der Landgraf Hermann von Thüringen und der Erzbischof Engelbert von Köln lassen sich von ihm besingen und immer wieder preist er die Babenbergerherrschaft in Wien, der Walther eine spezielle Verbundenheit bezeugt. Aktenkundig ist sie vor allem im ein gutes Dutzend Strophen umfassenden Wiener Hofton, jenen Bitten, Klagen, Drohungen bis zur Apokalypse versammelnden Atemlosigkeiten, in denen einer nicht immer höflich bleibt. Wie weit derlei wirklich Expression ist und was Strategie, ist natürlich Interpretationssache.
Walther von der Vogelweide als Kronzeuge der jungen Republik: Doppelschilling aus dem Jahr 1930. Der Entwurf zur Darstellung Walthers stammt von Eddy Smith.
Im Jahr 1203 befand sich Walther in der Entourage des Passauer Bischofs Wolfger von Erla. In diesem Zusammenhang hat sich das einzige authentische Zeugnis überliefert, ein zeitgenössisches Dokument, das von der Existenz des Dichters nicht erst nachträglich berichtet. Darin ist, wie so oft bei Geschichtsquellen, von schnöder Ökonomie die Rede. Am 12. November des Jahres seien an Walther, so heißt es hier auf Lateinisch, aus den Ressourcen des Bischofs „150 Silberpfennige“ gegangen, damit er sich einen „Pelzmantel“ kaufe. Die Transaktion fand in Zeiselmauer statt, 30 Kilometer westlich von Wien an der Donau gelegen und damit die einschlägige Topografie abzirkelnd. Das ist alles. Man weiß, dass das Gefolge des Bischofs nach Schwadorf bei Schwechat weiter- und damit an Wien vorbeizog. Ob Walther an jenem trüben Novembertag seinen Sehnsuchtsort betrat, bleibt im Dunkeln. Man kann das Dokument so lesen, dass es auf die Hochzeit Leopolds VI. mit der byzantinischen Prinzessin Theodora (mit der er handelsüblich auch verwandt war) Bezug nimmt: Walther wäre bei den Feierlichkeiten dann so etwas wie ein Top Act gewesen. Man kann es auch viel banaler nehmen und feststellen, dass Walther als niedere Charge im Begleittross die Stadt nur von außen sah, während sein Herr natürlich beim Herzog zu Gast war.
So übt sich die Berühmtheit im Spagat zwischen dichterischem Höhenflug und den Abgründen der Lebenserhaltung. Er hat die deutschsprachige Literatur mitbegründet mit einer Lyrik zwischen dem Subtilen und dem Sublimen, und zwischen Einfühlung und Ironie ließ er kein Auge trocken. Er ist der Herold einer Textgattung, die zwischen Gebet, Hymnus und Konfession changiert und in hochkomplexer Zusammenstellung Vers- und Reimformen kombiniert; Leich nennt man diese Versdichtungen, der Manesse-Codex beginnt die Walther-Passage damit. Got, dîner trinitate, so der Titel, ist vielleicht in Wien entstanden, das Wortspiel mit dem schönen Leich darf man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Walther ist sich zugleich nicht zu schade, ständig in Gelddingen unterwegs zu sein. Er unternimmt es, in höchsten Tönen von Leopold VI. zu schwärmen, als der sich anlässlich seiner Schwertleite, der Zeremonie seiner Waffenfähigkeit im Jahr 1200, sehr spendabel zeigt: „als wir ze Wiene dur êre haben empfangen“.
Jammern gehört zum Geschäft und da begründet Walther nicht weniger als einen Berufsstand. Im Jahr 1907 publiziert Hermann Bahr, Chronist und Impresario Wiens um 1900, ein Bändchen zu seiner Stadt, das im Rahmen einer Reihe von Tourismusführern namens Städte und Landschaften im Stuttgarter Carl Krabbe Verlag erscheint. Bahr geht seinen Baedeker chronologisch an und er kommt bei Walther gleich zur Sache: „Dieser Wiener ist der größte Dichter, den die Deutschen neben Goethe haben.“ Und sogleich folgt das Lamento: „Aber er ist in Wien vergessen.“ Damit ist der Ton gesetzt, den Bahr im Laufe seiner Ausführungen nicht vergisst, auf sich selbst, der er doch auch ein Dichter ist, und auf seinesgleichen anzustimmen: „Dem Leben entrissen, an der Wurzel abgeschnitten, verdorrte er.“ Verkannt, verbannt, missachtet ist er, der Genius, das wusste seinerzeit schon Walther. Doch er war in der Lage, das unvergleichlich schöner, mit feinem Spott auf sich und die Welt, nach außen zu tragen: „Wie möht ein wunder groezer sin? Es regent beidenthalben mîn, daz mîr des alles niht enwirt ein tropfe!“ Was für ein Wunder: Links und rechts von ihm regnet es, ihn selber aber trifft kein einziger Tropfen! Der arme Poet.
Die Geschichte hat übrigens ein Happy End. Sie hat nichts mit Wien zu tun, sei aber in Walthers Worten nachgeliefert: „Ich hân mîn lêhen, al die werlt, ich hân mîn lêhen“, geht sein Jubel, als ihm etwa um das Jahr 1220 Kaiser Friedrich II. eine Liegenschaft, ein Lehen, zukommen lässt, die ihn unter die Grundbesitzer und damit in die bessere Gesellschaft stellt. Das Stück Land wird in der Nähe Würzburgs verortet, dort, wo er – angeblich – begraben liegt. Friedrich jedenfalls, die mittelalterliche Weltberühmtheit, von den Zeitgenossen schon als Stupor Mundi, als Staunen der Welt beraunt, macht es besser als sein Vasall „ze Oesterrîche“. Natürlich ist auch Friedrich zuvor angeschmachtet worden, „dass man mich bei reicher Kunst so arm sein lässt“. „Daz man bî rîcher kunst mich lât álsus armen“: Walther verwendet in seinem Bettelgesang das Wort „kunst“ für seine Kunst. Es ist vielleicht das allerfrüheste Beispiel für den Gebrauch dieses Begriffs. Walther war eben ein Neuerer.
Verkannt, verbannt, missachtet ist er, der Genius, das wusste seinerzeit schon Walther. Doch er war in der Lage, das unvergleichlich schöner, mit feinem Spott auf sich und die Welt, nach außen zu tragen: „Wie möht ein wunder groezer sin? Es regent beidenthalben mîn, daz mîr des alles niht entwirt ein tropfe!“ Was für ein Wunder: Links und rechts von ihm regnet es, ihn selber aber trifft kein einziger Tropfen! Der arme Poet.
ENTDECKEN
Ein letzter noch sichtbarer Rest der Babenbergerresidenz, wo wohl auch Walther wohnte, befindet sich im Kellergeschoss des Collalto-Palais, Am Hof 13, 1010 Wien.