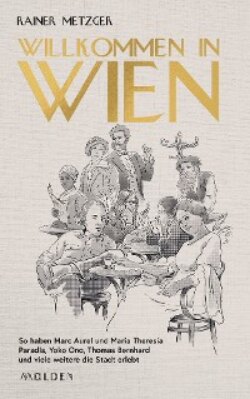Читать книгу Willkommen in Wien - Rainer Metzger - Страница 8
ОглавлениеKOLLEGIEN UND KOLLEGEN
KONRAD CELTIS
Im Jahr 1493 ging Wien erstmals in Druck. Die Stadtansicht, die der Nürnberger Künstler Michael Wolgemut für ein sensationelles Kompendium schuf, das als Schedelsche Weltchronik Kulturgeschichte geschrieben hat, ist weitaus weniger plausibel als jene gemalte des Schottenmeisters ein Vierteljahrhundert davor. Doch ging sie durch viele Hände, mehr als 1.500 Exemplare der zunächst auf Lateinisch, dann gleich auch auf Deutsch publizierten Enzyklopädie sind heute noch erhalten. Wien wird von einem Terrain aus, das heute der zweite Bezirk ist, in Augenschein genommen: Man sieht die flussseitigen Mauern mit dem Roten Turm, man erkennt mit einiger Mühe Maria am Gestade und den Turm von Sankt Stephan, der weniger gotisch als pagodisch, eben wie eine Pagode, aussieht. Die Silhouette der Stadt ist eher grobschlächtig erfasst. Immerhin aber folgt das Bild dem Text, der ein „Vienna Pannonie“ in Aussicht stellt. Das ist nicht immer so, die Darstellung von Paris zum Beispiel ist die linke Hälfte jenes Druckstocks, der vorgibt, Magdeburg zu zeigen – und das, obwohl Anton Koberger, der Drucker und Verleger, eine Niederlassung an der Seine hatte.
Der Liber Chronicarum ist ein Nürnberger Unternehmen. Hartmann Schedel, der Verfasser, kam ebenso von dort wie Koberger, der Taufpate Albrecht Dürers, und wie Wolgemut, dessen Lehrer, sowie die beiden Financiers Sebastian Kammermeier und Sebald Schreyer. Bald war man unzufrieden mit der Publikation – angesichts der Nachlässigkeiten kein Wunder. Die Chronik sollte überarbeitet werden und Schreyer wandte sich an eine damalige Weltberühmtheit, die auch noch sein Freund war. Die Redaktion sollte Konrad (auch „Conrad“) Celtis übernehmen, 1459 im fränkischen Wipfeld in eine Winzerfamilie hineingeboren, ein wundersames Exemplar von Aufsteiger, der es allein über seine Intelligenz zu Universitätskarriere und gar zum ersten nichtitalienischen Poeta laureatus gebracht hatte – zum vom Kaiser, es war Friedrich III., höchsteigen mit Lorbeer dekorierten Haupt- und Staatsdichter. Seit 1487 war Celtis, der eigentlich Bickel hieß, aber seinen Nachnamen branchenüblich latinisierte, gekrönt, in aller Unbescheidenheit rechnete er fortan die Weltzeit vom Datum seiner Auszeichnung her. Celtis versagte sich dem Nürnberger Projekt. Zur Kehrseite der Parvenü-Psyche zählte eine notorische Säumigkeit, ein Zögern und Zaudern, das sich auch in seiner eigenen dichterischen Arbeit niederschlug. Nicht nur Sebald Schreyer saß ihm diesbezüglich im Nacken: „Hier werde ich nicht aufhören Dir lästig zu fallen“, schrieb er Celtis gleichsam nachholend im Jahr 1500. „Du läßt Dich nämlich durch Übellaunigkeit, Trägheit, Hochmut oder irgend einen anderen Irrsinn dazu bestimmen, Deine … Werke … in der Schublade zu lassen.“
Schreyers Brief ging nach Wien, wo Celtis seit 1497 Professor für Poetik und Rhetorik war. Das Prozedere seiner Berufung ist so typisch für die Stadt wie offensichtlich unabdingbar. Es ging erstens nur über Protektion, seine Fürsprecher waren zwei Räte des neuen Königs Maximilian, der 1508 auch Kaiser wurde. Zweitens gab es einen Konkurrenten, den Celtis nach allen Regeln seiner Kunst schlecht machte und das auch noch mit gelinde gesagt chauvinistischen Mitteln: In einem Epigramm und also immerhin in Hexametern (kombiniert mit Pentametern) versucht er seinen Mitbewerber namens Bernhard Perger als „perfide slave“ zu schmähen, was sich auf Deutsch genauso liest wie im von Celtis gepflegten Latein. Der ortsansässigen Mentalität gemäß hat er den Tschuschen aus dem Weg geräumt. In arte humanitatis sollte er fortan unterrichten, doch ausschließlich menschenfreundlich mag es nicht zugegangen sein.
Letztlich sollte es auch weniger um Humanität als um Humanismus gehen. Es fand im akademischen Betrieb seinerzeit statt, was man heute einen Paradigmenwechsel nennen würde: Statt Scholastik sollte Antike auf dem Plan stehen, statt Bibelinterpretation die Lektüre der römischen Klassiker, die man oftmals erst ausfindig machte, irgendwo in Klosterbibliotheken, wo sie in Folianten versteckt waren, meist im Verbund mit christlichen Erbaulichkeiten. Neben der Religion galt der Fokus nun dem Menschen, ihm und einer Natur, die man sich göttlich beseelt und den Geschöpfen verfügbar zugleich dachte. In Wien schrieb Celtis sein Hauptwerk, 1502, Schreyer wird es glücklich entgegengenommen haben, in Nürnberg veröffentlicht. Die Quattuor libri amorum, kurz Amores, sind Liebeselegien in der Tradition der Alten, aber auch eine Kosmografie nach neuzeitlicher Fasson, und alles hängt mit allem zusammen: Die vier Bücher der amourösen Dichtung sind jeweils einer Frau gewidmet, lassen dabei aber die vier Jahreszeiten, Himmelsrichtungen, Temperamente, Elemente, die vier Lebensabschnitte mit ihren vier Eigenschaften und alles, was es sonst noch im Quartett gibt, Revue passieren. Alle Dinge sind von Gott gefügt, aber sie kreisen um den Menschen wie die Planeten um die Erde. Dieses neue, auch bald schon wieder veraltete Wissen galt es nun in die Welt zu tragen, die traditionellen vier Fakultäten – Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie – anzureichern mit den freien Künsten, wie sie die Antike gekannt hatte Nicht zuletzt dank Celtis gewann die Universität Wien ein gutes Jahrhundert nach ihrer Gründung 1365 Weltruf und entfaltete ihre Sogwirkung auf Kollegen- wie Studentenschaft. Um 1500 war sie die größte im Reich.
Haupt- und Staatsdichter Konrad Celtis und Albrecht Dürer (Bildmitte) als Beobachter eines grausamen Blutbads: die Marter der zehntausend Christen. Öl auf Holz, Kunsthistorisches Museum Wien, 1508.
Celtis ist auch eine Art Gründungsdirektor des Collegium poetarum et mathe-maticorum, das im Jahr 1501 von Maximilian gestiftet worden ist. Es bestand aus vier Lehrstühlen, zwei aus den literarischen Disziplinen Poetik und Rhetorik sowie zwei aus der Mathematik – theoretische wie angewandte. Maximilian, der Herrscher, baute an seinem neuzeitlichen Staat, wollte fähige Beamte und auch Rhapsoden, die an seinem „Gedechtnus“, wie er es nannte, seinem Nachruhm also arbeiteten. Das Wiener Kolleg sollte dafür sorgen, mit Celtis als Hofpoeten.
In eben dem Jahr 1501 war er diesbezüglich schon tätig gewesen, als man in Linz vor Maximilian und seinem Gefolge (zu dem die Familie seiner Frau, die Herzöge von Mailand, gehörte), seinen Ludus Dianae zum Besten gab, ein Singspiel, in dem reihum die Götter auftreten, um dem Monarchen zu huldigen. Celtis bringt dabei die hübsche Idee unter, Vienna komme von Vindobona und das wiederum von „Vinum bonum“ – der Wein wird dann schon gut gewesen sein. Heute noch zu bestaunen ist übrigens die Unterkunft von Celtis’ Humanistenkränzchen – es ist der Neuberger Hof in der Grünangergasse 1, seinerzeit im Besitz des Zisterzienserklosters Neuberg an der Mürz, von dessen Abt Celtis selbst die Räume mietete und offenbar auch die Kosten übernahm. Wer jetzt die Galerie nächst St. Stephan besucht, betritt das Gebäude. Hier schrieb Celtis 1508 dann auch sein Testament.
Er wurde nicht alt. Die Amores, die er besang, hielten ihn, wie es scheint, seinerseits in Aufruhr und manches, das er beschreibt, wirkt autobiografisch. Mit einem „infideliter se ad amorem natum“ setzen die Verse, es sind Distichen, ein: Unglücklicherweise sei er zur Liebe hin geboren, um dann den Sternen, wie sie an jenem 2. Februar 1459 über Mainfranken prangten, die Schuld zu geben, dass er keine Frau findet – aber dafür Frauen im Plural, denen er dann auch hingebungsvoll huldigt. Im Jahr 1498 erscheint in Wien von der Hand des Physikus und späteren Dekans der Medizinischen Fakultät Bartholomäus Steber ein Traktat über die Malafranzos, die französische Krankheit. Die Syphilis hatte sich breitgemacht und Celtis ist eines der frühesten unter ihren prominenten Opfern (das berühmteste ist wohl das Jahrhundertgenie Raffael). Bereits um 1496 hatte er damit zu kämpfen, sein Tod mit nicht einmal 50 Jahren ist darauf zurückzuführen.
Celtis und die Frauen: Seine humanistische Detektivarbeit in den Klöstern ermöglichte eine Wiederentdeckung, die, eine ziemliche Einmaligkeit, eine Autorin, betraf. Hrotsvit von Gandersheim, eine Nonne, die im 10. Jahrhundert tätig war. Ihre Ambitionen waren zwar auf die Kirche beschränkt, in ihrer Art war sie jedoch auch Vorgängerin der Renaissancedichtung, denn sie bezog sich in ihren Werken auf die Antike, speziell auf den Komödienschreiber Terenz, und sie schrieb in Latein, der Lingua franca der Gebildeten. Mit zwei Holzschnitten von Dürer ausgestattet, übergab Celtis die Schriften der Hrotsvit dem Druck. Die Handschrift hatte er aus dem Kloster Sankt Emmeram bei Regensburg mitgenommen, hatte ungeniert Kommentare auf dem Pergament hinterlassen und das Unikat auf der Suche nach dem besten Verleger durch halb Europa geschickt. Auch das gehört zum Humanismus: in aller Nonchalance oder gleich Barbarei alles mitgehen zu lassen, in der überheblichen Vorstellung, die Zimelien seien bei einem selbst besser aufgehoben als unter den Verstaubtheiten der Kirche.
Heute noch zu bestaunen ist übrigens die Unterkunft von Celtis’ Humanistenkränzchen – es ist der Neuberger Hof in der Grünangergasse 1, seinerzeit im Besitz des Zisterzienserklosters Neuberg an der Mürz, von dessen Abt Celtis selbst die Räume mietete und offenbar auch die Kosten übernahm.
Noch etwas hatte sich Celtis unter den Nagel gerissen, heute eine der größten Kostbarkeiten im mit derlei Schätzen reichlich gesegneten Wien: Die Tabula Peutingeriana ist die einzige Straßenkarte, die uns aus der Römerzeit bekannt ist. Das Exemplar selbst, das in der Österreichischen Nationalbibliothek aufbewahrt ist, stammt aus dem Mittelalter, ist wohl die Abschrift einer Abschrift, doch was sie zeigt, ist antik. Angelegt als Rotulus, 675 auf 34 Zentimeter messend und mithin lesbar, indem man sie von einem Rand zum anderen aufrollt, zeigt sie das spät-römische Straßennetz von Britannien bis nach Indien. Stark verzerrt stellt sie dar, wie die Städte zueinander positioniert sind und wie viele Tagesreisen sie trennen. Geografische Exaktheit ist nicht vorgesehen, Vindobona zum Beispiel ist gleich neben Carnuntum eingetragen – aber auch, legte man Himmelsrichtungen an, weit südlich etwa des friulanischen Aquileia. Wo Celtis der Pretiose habhaft wurde, weiß man nicht. Er übergab sie, vielleicht weil er den Tod nahen sah, seinem Augsburger Kollegen Konrad Peutinger, damit der sie publiziere.
Die Karte ist eher zufällig in Wien, sie kam im 18. Jahrhundert hierher. Auch eher zufällig im Kunsthistorischen Museum präsentiert sich das vielleicht bekannteste Zeugnis von Celtis, ins Werk gesetzt parallel zu dessen Tod. Zusammen mit Dürer steht er inmitten eines Gemetzels, das die legendäre Marter der Zehntausend darstellt. En gros werden auf Dürers Gemälde christliche Bekenner herbeibuchstabiert, minutiös vorgeführt in ihren vielerlei Martyrien. Doch da gibt es noch die beiden Zeitgenossen des Jahres 1508, aus dem Bild blickend, in der zeitlos achselzuckenden Geste eines Was-will-man-machen. Die ewige Zuständigkeit des Kulturarbeiters: Beschreiben – und daran leiden.
ENTDECKEN
Eine Kopie des Grabsteins von Konrad Celtis befindet sich an der Ostseite des Nordturms des Stephansdoms.
Stephansdom
Stephansplatz 3
1010 Wien
Neuberger Hof
Grünangergasse 1
1010 Wien