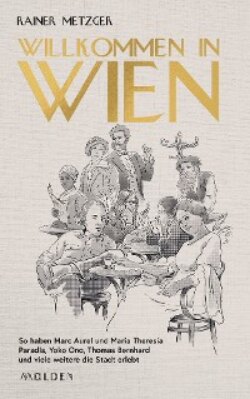Читать книгу Willkommen in Wien - Rainer Metzger - Страница 9
ОглавлениеZU EBENER ERDE UND IM ERSTEN STOCK
MEISTER ANTON PILGRAM
Im Jahr 1890 ließ sich der Schokoladengeschäftsinhaber Josef Manner die Idee patentieren, mit dem Stephansdom zu werben. Der Gedanke war naheliegend, denn Manners Laden, heute würde man sagen: sein Flagship Store, lag gleich vis-à-vis von Wiens Hauptkirche – die Produktion seiner süßen Spezialitäten hatte er in eben diesem Jahr nach Ottakring verlagert (die Adresse ist Wilhelminenstraße, was die Postleitzahl 1170 und damit Hernals bedeutet – echte Afficionados finden ihren Fabriksverkauf gefühlt dennoch im 16. Bezirk). Bis heute jedenfalls prangt auf den rosa Packungen, die Manners Neapolitaner Schnitten in die Welt tragen, die gleichsam offizielle Ansicht des Stephansdoms von Süden her, es ist, als hätte er den Rudolf-von-Alt-Blick gleich mitpatentiert. Unschlagbar ehrlich gab der Enkel und Nachnachfolger als Unternehmenschef Carl Manner im Jahr 1998 dann Folgendes zu Protokoll: „Ich hab schon gern Süßes, aber eher etwas, wo Marmelade drin ist. Die Schnitten, die kratzen mich. Die will ich nicht. Aber sie sind nicht schlecht. Man kann sie durchaus essen.“ Schon der Patriarch soll gesagt haben: „Wer Werbung macht, hat es notwendig.“ Wem ein Schatten der Ewigkeit ins Geschäft fällt, der hält es mit der Wahrheit.
Carl Manners Schnitten illustrieren auf ihre Weise, was einem Wiener am Herzen liegt. Oder in ortsansässigem Idiom: wos en weana olas en s gmiad ged. In seiner berühmten Hommage an die Heimatstadt, die ihn zu einer Art Volksdichter machte, hatte H. C. Artmann im Jahr 1958 mit schwarzer Tinte aufgelistet, was das alles ist. Manches Unübersetzbare ist dabei: „a kindafazara wossaleichn foxln“ beispielsweise oder der längst sprichwörtliche „schas med quastln“. Das Fazit indes geht alle an: „und en hintagrund auf jedn foe: da liawe oede schdeffö“, der Turm des Stephansdoms also, wenigstens als Hintergrund. Das augenzwinkernde Faible für das Umschlagen in die Perversion kommt bei Artmann natürlich hinzu. Doch geht es auch seriös, etwa per statistischer Erhebung. Auf die Frage nach einem Objekt, das im Land als „typisch für Österreich“ gilt, war mit 37 Prozent und so in großem Abstand am häufigsten die Antwort: der Stephansdom. Der liebe alte Steffl und sein klerikaler Unterbau: 1945, als es vorbei war mit dem historischen Betriebsunfall, der sich sieben Jahre davor ereignet hatte, und die Donaumonarchie, die längst nur noch eine Alpenrepublik war, wieder zu sich kommen konnte, gab das Presseamt der Stadt Wien eine Broschüre heraus, die die Leistungen der Vergangenheit, als es sich noch auf sie berufen ließ, versammelte. Das ewige Wien war sie betitelt und hatte auf dem Umschlag – natürlich den Stephansdom. „Ein Futteral für die Waffen der Kirche“ nannte ihn Elfriede Jelinek in der von ihr gern erwarteten Despektierlichkeit. Das Arsenal, das diese Kathedrale ist, lässt sich dabei nicht weniger für Profanes engagieren.
Noch heute finanziert die Firma Manner für Sankt Stephan einen Steinmetz. Die Dombauhütte gibt es nämlich nach wie vor, keine Architektur dieser Dimension, an der nicht irgendwo ein Gerüst stünde. Seit acht Jahrhunderten ist das nun so. Natürlich war früher mehr zu bauen, zusammen mit den Werkstätten in Köln, Bern und Straßburg gehörte Wien, festgeschrieben am Regensburger Hüttentag des Jahres 1459, zu den Vorzeigebaustellen des Reiches. Abgesehen vom – noch heute als Torso dastehenden – Nordturm war das Gebäude seinerzeit schon in jener provisorischen Vollendung, die alles historisch Bedeutsame auszeichnet. Der Steffl, die steinerne Nadel von ungeheurer Steilheit und zusammen mit dem Turm der Westfassade von Straßburg die höchste bauliche Erhebung bis ins 19. Jahrhundert, war 1433 seiner Bestimmung übergeben worden – als Wegweiser in den Himmel und um die Welt neidisch zu machen. Mit dem Dombaumeister Hans von Prachatitz ist seine Fertigstellung verbunden. In der Gegenwart, seit 1993, bekleidet das Amt Wolfgang Zehetner. Und in den Jahren von ca. 1510 bis 1515 war es der Meister Anton mit dem Beinamen Pilgram.
Seine Hinterlassenschaft bietet sich eher skulptural als architektonisch dar. Vor allem als Fenstergucker kennt man ihn, und das gleich in zweifacher Hinsicht, zu ebener Erde und im ersten Stock, wie ein anderer Volksdichter Wiens, Johann Nepomuk Nestroy, es betiteln würde. Zum einen verbindet sich mit dem Fenstergucker, einen Meter über dem Fußboden, ein hübsches Aperçu am Sockel der Kanzel im Mittelschiff, ein buchstäblicher Nebenschauplatz, aus dem sich ein Mann mittleren Alters, schulterlangen Haares und bemützten Kopfes, einen Zirkel in der Hand, durch eine Luke zwängt, um sich geltend zu machen gegen die Autoritäten, die sich oberhalb von ihm in die Brust werfen. Es sind die vier Kirchenväter, Schriftgelehrte des frühen Christentums, die die Prediger munitionieren, wenn sie vom Rednerpult herunterdonnern und die Gläubigen, die ihnen folgen, genauso klein machen, wie sich die Gestalt in ihrer Enge unter dem Treppenaufgang von vornherein gibt. Zum anderen ist da jene Konsolfigur in einigen Metern Höhe, auf der sich eine aufregende Schlingrippenkonstruktion erhebt, der Orgelfuß, angebracht an der Innenwand des nördlichen Seitenschiffs. Ausstaffiert wie der Kollege an der Kanzel, zusätzlich zum Zirkel mit einem Winkelmaß bewehrt, in den Gesichtszügen feiner gezeichnet und, auch dank der farblichen Fassung, von größerer Lebensnähe, legt die Büste ein Selbstporträt nahe. Ein Schriftzug, der die Gestaltung umgibt und in kapitalen Lettern die Buchstabenfolge MAP für Meister Anton Pilgram, und die Datierung 1513 lesen lässt, macht dies zusätzlich plausibel.
Markantes Selbstporträt in luftiger Höhe: Anton Pilgram mit Winkelmaß und Zirkel an der Nordwand des Stephansdoms. Der Orgelfuß trägt die Jahreszahl 1513.
Recht ähnlich sehen sich die beiden Fenstergucker nicht. Umso ähnlicher indes verhalten sie sich. Die Kunstgeschichte, die im Geschäft mit den Ähnlichkeiten ihr Metier gefunden hat, beruft sich bei derlei Ungereimtheiten gern auf den Zeitfaktor. Dann wäre die Kanzel eben früher entstanden, der Bildhauer arbeitete noch an seinen Fähigkeiten und der Erzählung vom künstlerischen Fortschritt stünde nichts im Wege. Ein Höhepunkt, wie er zu jeder guten Geschichte gehört, wäre auch, in luftiger Höhe, der Orgelfuß von 1513, der auch in seinem Gefüge an filigraner Gewölbetechnik beeindruckt. Von Pilgram selbst ist wenig erhalten. Womöglich hat er in Straßburg gelernt, war tätig in Schwaben, ging nach Wien, wo er eine Kanzel hinterließ, wurde aktenkundig in Brünn, wo er auch baute, um schließlich seine Karriere wiederum in Wien zu beschließen. Mehr als das Amt des Dombaumeisters von Sankt Stephan war auch für einen Mann seiner Virtuosität nicht zu holen und wie man weiß, hat sich Meister Anton nach übergebührlichen Kräften darum bemüht. Sein Vorgänger Jörg Öchsl wurde nach allen Regeln der Handwerkskunst abserviert, Anton hat ihm den Auftrag für den Orgelfuß regelrecht entrissen, was ihm offenbar auch eine gewisse Ächtung durch die Kollegenschaft eintrug.
Als Dombaumeister sah man sich gewissermaßen verpflichtet, einer speziellen Laienbruderschaft anzugehören, die dem Leichnam Christi geweiht war. Tatsächlich findet sich in der Mitgliederliste der „Fronleichnamsbruderschaft“, die ihren Sitz in der unterirdischen Virgil- und Erasmuskapelle hatte, der Eintrag „Maister Anthoni, die Zeit Paumaister bey sand Steffan, Dorothea uxor, yetzund in der Stainhuetten“. Allerdings werden Meister Anton und seine Frau erst im dritten Quartal 1513 erwähnt – vielleicht hatte man ihm eine Bewährungsfrist auferlegt. Die Eintragungen enden im Jahr 1515, ein deutliches Indiz seines Todes. Und der Quelle lässt sich entnehmen, dass das Ehepaar auf dem Areal der Bauhütte auch wohnhaft war, gegenüber dem Steffl, dort, wo seit 250 Jahren das Churhaus steht und in dem jetzt die erzbischöfliche Verwaltung zu finden ist.
Mehr als das Amt des Dombaumeisters von Sankt Stephan war auch für einen Mann seiner Virtuosität nicht zu holen und wie man weiß, hat sich Meister Anton nach übergebührlichen Kräften darum bemüht. Sein Vorgänger Jörg Öchsl wurde nach allen Regeln der Handwerkskunst abserviert, Anton hat ihm den Auftrag für den Orgelfuß regelrecht entrissen, was ihm offenbar auch eine gewisse Ächtung durch die Kollegenschaft eintrug.
Betrachtet man die Situation im Inneren von Sankt Stephan, so könnte man meinen, der Fenstergucker, der per Inschrift Anton selbst ist, blicke direkt zu seinem Lehrmeister (der im 17. Jahrhundert hinzugekommene Altar hemmt die Perspektive allerdings rabiat). Rechts hinten, im Apostelchor, erhebt sich nämlich in sublimer Selbstverständlichkeit der Epitaph Kaiser Friedrichs III., dessen Grabplatte auf den Großmeister der Bildhauerei im 15. Jahrhundert zurückgeht, auf Niclaus Gerhaert, gebürtig im niederländischen Leiden, ein Wanderkünstler auf den Spuren der lukrativsten Großaufträge. Gerhaert, der 1473 in Wiener Neustadt gestorben ist, darf als der Urheber fast aller Innovationen gelten, die damals der Skulptur, jedenfalls außerhalb Italiens, zuflogen. Auf ihn geht die Praxis zurück, Büsten zu schaffen und der dergestalt halbierten Figur wieder ein ganzes Leben einzuhauchen, indem man sie mit der Illusion, sie stünde am Fenster, ausstattet. Anton wäre mit seinen Versionen so etwas wie Gerhaerts Enkelschüler und es bedeutet eine schöne Koinzidenz, sie beide im Stephansdom anzutreffen.
Im November 1513 sind Kaiser Friedrichs Gebeine, 20 Jahre nach seinem Tod, in das Hochgrab überführt worden. Nicht auszudenken, wenn Meister Anton tatsächlich einen steinernen Blick auf die parallel zur Fertigstellung seines eigenen Werkes ablaufende Zeremonie geworfen hätte. Das lässt sich nicht verifizieren.
Immerhin sind Optik und Gestik des Fensterguckers sprechend genug, um ihm eine solche Neugier, eine solche Anteilnahme und Geistesgegenwart zuzugestehen. Wenn auch nur als Inszenierung. Zur selben Zeit, tausend Kilometer weiter südlich, steht ein solcher Blickaustauch sehr offenkundig und handfest vor Augen. Man sieht vor sich, wie Raffael, im Vatikan beschäftigt mit der Freskierung der als Stanzen bekannten Amtszimmer, sich hinüberschleicht in die Sixtinische Kapelle, keine 50 Meter weiter, und versucht, etwas von der Decke zu erhaschen, auf der gerade Michelangelo eine Weltsensation hinterlässt. Und man sieht deutlich am Ergebnis, was Raffael vom Kollegen alles brauchen konnte. Paragone nennt man eine solche im „Wettstreit der Künste“ durchaus legitime Künstlerneugier. Rivalität und Konkurrenz waren immer schon Motor nicht nur der kulturellen Entwicklung. Und auch für Meister Anton bewährte sich das Prinzip, als er gegen Öchsl agitierte. Womöglich konnte er mit der fabelhaften Idee der visuellen Fernbeziehung etwas gutmachen.
„Zum Beten geht man in kleinere Kirchen“, stellt Elfriede Jelinek in ihren Gedanken zum Stephansdom fest. Da hat sie recht. In den Stephansdom geht man zum Schauen, nicht von ungefähr hieß eine frühe TV-Reihe des ORF eben Der Fenstergucker. Vor einem halben Jahrtausend war das schon nicht anders.
ENTDECKEN
Wir begegnen Meister Anton Pilgram im Stephansdom zu ebener Erde und im ersten Stock: als „Fenstergucker“ unter der Stiege der Domkanzel und beim Orgelfuß an der Nordwand.
Meister Anton beweist Neugier und Anteilnahme: der „Fenstergucker“ unter der Stiege der Domkanzel.