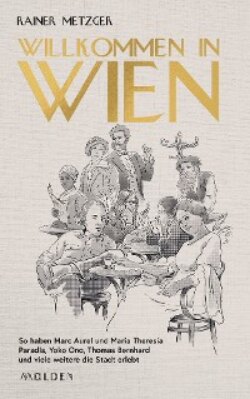Читать книгу Willkommen in Wien - Rainer Metzger - Страница 7
ОглавлениеAUSSEN UND INNEN
DER SCHOTTENMEISTER
Wer sich Wien besieht, folgt dabei bevorzugt Malern. Da gibt es zum einen den Canaletto-Blick vom Belvedere-Garten aus, der die Weite zwischen Karls-, Stephans-und Salesianerinnenkirche fokussiert – eine Sphäre zwischen Aristokratie und Katholizismus, wie sie um 1760 festgehalten worden ist, aber nach wie vor viel von der Stadt erzählt, auch wenn sich mittlerweile ein paar Hochhäuser am Bahnhof Wien-Mitte, am Kai oder am Gürtel in die Zeitlosigkeit der Aussicht geschoben haben. Bernardo Bellotto, genannt Canaletto, weil er seine Karriere am Canal Grande begonnen hat, ist nach wie vor so etwas wie die Autorität, geht es darum, Neubauten zu verhindern oder Stadtporträts mit dem Pittoresken anzureichern (Maximilian Schells Verfilmung der Geschichten aus dem Wienerwald von 1979 leitet ihre Handlung eben mit dieser Perspektive ein). Und dann gibt es zum Zweiten den Rudolf-von-Alt-Blick, der dem Stephansdom gilt, wie er vom Stock-am-Eisen-Platz her ins Visier genommen wird. Rudolf von Alt, Aquarellist und Naturbeobachter, die Graue Eminenz der Wiener Künstlerschaft vor 1900, steht dafür Pate. Sein Standpunkt geht weniger ins Panorama als in jene Kleinteiligkeit, deren man erst habhaft werden konnte, als Wiens Hauptsehenswürdigkeit in den 1880ern von den sie umstehenden Häusern befreit worden war.
Demgegenüber führt der Blick des Schottenmeisters ein Schattendasein. Auch dieser Blick rankt sich um den Stephansdom, als Ausrufezeichen markiert sein Turm nicht weniger die Symmetrieachse als bei den späteren Kollegen. Er wird von Südwesten her angepeilt, von einer der stadtnahen Terrassen aus, wie sie typisch sind für Wiens Topografie, vielleicht von der Höhe, wo heute der Margaretenhof steht. Mit dem Gewässer, zart blau ganz links am Bildrand, könnte der Wienfluss gemeint sein. Der Steffl ist das Zentrum des Zentrums, denn es gibt auch Vorstädte zu sehen, und ganz am Horizont grüßen der Kahlen-, der Leopolds- und der Bisamberg. Der Schottenmeister-Blick ist heute nicht mehr zu haben, er spielt sich um 1470 ab, als die Welt doch noch ganz anders war, und bei aller Genauigkeit der Einvernahme spielt er sich vor allem im Hintergrund ab. Die Szenerie ist Wien, doch das Thema ist Die Flucht nach Ägypten. „Da stand Josef in der Nacht auf“, heißt es im Neuen Testament, Matthäus 2, 14, mit Bedacht auf die Verwandtschaftsverhältnisse, „und floh mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten“. Man kann den Satz für die Plausibilität der Darstellung in Anspruch nehmen, denn am Horizont, im Osten, erscheint ein Streifen Helligkeit, als würde jene Sonne aufgehen, die den neuen Tag zur im Text apostrophierten Nacht ankündigt. Es ist, so erzählt es das Bild, in der Zwischenzeit Morgen geworden, die Stadt im Hintergrund zeigt an, dass bereits ein Stück Weges zurückgelegt worden ist – und vom Himmel grüßen Komet und Mondsichel der Heiligen Familie zu.
Der Schottenmeister-Blick gilt als eine der frühesten Stadtveduten der Kunstgeschichte. So viel man von Wien erfährt – man erkennt auch die Minoritenkirche, Maria am Gestade oder Teile der Hofburg und ganz rechts macht sich samt Baukran die Dominikanerkirche bemerkbar, deren Neubau des Langhauses eben für die Zeit aktenkundig ist –, so wenig weiß man von ihrem Porträtisten, der eher Handwerker als Künstler ist und in kalkulierter Uneindeutigkeit deswegen als Meister firmiert. Meisterlich kann man das Bestreben, sich auf das Gesehene zu verlassen, der Erfahrung zu vertrauen und alles, was ist, festzuhalten wie es ist, schon nennen. In seinem Realismus ist er zeittypisch. Und zeittypisch ist auch seine Anonymität. In dieser Ungreifbarkeit heißt er nun Schotten-meister, er ist benannt nach einem Altar mit einstmals 24, jeweils knapp einen Meter im Quadrat messenden, aus Eichenholz gefertigten Tafeln, von denen 21 erhalten sind. Wie oftmals bei solchen vielteiligen Zyklen gibt es, Vorder- bzw. Rückseite einnehmend, eine Abteilung mit der Kindheits- und eine mit der Passionsgeschichte von Jesus Christus. Der Notname steht in – nicht vollständig erhelltem – Zusammenhang mit dem Schottenstift an der Freyung. Dieser Benediktinerkonvent, gegründet im 12. Jahrhundert und von iro-schottischen Mönchen besiedelt, existiert heute noch, seine Ehrwürdigkeit wird besiegelt von einem Museum, zu dessen Bestand eben der Schottenaltar gehört – und zu dessen Hauptattraktionen die Tafel mit dem Schottenmeister-Blick.
Auch Krems hat in der Bilderfolge des Schottenmeisters eine Vedute bekommen. Sie ist ähnlich gelagert, sie findet sich im Fond einer Kreuztragung Christi und soll ihrerseits darauf hindeuten, dass sich das Geschehen außerhalb einer Stadt abspielt. Krems steht in der hier bemühten Logik für Jerusalem wie Wien für Bethlehem. Es ist eine Logik der Illustration, keine der Geografie. Weil die biblische Wahrheit sich in alle Ewigkeit versteht, ist es nur billig, sie in der spätmittelalterlichen Wirklichkeit wiederzufinden. So reitet Jesus auch bei seinem Einzug in Jerusalem durch ein Stadttor, das eine Datierung enthält: 1469 ist zu lesen, denn die Passion, das Sterben dieses Gottes als Mensch, gilt so generell wie aktuell. Mit dem späteren 15. Jahrhundert ist das Wirkungsfeld des Schottenmeisters dann auch abgesteckt. Dass er bei aller Kenntnis internationaler Tendenzen aus der ostösterreichischen Gegend stammte, darf man zusätzlich annehmen.
Der Schottenmeister-Blick auf Wien, eine der frühesten Stadtveduten der Kunstgeschichte: die Flucht nach Ägypten (oben) und die Heimsuchung Mariens (unten). Museum im Schottenstift, um 1470.
Der Stephansdom macht sich auf einem weiteren Gemälde bemerkbar. Diesmal indes muss man ihn erst ausfindig machen, auf die Zeigegeste seines Südturms ist verzichtet, dafür sieht man das Zickzackmuster des Daches und die beiden Heiden-türme, die die Westfassade in der Fasson halten. Der Blick geht nach innen, ins Herz der Stadt und in die Seele der beiden Frauen, Marias und ihrer Base Elisabeth, die bei dieser Heimsuchung gezeigt werden. Schauplatz der Begegnung ist eine Gasse, aber keine in Wiens Stadtplan ausgewiesene. Was man immerhin noch identifizieren kann, ist als Pendant zur Stephans- der Turm der Peterskirche. Und um diese Pendantwirkung geht es gerade: Wie Sankt Peter zu Sankt Stephan komplementär steht, wie der vordere Heidenturm zum hinteren und wie der Erker links der Gasse zum Vis-à-vis, so gehören die beiden Frauen in ihrer Zweisamkeit zueinander. Wieder spricht die Stadt die Sprache der biblischen Wahrheit und wieder geht es nicht vordringlich um das Porträtieren des Momentanen als vielmehr um die Bekräftigung, die Beglaubigung des sowieso in der Welt Angelegten. Es geht, gewissermaßen, um ein eh schon wissen. Darin war Wien von jeher gut.
Die Stadt von außen und die Stadt von innen, Wien im Panorama und Wien im Interieur: In beiden Fällen ist der Schottenmeister auf seine Weise innovativ. Er zeigt sich als früher Vertreter des Prinzips Vedute, und man kann gleichsam die Uhr stellen, wie genau er seine Ansicht auf das Gefüge der Gebäude austariert. Und er gibt der Stadt eine Art Physiognomie, er gibt ihr ein Gesicht und teilt sie ein zur Stellvertretung der einen, großen, nicht weiter hintergehbaren, biblischen Gegebenheit. Beide Könnerschaften, das Metier des Porträtierens und jenes des Charakterisierens, wird die bildende Kunst noch sehr gut brauchen können und bis zur Moderne gerade darin ihr Alleinstellungsmerkmal behaupten. So führt durchaus ein direkter Weg vom Schottenmeister zum ersten Großmeister auf dem Gebiet, zu Albrecht Dürer.
Die Stadt von außen und die Stadt von innen, Wien im Panorama und Wien im Interieur: In beiden Fällen ist der Schottenmeister auf seine Weise innovativ. Er zeigt sich als früher Vertreter des Prinzips Vedute, und man kann gleichsam die Uhr stellen, wie genau er seine Ansicht auf das Gefüge der Gebäude austariert. Und er gibt der Stadt eine Art Physiognomie, er gibt ihr ein Gesicht und teilt sie ein zur Stellvertretung der einen, großen, nicht weiter hintergehbaren, biblischen Gegebenheit.
Doch man sollte die Kirche im Dorf lassen. Dass der Schottenmeister weniger eine Person ist als ein Werkstattzusammenhang, für den diverse Hände tätig sind (welche die Kunstgeschichte als akademische Disziplin dann wieder scheidet und in ihre individuellen Einzelteile zerlegt), gehört zu den ökonomischen Bedingungen von solchen Großaufträgen. Dass der Schottenmeister, den man fortan eigentlich in Anführung setzten müsste, bei aller Avanciertheit seiner Ansichten als Bildgrund oftmals einfach Gold appliziert und auf Landschaft dann auch gern verzichtet, hat mit der seinerzeit noch eher unentschiedenen Frage zu tun, was wertvoller ist: die künstlerische Handschrift oder letztlich doch die Pretiosen des Materials. Und dann sind da noch diese Köpfe, wie sie immer wieder über die einzelnen Tafeln hinweg auftauchen und einen Goût des Gleichgeschalteten, der blinden Wiederholung und gleichsam industriellen Herstellung verbreiten: So das Gesicht des ausgemergelten, bleichen, faltigen Alten, das des Öfteren auf dem Körper eines heiligen Joseph sitzt (so etwa bei der Flucht nach Ägypten), aber auch die Figur eines Geharnischten ausstattet, der mit gezücktem Schwert Hand anlegt zum Bethlehemitischen Kindermord. Das Heilige und die Gewalt sind über einen Kamm geschoren, der Böse und der Gute sehen sich allzu ähnlich. Hier gibt es keine Korrespondenz von Außen und Innen. Hier agiert der Meister nicht meisterlich.
Das Verhältnis von Außen und Innen ist eine Wiener Obsession. „Wir haben nichts als das Außen zum Innen zu machen“, heißt es bei Hermann Bahr, dem vielbeschäftigten Stichwortgeber zur ortsansässigen Mentalität. Umgekehrt gilt der Satz genauso. Die beiden Sphären jedenfalls werden über die Wiener Kulturgeschichte hinweg in Spannung gehalten, Interieur und Exterieur, Zentrum und Vorstadt, die Wohnung und die Fassade, die Seele und der Körper, das Hirn und die Haut, das Abgründige und das Gediegene, die Depression und die Theatralik sind Aggregatszustände, in denen sich das Fluidum des Wiener Lebens überhaupt geltend macht. Da braucht es als Kronzeugen noch lange keinen Sigmund Freud. Schon der Schottenmeister also brachte die Korrespondenz aufs Tapet und er ließ im Unentschiedenen, welche Perspektive, die ins Milieu oder die ins Ensemble, jene von Rudolf von Alt oder jene Canalettos, die größere Prominenz beansprucht. Eines aber auf jeden Fall: Prominenz.
ENTDECKEN
Museum im Schottenstift
Freyung 6
1010 Wien