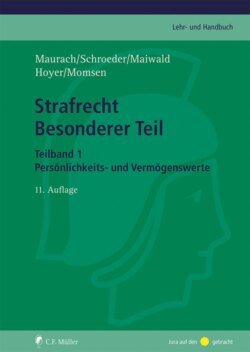Читать книгу Strafrecht Besonderer Teil. Teilband 1 - Reinhart Maurach - Страница 110
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Die ältere Entwicklung
Оглавление11
Im römischen Recht war der Nasciturus nur zivilrechtlich Objekt der Rechtsfürsorge. Strafrechtlich wurde ihm, als der „portio mulieris“, eigener Schutz vorenthalten, und die später mit Septimus Severus einsetzende Strafbarkeit des Schwangerschaftsabbruchs (procuratio abortus) fand ihre Grundlage in der Vereitelung berechtigter Nachwuchshoffnungen des Ehemannes durch die abbrechende Frau. Im frühdeutschen Recht spielt der Schwangerschaftsabbruch wie bei allen ackerbautreibenden Völkern eine anscheinend sehr geringe Rolle; er wird dann meist als Zauberei bestraft. Die spätmittelalterliche deutsche Auffassung – der Schwangerschaftsabbruch, das „Vertun“ von Kindern, wird der Kindestötung gleichgestellt – ist vom kirchlichen Recht her beeinflusst. Dieses hatte sich schon in seiner Frühzeit (Zwölf-Apostel-Lehre, Barnabas-Brief) vom Individualismus der römischen Auffassung getrennt und stellte auf die Beseelung des Embryos ab: Homicidium, wenn der Abbruch am Fötus als dem Träger der „anima rationalis“ begangen wurde, während frühere Eingriffe an der „anima vegetativa“ (bis zum 40. bzw. 80. Schwangerschaftstage) extra-ordinär bestraft wurden. Diese kanonistische Unterscheidung ging in die Bambergensis (Art. 158) und die PGO (Art. 133) über; beide Gesetze (die den Ausdruck „abtreiben“ einführen) sehen bei bereits „lebendigem Kind“ Totschlagsstrafe vor, während bei Abtreibung des „noch nicht lebendigen Kinds“ durch die Mutter „Rats zu pflegen“ ist. Diese Unterscheidung der Schwangerschaftsgrade behauptet sich partikularrechtlich noch lange Zeit. Im Codex Juris Bavarici Criminalis von 1751 führt sie zu der überraschenden Einschränkung der Strafbarkeit auf die zweite Hälfte der Schwangerschaft nach Bewegungen des Fötus (I 3 § 20). Die Relikte dieser Unterscheidung kann man noch im Preuß. ALR II 20 §§ 986 f. erkennen. Erst mit dem 19. Jhdt. (z.B. bayer. StGB von 1813 Art. 172) hört diese Unterscheidung auf, doch erscheint jetzt die eigenständige Schutzwürdigkeit des werdenden Lebens auch ohnedies als unangefochten. Gleichzeitig endet die Strafbarkeit der fahrlässigen Abtreibung (I 3 § 20 Cod. Jur. Bav.; Art. 88 § 6 Theresiana; ALR II 20 § 938). Grundlage der ursprünglichen Fassung des § 218 sind §§ 181, 182 preuß. StGB 1851.
12
Eine aufschlussreiche Erschütterung erfuhr die Bewertung des Schwangerschaftsabbruchs unter dem Nationalsozialismus. Die Entwurfsberatungen sahen die Verlegung der Abtreibungsbestimmungen aus dem Zusammenhang der Tötung in den der „Angriffe auf Rasse und Erbgut“ vor. Was dies in letzter Konsequenz bedeutet hätte (und nach dem Willen des Regimes auch bedeuten sollte), lehrt die VO vom 9.3.43, welche Personen nichtdeutscher Abkunft (z.B. Jüdinnen und Ostarbeiterinnen) vom Abtreibungsverbot ausnahm[4]: keine ad-absurdum-Führung dieses Gedankens, wie Welzel § 41 annimmt, sondern im Gegenteil die brutale methodische Folge aus der Umfälschung eines überstaatlich-absoluten Wertes in einen solchen der „Staatszweckmäßigkeit“[5].