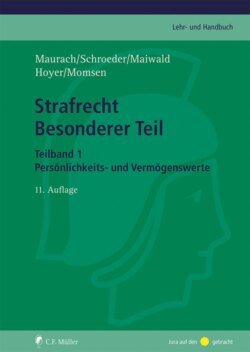Читать книгу Strafrecht Besonderer Teil. Teilband 1 - Reinhart Maurach - Страница 122
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. System der geltenden Regelung
Оглавление1
Die Systematik der §§ 218 ff. täuscht: da die Voraussetzungen für die Nichtanwendung des § 218 nach § 218a Abs. 1 leicht zu erlangen sind, stehen § 218 und § 218a Abs. 1 nicht im Verhältnis von Regel und Ausnahme, sondern § 218 ist eine hohle Fassade, eine Unaufrichtigkeit des Gesetzes (Schroeder ZRP 92, 409).
In Wahrheit ergeben sich aus den in § 218a Abs. 1 Nr. 1–3 aufgeführten Voraussetzungen der Nichtgeltung des § 218 drei – beschränkte – „Tatbestände“:
| 1. | Verbot des Schwangerschaftsabbruchs durch Nichtärzte |
| 2. | Verbot des Schwangerschaftsabbruchs nach Ablauf von zwölf Wochen seit der Empfängnis |
| 3. | Verbot des Schwangerschaftsabbruchs innerhalb von zwölf Wochen seit der Empfängnis ohne Beratung (und ohne das – selbstverständliche – Verlangen der Schwangeren). |
2
§ 218a Abs. 1 spricht im Anschluss an BVerfGE 88, 273 von einer „Nichtverwirklichung des Tatbestandes des § 218“. Mit diesem gesetzgeberischen Novum soll entgegen dem Stufenaufbau der Straftat nicht ein Mehr als die Rechtmäßigkeit, sondern ein Weniger, nämlich eine fortbestehende Unerlaubtheit ausgedrückt werden. Andererseits soll aber Nothilfe zugunsten des Ungeborenen ausgeschlossen sein[1]. Der Unterbrechungsvertrag zwischen dem Arzt und der Schwangeren ist gültig, Lohnfortzahlung erfolgt. Auch können Unterbrechungen, die nach § 218 Abs. 2 und 3 gerechtfertigt sind, bei einer Beratung nicht unwertiger behandelt werden als solche nach Abs. 1 (Eser S/S § 218a 17). Die dogmatische Einordnung des „Nichtverwirklichtseins des Tatbestandes“ nach § 218a Abs. 1 ist daher lebhaft umstritten. Eser bezeichnet es als „Tatbestandsausschluss sui generis“ (S/S § 218a 17; zust. Rudolphi/Rogall § 218a 4), Hermes/Walther als „Rechtswidrigkeitsausschluss sui generis“ (NJW 93, 2341). Andere sprechen von einem „prozeduralen Rechtfertigungsgrund“[2], einem „Rechtfertigungsgrund de facto“ (Jakobs aaO 37; Fi § 218a 5) oder einem Strafunrechtsausschließungsgrund (Günther ZStW 103, 874). Nach v. Hippel ist eine dogmatische Integration gar nicht möglich[3]. Nach unserer Auffassung schränkt § 218a Abs. 1 § 218 auf drei spezielle Verhaltensweisen ein.
3
Auch die Überschrift des § 218 ist dadurch unrichtig geworden; sie müsste – wie bei anderen vergleichbar eingeschränkten Tatbeständen (§§ 142, 284, 326, 327) – richtig lauten: „Unerlaubter Schwangerschaftsabbruch“, wenn nicht BVerfGE 88, 273 f. den Schwangerschaftsabbruch nach § 218a Abs. 1 gleichzeitig für nicht tatbestandsmäßig, aber unerlaubt erklärt hätte.
4
§ 218a Abs. 2, 3 enthalten zwei Rechtfertigungsgründe, von denen der zweite wiederum befristet ist, und zwar auf 12 Wochen. § 218b dient der Absicherung des gerechtfertigten Abbruchs: der abtreibende Arzt muss sich die Stellungnahme eines anderen Arztes vorlegen lassen (Abs. 1 S. 1), und dessen unrichtige Feststellung ist ebenfalls mit Strafe bedroht (Abs. 1 S. 2).
§ 218c bedroht gemäß den Forderungen von BVerfGE 86, 390 die Verletzung von Nebenpflichten durch den zulässig abbrechenden Arzt mit Strafe.
5
Die Schwangere wird bei Selbstabbruch oder wegen ihrer Mitwirkung bei einem Abbruch erheblich günstiger gestellt, wozu es eines ganzen Bündels von Vorschriften bedarf (§§ 218 Abs. 3, Abs. 4 S. 2, 218a Abs. 4, 218b Abs. 1 S. 3, 218c Abs. 2).
6
Ein erratisches Relikt der früheren Regelung enthält § 219a: Strafbarkeit des Angebots des Schwangerschaftsabbruchs, obwohl dieser selbst nur noch in Ausnahmefällen strafbar ist (vgl. Schroeder ZRP 92, 410). § 219a Abs. 2-4 sieht denn auch umfangreiche Ausnahmeregelungen vor, allerdings nur für Angebote gegenüber Ärzten und Beratungsstellen. § 219b (Inverkehrbringen von Mitteln zum Schwangerschaftsabbruch) beschränkt sich von vornherein auf die Absicht der Förderung rechtswidriger Schwangerschaftsabbrüche nach § 218.
7
Das BVerfG hat darüber hinaus Strafvorschriften zur Sicherung des Beistandes und zur Abwehr des Drucks vonseiten von „Personen des familiären Umfeldes der schwangeren Frau“ verlangt (BVerfGE 88, 293, 298, 308 f.). Diese Forderung erfüllen unvollständig die Strafschärfungsgründe der §§ 170 Abs. 2, § 240 Abs. 4 Nr. 2 (näher Tröndle NJW 95, 3017) und § 218 Abs. 2 Nr. 1.
Die §§ 218-219b bieten eine Fülle von interessanten dogmatischen Problemen; ihre praktische Bedeutung ist jedoch minimal (s.u. Rn. 30).