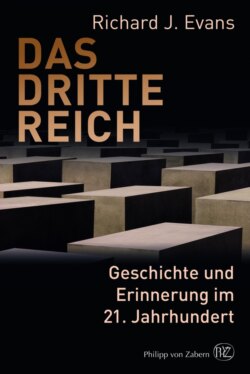Читать книгу Das Dritte Reich - Richard Evans - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V
ОглавлениеTrotz all dieser unheilvollen Entwicklungen wäre es falsch, die Behandlung gesellschaftlicher Außenseiter in der Weimarer Republik ausschließlich unter dem Aspekt wachsender staatlicher Diskriminierung und Verfolgung zu betrachten. Die 1920er-Jahre erlebten auch umfassende soziale Reformen im staatlichen Wohlfahrts-, Strafvollzugs- und Überwachungsapparat. Selbst jene, die bei der einen oder anderen Art von sozialer Devianz an ein starkes erbliches Element glaubten, nahmen an, dass die Mehrzahl der Personen mit abweichendem Verhalten wieder in die Gesellschaft integriert werden könne. Auch liberale und sozialistische Ideen hatten einen gewissen Einfluss, und Vorschläge, Menschen mit abweichendem Verhalten zu sterilisieren oder sie zu Opfern einer Politik der unfreiwilligen „Euthanasie“ zu machen, stießen allenthalben auf überwältigende Ablehnung.
Doch diese Situation war nicht von Dauer. Die Wirtschaftskrise der Jahre 1929 bis 1933 verschärfte die Probleme gesellschaftlicher Minoritäten in vielerlei Hinsicht. Eine Massenarbeitslosigkeit bislang unbekannten Ausmaßes ließ die Zahl der Wohnungslosen und Landstreicher erheblich ansteigen. Unterstützungsleistungen wurden gekürzt und Langzeitarbeitslosen ganz entzogen, von denen fast eineinviertel Millionen Anfang 1933 keinerlei Unterstützung erhielten. Die Zahl der Menschen, die in Deutschland draußen schliefen und auf der Straße lebten, lag in den frühen 1930er-Jahren Schätzungen zufolge zwischen 200.000 und 500.000. Kürzungen bei den staatlichen Ausgaben während der Krise waren Wasser auf die Mühlen derjenigen, die geistig und körperlich Behinderte für „sozialen Ballast“ hielten. Die Prostitution wurde, da reguläre Arbeit schwer zu bekommen war, für junge, größtenteils aus der Arbeiterschaft stammende Frauen einmal mehr zu einem weitverbreiteten Mittel, sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und obwohl die Verbrechensraten nicht so stark stiegen wie während der Hyperinflation von 1922/23, waren Jugendbanden oder „Cliquen“ während der Weltwirtschaftskrise besonders auffällig und wurden von vielen Menschen aus den bürgerlichen Schichten als ernsthafte Bedrohung empfunden.39
In dieser Situation wurden die Grenzen zwischen der achtbaren Gesellschaft und ihren Außenseitern undeutlicher und fließender denn je. Selbst in normalen Zeiten war etwa die Prostitution meist eine vorübergehende Notlösung für Frauen, die anschließend wenig Schwierigkeiten hatten, sich wieder in die Arbeiterschaft zu integrieren. Landstreicherei war weniger eine dauerhafte Lebensform als ein unvermeidlicher Notbehelf für Hunderttausende meist junger Männer, die sich in den frühen 1930er-Jahren kein Dach über dem Kopf leisten konnten, und häufig kaum mehr als ein Lebensabschnitt. Diebstahl, Unterschlagung und Kleinkriminalität stellten in einer Zeit von Massenarbeitslosigkeit und Pleiten für viele eine Versuchung dar. Und auf längere Sicht gelang es sogar der ethnischen Minderheit der „Rheinlandbastarde“, eine Rolle in der Gesellschaft zu finden, vor allem beim Zirkus und in der Unterhaltungsbranche. Während einige Formen geistiger oder körperlicher Behinderung unstreitig extrem waren und es denen, die darunter litten, unmöglich machten, ein in die Gesamtgesellschaft integriertes, normales Leben zu führen, waren andere nicht klar umrissen und abhängig von den Launen diagnostischer Verfahren, die ebenso ungenau wie willkürlich waren.40
In normalen Zeiten verfestigten, wie wir gesehen haben, Politik und Überwachungsmethoden diese Grenzen oft und verwandelten vorübergehende Rollen außerhalb der Gesellschaft in einen mehr oder weniger dauerhaften Zustand. So hatten die Medikalisierung der Strafrechtspolitik und der Aufschwung der Sozialfürsorge Mechanismen der sozialen Ausgrenzung auf immer mehr Menschen ausgeweitet, die dem Netz zuvor entkommen waren, während sie die Auswirkungen alltäglicher Überwachung auf die Identifizierung und Perpetuierung der Welt des „Asozialen“, des Kleinkriminellen und des Wiederholungstäters in keiner Weise milderte. Die Zusammenstellung von Statistiken über „Zigeuner“, das umfangreiche Katalogisieren gesellschaftlicher Außenseiter, die als erblich geschädigt und daher als Bedrohung kommender Generationen galten, die „Kriminalbiologischen Sammelstellen“ und die Informationssammelwut des Wohlfahrtssystems insgesamt – all dies schuf lange vor dem Aufkommen des „Dritten Reiches“ die Basis für die neuerliche Abschottung der Grenzen zwischen der Gesellschaft und ihren Ausgestoßenen, welche die Weltwirtschaftskrise zunächst in vielerlei Hinsicht zu verwischen schien.41
Das NS-Regime suchte diese Grenzen in extremer Form wiederherzustellen. Dabei verschmolz es all die unterschiedlichen Elemente, die zuvor im behördlichen, medizinisch-psychiatrischen, administrativen und kriminologischen Denken über gesellschaftliche Außenseiter zu finden gewesen waren. Indem sie ihre Welt in „Volksgenossen“ und „Gemeinschaftsfremde“ aufteilten, in jene, die dazugehörten, und jene, die nicht dazugehörten, definierten die Nationalsozialisten beinahe jede Form der Weigerung, zu ihren Zielen beizutragen, als abweichend, krank, rassisch motiviert oder degeneriert.
Dennoch gilt es noch einmal zu betonen, dass, historisch betrachtet, die deutsche Gesellschaft Außenseitern wahrscheinlich nicht feindseliger gegenüberstand als andere europäische Gesellschaften. Selbst in der traditionellen Ständegesellschaft waren die Grenzen zwischen „ehrlichen“ und „unehrlichen“ Leuten veränderlich und fließend gewesen und bis Mitte des 19. Jahrhunderts größtenteils verschwunden. Die Industriegesellschaft hatte neue Kategorien gesellschaftlicher Außenseiter hervorgebracht, vor allem unter den körperlich und geistig Behinderten, während sie andere Kategorien, etwa Wanderarbeiter und Landstreicher, teils aufrechterhielt, teils veränderte. Die gesellschaftlichen und bis zu einem gewissen Grad auch die behördlichen Einstellungen gegenüber sozial abweichenden Handlungen wie „Sodomie“ und Prostitution und gegenüber Außenseitergruppen wie „Zigeunern“ wurden im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts toleranter. Dennoch war polizeiliche Schikane für solche Außenseiter bis etwa zur Wende des 19. Jahrhunderts an der Tagesordnung, was ihre deviante Identität verfestigt haben mag, aber sie durchtrennte ihre Verbindungen mit der achtbaren Gesellschaft nicht vollständig.
Drei Faktoren änderten diese Situation im Zeitraum von etwa 1890 bis etwa 1930. Der erste war die Medikalisierung der Strafrechts- und Wohlfahrtspolitik im Verein mit einer gewaltigen Expansion des staatlichen Wohlfahrtssystems. Vor allem vom Ersten Weltkrieg an wurde ein erheblicher Anteil gesellschaftlicher Außenseiter zunehmend als erblich belastet, degeneriert und als Gefahr für die Zukunft der „deutschen Rasse“ eingestuft. Der zweite, damit zusammenhängende Faktor war der Aufschwung der „Rassenhygiene“, die Tendenz, die deutsche Gesellschaft und ihre Beziehungen zu anderen Gesellschaften in Europa und jenseits davon in rassischen Kategorien zu betrachten. Dies führte zu einer allmählichen Verknüpfung des Diskurses über gesellschaftliche Außenseiter mit den Diskursen über Antisemitismus und über die Tauglichkeit der „deutschen Rasse“ im Konkurrenzkampf mit anderen „Rassen“, wie etwa den Latinern und Slawen. Der dritte Faktor war die zunehmende Politisierung des Diskurses über gesellschaftliche Außenseiter, ja die zunehmende Politisierung der deutschen Gesellschaft insgesamt, vor allem während der Weimarer Republik, als vielen auf der extremen Rechten drastische Mittel geboten schienen, um die traumatische Niederlage im Ersten Weltkrieg zu überwinden und die deutsche Nation als kraftvolles, dynamisches, engagiertes und geeintes Gebilde zu erneuern, bereit, auf der Weltbühne jenen Status als Weltmacht wiederzuerlangen, den zu erringen ihr in den Jahren 1914 bis 1918 nicht gelungen war.
Auf Letzteres griffen die Nationalsozialisten von 1933 an im Umgang mit gesellschaftlichen Außenseitern zurück. Dabei setzten sie sich oftmals ebenso rücksichtslos über die von Experten getroffenen sorgfältigen Unterscheidungen hinweg, wie sie sich deren Ideen und Datensammlungen zunutze machten. Mit der Radikalisierung des Nationalsozialismus, insbesondere während des Krieges, radikalisierte sich auch die Politik gegenüber den gesellschaftlich Ausgeschlossenen. In dieser Situation verschwanden die Unterscheidungen zwischen politischer, „rassischer“ und sozialer Devianz fast vollständig. Spätestens 1944 war die Definition des „Gemeinschaftsfremden“ zu einem vollkommen willkürlichen Instrument in den Händen der SS und des Polizeiapparats geworden. Laut dem NS-Kriminologen Edmund Mezger waren alle Menschen „gemeinschaftsfremd“, „die nach ihrer Persönlichkeit und Lebensführung, insbesondere infolge von außergewöhnlichen Defekten des Intellekts oder des Charakters, erkennen [ließen], daß sie nicht imstande [waren], aus eigener Kraft den Mindestanforderungen der Volksgemeinschaft zu genügen“.42 Damit bekamen weit mehr Menschen die Unterdrückungs- und Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten zu spüren als bisher. Mezgers Definition stellte den Vollzugsbehörden praktisch einen Freibrief aus, fast jeden zu verhaften, einzusperren und zu ermorden, den sie wollten. Der übliche Gebrauch des Ausdrucks „Volksschädling“ in NS-Gesetzen gegen Vergehen wie Plünderung zeigt dabei an, wie weit das nationalsozialistische Denken vom Biologismus durchdrungen war. Führende NS-Juristen wie Roland Freisler und Otto-Georg Thierack erklärten ausdrücklich, die Justiz sei ein Instrument zur eugenischen Säuberung.
Damit war eine lange Entwicklung an ihr Ende gekommen. Sie hatte ihren Ursprung weniger in vormodernen, von der frühneuzeitlichen Ständegesellschaft ererbten Formen sozialer Ausschließung, sondern in der dauerhaften Autonomie und den weitreichenden Vollmachten, welche die Polizei in der Mehrzahl der deutschen Staaten vom Zeitalter des Absolutismus geerbt hatte, Vollmachten, die sie benutzte, um die unterschiedlichsten Menschen mit abweichendem Verhalten zu drangsalieren und deren soziale Ausschließung zu perpetuieren. Auch das Scheitern der Strafrechtsreform im 19. Jahrhundert, obwohl Deutschland damit keineswegs allein stand, hatte seinen Teil dazu beigetragen. Aber es waren der Einbruch rassistischer, sozialdarwinistischer und eugenischer Denkweisen in die Justiz-, Strafvollzugs- und Sozialbehörden um die Jahrhundertwende, die Medikalisierung dieser theoretischen und praktischen Felder sowie ihre Politisierung während der Weimarer Republik, die Deutschland auf den verhängnisvollen Weg zur unbefristeten Inhaftierung, zur Sterilisation und schließlich zur Massenvernichtung devianter Gruppen führten. Von diesen Schritten wäre wahrscheinlich nur der radikalste, der Massenmord, unterblieben, wären die Nationalsozialisten 1933 nicht an die Macht gekommen. Denn Unterdrückungsprogramme bis hin zur Zwangssterilisation, die sich gegen die unterschiedlichsten gesellschaftlich Ausgegrenzten richteten, wurden in den Zwischenkriegsjahren auch in anderen Ländern durchgeführt, von Schweden bis zu den Vereinigten Staaten, wenngleich in sehr viel kleinerem Umfang als in Deutschland. Erst in Deutschland wurde der Massenmord staatliche Politik, und er fing nicht mit den Juden an, sondern 1939 mit den geistig und körperlich Behinderten.
Aus einer historischen Langzeitperspektive betrachtet, waren die Zwangsunterbringung, die Sterilisation und die Vernichtung gesellschaftlicher Außenseiter in Deutschland also die Folgen von Moderne, politischer Mobilisierung und vermeintlich wissenschaftlichem Fortschritt in der Zeit von etwa 1890 bis 1940.43 Der Prozess war kein Rückfall in die Barbarei. Ihn als solchen zu bezeichnen, heißt, den Begriff Barbarei in einem moralischen und nicht in einem historischen Sinne zu verwenden und sich damit den Weg zu einem sachkundigen, historischen Verständnis der Wesensart des nationalsozialistischen Exterminismus zu verbauen. Barbarei als zentrales begriffliches Instrument zum Verständnis des „Dritten Reiches“ einzusetzen, heißt, moralische Verurteilung mit Überlegung zu verwechseln. Die nationalsozialistische Vernichtungspolitik stattdessen als einen Aspekt des janusköpfigen Phänomens der Moderne aufzufassen, bedeutet das Eingeständnis, dass die Modernisierung eine Schattenseite hatte, dass sie – wie Marx und Engels vor langer Zeit erkannten – sowohl ihre Opfer als auch ihre Nutznießer hatte. Dabei geht es nicht darum, das Konzept der Modernisierung so lange umzuschreiben, bis es zur Gänze aller positiven Konnotationen entleert ist.44 Es gilt vielmehr anzuerkennen, dass Wissenschaft an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten und am deutlichsten vielleicht in Deutschland zwischen 1890 und 1940 sowohl eine destruktive als auch eine konstruktive Kraft war und dass, was manche als sozialen Fortschritt verstanden, andere als Diskriminierung, Unterdrückung, Leid und Tod erlebten.