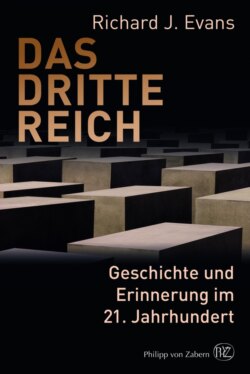Читать книгу Das Dritte Reich - Richard Evans - Страница 9
2. Imperiale Träume
ОглавлениеNoch vor einigen Jahrzehnten befassten sich Historiker, die nach den tieferen Wurzeln von Theorie und Praxis des Nationalsozialismus suchten, mit den Brüchen und Diskontinuitäten in der deutschen Geschichte: der gescheiterten Revolution von 1848; der Blockierung demokratischer Politik nach der Einigung 1871; der fortgesetzten Dominanz aristokratischer Eliten über einen gesellschaftlich und politisch trägen Mittelstand; der etablierten Macht des traditionell autoritären und kriegerischen preußischen Soldatentums – kurz, mit allem, was, wie sie behaupteten, Deutschland schließlich bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs von anderen europäischen Großmächten unterschied und es auf einen „Sonderweg“ in die Moderne führte, der nicht in der Schaffung eines demokratischen politischen Systems und einer offenen Gesellschaft endete, wie sie zu einer industriellen Wirtschaft gehören, sondern im Aufstieg und Triumph des „Dritten Reiches“.
Solche Behauptungen waren spätestens in den 1990er-Jahren diskreditiert, als klar wurde, dass das Bürgertum des kaiserlichen Deutschland alles andere als träge gewesen war, seine politische Kultur lebhaft und engagiert, und die aristokratischen Eliten bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs ihre Macht größtenteils bereits verloren hatten. Es zeigte sich, dass die Revolution von 1848 die deutsche politische Kultur durchaus von Grund auf verändert und nicht bloß die alte Ordnung wiederhergestellt hatte. Vergleiche mit anderen Ländern offenbarten beispielsweise in Großbritannien ähnliche Defizite bei der sozialen Mobilität und Offenheit, in Frankreich Tendenzen zum Autoritarismus und in Österreich einen dominanten Militarismus. Wenn es aber keinen deutschen „Sonderweg“ von der Entstehung des Nationalstaats zum Aufstieg des „Dritten Reiches“ gegeben hat, worauf sollten Historiker stattdessen ihr Augenmerk richten?
Im Laufe der letzten Jahre ist zunehmend klar geworden, dass eine Antwort nur finden kann, wer den Blick ausweitet und die deutsche Geschichte nicht in einem innerdeutschen oder auch europäischen Kontext betrachtet, sondern im Kontext globaler und vor allem kolonialer Entwicklungen im Viktorianischen Zeitalter und danach. Diese Sicht auf die deutsche Geschichte ist vielleicht erst heute möglich, da wir uns der Globalisierung als eines zeitgenössischen Phänomens sehr bewusst geworden sind, und sie hat viele wichtige neue Deutungen und eine wachsende Anzahl bedeutender Forschungsarbeiten hervorgebracht, die Deutschlands Verhältnis zur Welt im 19. Jahrhundert mit dem nationalsozialistischen Versuch, sie zu beherrschen, in Verbindung bringen. Die Ergebnisse dieser Forschungen hat nun Shelley Baranowski in einer beeindruckenden und überzeugenden neuen Synthese mit dem Titel Nazi Empire (2011) zusammengeführt. Die Autorin war zuvor für stärker spezialisierte Studien bekannt, insbesondere für ein ausgezeichnetes Buch über die NS-Organisation „Kraft durch Freude“.
Baranowskis Erzählung setzt Mitte der 1880er-Jahre ein, als Bismarck widerstrebend der Errichtung kolonialer Schutzgebiete zustimmte, um die Unterstützung der Nationalliberalen und Freikonservativen im Reichstag zu gewinnen. Bismarck hatte Bedenken ob der finanziellen und politischen Verpflichtung, die eine wirkliche Kolonisierung bedeutete, aber er wurde bald von imperialistischen Enthusiasten, Kaufleuten und Abenteurern überflügelt, und als er 1890 aus dem Amt gedrängt wurde, besaß Deutschland ein ausgewachsenes Überseereich. Bei Lichte besehen hatte sich das Deutsche Kaiserreich allerdings mit dem zu begnügen, was ihm Briten und Franzosen nach dem „Wettlauf um Afrika“ übrig gelassen hatten: Namibia, Kamerun, Tanganjika, Togo; anderswo auf der Welt Neuguinea und verschiedene Pazifikinseln, wie Nauru und der Bismarck-Archipel. Eine jüngere Generation von Nationalisten, die Bismarcks Gespür für die Unsicherheit des neu geschaffenen Reiches nicht teilten, klagten, das Imperium könne allenfalls mit dem derzeitigen spanischen oder dem portugiesischen mithalten und sei damit einer europäischen Großmacht kaum würdig.
Überdies erwiesen sich jene Kolonien, die Deutschland letztlich besaß, in mehr als einem Fall als besonders schwer zu führen. Das Kolonialregime reagierte mit einer Politik extremer Härte. Gemäß der preußischen Militärdoktrin war die vollständige Vernichtung der feindlichen Streitkräfte das Hauptziel eines Krieges, aber in den Kolonien vermengte sich diese Ansicht mit Rassismus und einer Furcht vor Guerilla-Angriffen zu einer völkermörderischen Mentalität, die auf Unruhen und Aufstände mit einer Politik der totalen Auslöschung reagierte. Zu den dabei angewendeten Methoden gehörte das bewusste Aushungern durch die Zerstörung von Ernten und Dörfern, was in der deutschen Kolonie Tanganjika während des Maji-Maji-Aufstands zu mehr als 200.000 Todesfällen führte. Noch berüchtigter war, was in Namibia geschah, wo Herero und Nama ohne Vorräte in die Wüste getrieben wurden, man ihre Wasserlöcher vergiftete und ihr Vieh beschlagnahmte; sie starben an Krankheiten und Unterernährung. Auf die Unterwerfung folgte ein Apartheidsregime mit Gesetzen und Verordnungen, welche die Vermischung der Ethnien untersagten und Afrikaner zu schlecht bezahlten Tagelöhnern degradierten.
Darüber hinaus hatte die deutsche Politik bereits angefangen, sich nach neuen Kolonien umzusehen. Doch wo sollten diese zu finden sein? Unter dem „persönlichen Regiment“ Kaiser Wilhelms II. begann Deutschland im Jahr 1898 mit dem Bau einer großen Kriegsflotte. Das Hauptaugenmerk lag auf schweren Schlachtschiffen und nicht auf leichten, beweglichen Kreuzern, und Großadmiral Alfred von Tirpitz, der Schöpfer der Flotte, verfolgte dabei die hochriskante Strategie, auf eine Konfrontation à la Trafalgar in der Nordsee hinzuarbeiten oder zumindest mit einem solchen Szenario zu drohen. Ziel war es, den Briten eine Niederlage beizubringen oder sie handlungsunfähig zu machen, weil ihre Seeherrschaft als Haupthindernis für den deutschen imperialen Ruhm galt. Dadurch sollten sie bewogen werden, einer Expansion des deutschen Übersee-Imperiums zuzustimmen. Deutschland verfolgte nun insgesamt eine aggressive „Weltpolitik“, die darauf abzielte, seine Stellung zu verbessern und einen „Platz an der Sonne“ zu erlangen, der mit dem anderer europäischer Mächte vergleichbar war. Bald schon kochten im Gemisch der verschiedenen politischen Interessen unkontrollierbare imperialistische Leidenschaften hoch, die sich auf Gebiete in Übersee ebenso richteten wie auf Europa.
Ein großes Stück von Polen war bereits im 18. Jahrhundert annektiert worden und gehörte seither zu Deutschland, doch nun ermunterte die Regierung sogenannte „Volksdeutsche“, sich in Gebieten mit überwiegend polnischsprachiger Bevölkerung niederzulassen. Aber obwohl während des Kaiserreichs 130.000 dorthin zogen, waren das längst nicht genug, um die 940.000 „Volksdeutschen“ zu ersetzen, die zwischen 1886 und 1905 auf der Suche nach einem besseren Leben in den Westen des Reiches abwanderten. Unzufrieden mit dieser Situation, fingen radikale Nationalisten an, einen Krieg im Osten zu fordern, der die Slawen unterwerfen und Millionen dort lebende und „gefährdete“ Deutschsprachige vor der „Russifizierung“ oder „Magyarisierung“ retten würde, indem er sie in einem stark erweiterten Reich zusammenschlösse. Der mächtige Alldeutsche Verband ging noch weiter und drängte die Regierung, die Annexion Hollands, Flanderns, der Schweiz, Luxemburgs, Rumäniens und des Habsburgerreiches in Erwägung zu ziehen, die man allesamt für „deutsche“ Länder hielt, und im selben Zuge Deutschlands jüdischer Minderheit die Bürgerrechte zu entziehen. Sobald die deutsche Vorherrschaft über Europa verwirklicht wäre, würde die Expansion des Übersee-Imperiums zwangsläufig folgen.
Unter solchen Einflüssen griff ein Sozialdarwinismus in Regierungskreisen zunehmend um sich, demnach die internationalen Beziehungen durch einen Kampf zwischen Rassen – der germanischen, slawischen, lateinischen – ums Überleben und letztendlich um die Vorherrschaft bestimmt seien und Deutschland offenkundig ein großes Kolonialreich gebühre. Trotzdem widersetzten sich die beiden größten politischen Parteien, die marxistisch orientierten Sozialdemokraten und das katholische Zentrum, weiterhin der Kolonialideologie und verurteilten die deutschen Gräueltaten in den Kolonien um 1905/06 heftig. Im Jahr 1912 gelang es diesen Parteien zusammen mit Teilen der Freisinnigen Volkspartei Gesetzesinitiativen in Deutschland gegen Mischehen und gegen die Universalität der Menschenrechte zu vereiteln. Das später verabschiedete Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli 1913, das Staatsangehörigkeit nicht abhängig vom Geburtsort, sondern von der „Gemeinsamkeit der Abstammung“ definierte – beispiellos unter den europäischen Nationen – wurde hingegen nicht verhindert.
Der Druck vonseiten der Alldeutschen erleichterte der Regierung 1914 den Kriegseintritt, und auch die sozialdarwinistischen Überzeugungen einiger der Hauptakteure hatte jede Motivation, nach einem friedlichen Ausweg aus der Krise zu suchen, geschwächt. Schon bald nach Kriegsausbruch, noch im September 1914, formulierte die Regierung ein geheimes Programm, das sowohl auf größere territoriale Erwerbungen und wirtschaftliche wie militärische Unterwerfung des größten Teils Europas als auch auf Aneignung der französischen und portugiesischen Besitzungen im Afrika südlich der Sahara abzielte. Diese Ziele gingen weit über die der Briten und Franzosen hinaus, doch getrieben von der militärischen Pattsituation im Westen, der alliierten Kontrolle der Meere und der wachsenden Lebensmittelknappheit zu Hause, verlangten Hardliner in der politischen Führung noch weiter reichende Annexionen.
Unterdessen wurde einerseits die deutsche Herrschaft in den besetzten europäischen Gebieten noch brutaler, andererseits brachte das Militär Deutschland selbst stärker unter seine Kontrolle. Nach der Oktoberrevolution 1917 und der tatsächlichen Kapitulation der Russen in Brest-Litowsk im März 1918 gingen mehr als zweieinhalb Millionen Quadratkilometer und 50 Millionen Menschen, zusammen mit dem größten Teil der Kohle-, Eisenerz- und Öl-Lagerstätten Russlands sowie der Hälfte seiner Industrie, an Deutschland und die mit ihm verbündete Türkei verloren. Eine Million deutsche Soldaten halfen bei der Durchsetzung einer erbarmungslosen Militärdiktatur in den besetzten Gebieten, die sich von Estland im Norden über weite Teile Weißrusslands und der Ukraine bis zur Schwarzmeerküste im Süden erstreckten. Die wirtschaftliche Ausbeutung und die brutale Unterdrückung nationaler Bewegungen gingen einher mit der Auferlegung einer neuen rassischen Ordnung. In ihr wurden die Bewohner dieser Gebiete ausdrücklich als Bürger zweiter Klasse behandelt. Diese Politik deutete bereits auf das Regime voraus, welches die Nationalsozialisten ein Vierteljahrhundert später etablieren würden.
Mit der Friedensregelung im Versailler Vertrag, die auf die Niederlage von 1918 folgte, verlor Deutschland sämtliche Kolonien in Übersee, 13 Prozent seines Territoriums in Europa, darunter Elsass-Lothringen im Westen, das an Frankreich fiel, sowie die Industriegebiete im Osten, die dem neuen, „wiedergeborenen“ polnischen Staat zugeschlagen wurden, und fast sein gesamtes Kriegsgerät. Seine Streitkräfte wurden auf 100.000 Mann begrenzt, und die Regierung musste gewaltigen Reparationszahlungen für die im Krieg verursachten wirtschaftlichen Schäden zustimmen. Diese Bedingungen sorgten zunächst für allgemeine Fassungslosigkeit und dann für Empörung; schließlich sei der Krieg zu Ende gegangen, als deutsche Truppen noch auf fremdem Boden standen, und die militärische Niederlage sei alles andere als total gewesen. Überdies besetzten britische und französische Truppen für den größten Teil der 1920er-Jahre das Rheinland und lieferten damit eine ständige Erinnerung an Deutschlands Unterwerfung – eine Tatsache, die von Historikern oft übersehen wird. Als die Deutschen 1923 mit den Reparationszahlungen in Rückstand gerieten, wurde ein belgisch-französisches Expeditionskorps ins Ruhrgebiet, das industrielle Zentrum des Reiches, entsandt, um wichtige Rohstoffe zu beschlagnahmen, was für weiteren Unmut sorgte. Doch lief dies wirklich, wie Baranowski behauptet, auf eine „Kolonisierung“ Deutschlands durch die Alliierten hinaus? Deutsche Propaganda-Attacken gegen die Ruhrbesetzung konzentrierten sich stark auf die „Rassenschande“, für die symbolhaft Frankreichs Einsatz von Soldaten aus seinen afrikanischen Kolonien stand.
Bis Mitte der 1920er-Jahre waren die gewalttätigen Zusammenstöße zwischen revolutionären und konterrevolutionären Kräften abgeklungen, die unmittelbar nach dem Krieg dazu geführt hatten, dass Maschinengewehre und Panzer auf den Straßen deutscher Großstädte präsent blieben. Hinzu kam, dass sich die Wirtschaft stabilisiert hatte. Das Verhandlungsgeschick Gustav Stresemanns, des langgedienten Außenministers, brachte schließlich die Wiederaufnahme in die internationale Gemeinschaft, die Neuverhandlung der Reparationen und den Abzug der Besatzungstruppen. Es gibt kaum Anhaltspunkte dafür, dass die Deutschen allgemein der Ansicht gewesen seien, das Land sei „kolonisiert“ worden; nur unter extremen Antisemiten herrschte die Überzeugung, dass die Weimarer Republik durch eine internationale jüdische Verschwörung kontrolliert würde, aber selbst hier stößt man nur selten auf die Terminologie der Kolonisierung. Man darf zudem nicht vergessen, dass die NSDAP bei den Reichstagswahlen 1928 mit weniger als drei Prozent der Stimmen derart schlecht abschnitt, dass sie sich bei den nachfolgenden Wahlen mit ihrem heftigen Antisemitismus zurückhielt. Auch die antijüdischen Unruhen der Nachkriegsjahre waren weniger weit verbreitet und weniger repräsentativ für die öffentliche Meinung, als Baranowski unterstellt.
Erst nachdem die große Wirtschaftskrise der frühen 1930er-Jahre Banken und Unternehmen zugrunde gerichtet und mehr als ein Drittel der Erwerbsbevölkerung arbeitslos gemacht hatte, gewannen die Nationalsozialisten massive Unterstützung; und erst als sie an die Macht kamen, als Koalitionspartner konservativer Eliten, denen es darum ging, ihre Pläne zur Zerstörung der Weimarer Demokratie zu legitimieren, offenbarten die Nationalsozialisten abermals ihren tief sitzenden Antisemitismus und setzten ihn mit einer Reihe von Verordnungen und Gesetzen nach und nach in die Tat um, unterstützt durch SA-Gewalt vor allem gegen ihre Gegner auf der Linken. Im Zentrum der Idee eines deutschen Imperiums standen mittlerweile nicht mehr überseeische Kolonien, für die sich während der Weimarer Jahre nur kleine und machtlose Lobbygruppen in der Minderheit interessiert hatten, sondern die Vision eines europäischen Imperiums, eines Imperiums, das auf die Erfahrungen des Ersten Weltkriegs baute, aber weit darüber hinaus ging.
Dennoch blieb die Erinnerung an Deutschlands Übersee-Imperium haften und wurde von den Nationalsozialisten sogar wiederbelebt. Wie sehr beeinflusste die koloniale Erfahrung die Vernichtungspolitik unter Hitler? Baranowski behandelt diese zentrale Frage auf subtile und ausgewogene Weise, wobei sie einige Übertreibungen der vehementesten Vertreter der Kontinuitätsthese vermeidet, aber trotzdem einige ihrer zentralen Elemente beibehält. In der ersten Hälfte des Jahres 1933 richteten die Nationalsozialisten Hunderte von Konzentrationslagern ein, in die sie mehr als 100.000 ihrer politischen Gegner trieben; sie setzten sie zur Zwangsarbeit ein und behandelten sie so brutal, dass unzählige starben. Aber diese Lager hatten wenig Ähnlichkeit mit jenen, in denen man die Herero in Namibia hatte hungers sterben lassen, und ohnehin war die Idee, Zivilbevölkerungen in Gefangenenlagern zu konzentrieren, keinesfalls eine deutsche Erfindung. Sie ging mindestens so weit zurück wie die US-Feldzüge gegen die Indianer in den 1830er-Jahren.
Die Nationalsozialisten verstanden ihre Lager in der Tat als eine Art Instrument zur Aufstandsbekämpfung, aber ihr Hauptzweck war es, Gegner des Regimes einzuschüchtern und „umzuerziehen“. Diese wurden so lange brutal behandelt, bis sie einwilligten, keinen weiteren Widerstand mehr zu organisieren. Bis 1934 waren fast alle Insassen freigelassen worden; zu diesem Zeitpunkt war die Aufgabe der Repression der regulären Polizei, den Gerichten und dem staatlichen Gefängnissystem übergeben worden. Wenn es also, wie Baranowski anmerkt, einen kolonialen Vorläufer gab, so war er vollkommen verändert worden und weit stärker der politischen Polarisierung Europas nach der Oktoberrevolution zuzuschreiben – etwa zur selben Zeit tauchten ähnliche Einrichtungen in der Sowjetunion auf, die keineswegs auf koloniale Vorläufer zurückzuführen sind.
Zu der von den Nationalsozialisten verfolgten Rassenpolitik gab es allerdings keine Parallele in der Sowjetunion. In welchem Maße aber waren hingegen die Einführung der „Rassenhygiene“, die Gesetze gegen Mischehen und sexuelle Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden sowie die Zwangssterilisation von bis zu 400.000 „erblich minderwertigen“ Deutschen auf Deutschlands Kolonialerfahrung zurückzuführen? Wie Baranowski überzeugend ausführt, waren die vor 1914 in Deutsch-Südwestafrika verabschiedeten Gesetze gegen die „Rassenmischung“, die segregationistischen Antworten auf Aufruhr in den Kolonien und die von den Alldeutschen während der Debatten über das Reichs- und Staatsbürgergesetz von 1912 befürworteten extremen Maßnahmen tatsächlich verblüffende Vorläufer der nationalsozialistischen Politik. „Der Imperialismus“, merkt sie an, „verknüpfte die beiden bürgerlichen Phobien gegen Sozialismus und Rassenmischung, bei denen die Vorstellung vom Arbeiter ganz der vom ‚Eingeborenen‘ entsprach.“ Die Dekolonisierung Deutschlands im Jahr 1919 beseitigte die frühere Unterscheidung zwischen kolonialem und einheimischem Recht und verstärkte Ängste, dass „fremde Rassen“ wie Juden und „Zigeuner“, die deutsche Rasse daheim verunreinigen würden. Die Vorstellungen waren die gleichen, nur die Praxis wurde radikalisiert.
Auf vielen unterschiedlichen Feldern, darunter die Medizin, die Eugenik und die Rassenanthropologie, gab es auch personelle Kontinuitäten. So nutzte der Anthropologe Eugen Fischer seine Forschungen über „gemischtrassige“ Gruppen in Deutsch-Südwestafrika vor dem Ersten Weltkrieg, um sich gegen die „Rassenmischung“ im „Dritten Reich“ auszusprechen. Nach 1933 spielten medizinische Forscher, die an Fischers Institut ausgebildet worden waren, etwa der Auschwitz-Arzt Josef Mengele, eine bedeutende Rolle bei der Realisierung eugenischer Maßnahmen. Doch am Ende überwiegen laut Baranowski die Brüche gegenüber solchen Kontinuitäten. Während sie überzeugende Gründe gegen den Trend eines Großteils der jüngeren historischen Meinung vorbringt, besteht sie wiederholt auf der zentralen Bedeutung von Terror und Gewalt für die Machtergreifung und -ausübung der Nationalsozialisten, die einen entscheidenden Bruch mit der Wohlfahrtsverwaltung und der Polizeiarbeit Weimars markierten. Die Zerschlagung der Arbeiterbewegung, die Verhaftung oder Exilierung jüdischer und liberaler Gesundheits- und Wohlfahrtsbeamter und, so hätte sie hinzufügen können, die Zerstörung von freier Presse und Nachrichtenmedien beseitigten die größten Hürden etwa für die Durchführung eugenischer Maßnahmen durch den Staat. Zugleich trieb das rasche Wachstum der SS unter Himmler mit ihrer fixen Idee der Rasse die Durchführung politischer Maßnahmen wie der Massensterilisierung von angeblich „Geisteskranken“ und Behinderten in weltweit ungekanntem Maße voran. Einzigartig ist auch, dass diese Politik in Verbindung mit der Ausschließung von Juden aus dem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben den Weg ebnen sollte für einen imperialistischen Expansionskrieg im Osten. Während des Krieges selbst wurde aus dieser Politik dann ein Massenmord, bei dem 200.000 als körperlich oder geistig behindert eingestufte Deutsche von nationalsozialistischen Ärzten ermordet wurden.
Der enge Zusammenhang von Rassenpolitik und Krieg wurde von 1939 an noch deutlicher. Gestützt auf jüngere Forschungen, zeigt Baranowski im Detail, dass der Einmarsch in Polen von Anfang an darauf abzielte, die polnische Nation zu zerstören. Es folgten Massenhinrichtungen, denen Polen und Juden zum Opfer fielen. Sie wurden aus ihren Häusern und Wohnungen vertrieben, ihr Besitz wurde enteignet, oder sie wurden – wie im Falle der Polen – als Zwangsarbeiter nach Deutschland verschleppt. Die Deutschen machten beinahe keinen Unterschied zwischen Kombattanten und Zivilisten, und gaben sich im Osten keinerlei Mühe Kriegsrecht oder -konventionen zu befolgen, an die sie sich – mit seltenen Ausnahmen – im Westen durchaus hielten. Soldaten von SS und Wehrmacht gleichermaßen betrachteten die Polen insgesamt als „Eingeborene“ und Juden darüber hinaus als eine minderwertige Spezies. All dies wiederholte sich in größerem Ausmaß nach dem Einmarsch in die Sowjetunion im Juni 1941 und spiegelte nicht nur die vor 1914 selbst in der Arbeiterschaft weit verbreiteten Vorurteile gegen Slawen und „Ostjuden“ wider, sondern auch die unter europäischen Eroberern kolonialer Territorien seit der spanischen Invasion Amerikas im 16. Jahrhundert üblichen Praktiken.
Allerdings weist Baranowski darauf hin, dass „die massenhafte Vertreibung oder Ermordung einheimischer Bevölkerungen“ im kolonialen Rahmen des 19. Jahrhunderts „oft auf Grenzkonflikte vor Ort zwischen europäischen Siedlern und indigenen Völkern um Land und Ressourcen folgte“. Die Verwaltungen in den imperialen Mutterländern versuchten oft durchaus, Siedler, die ungezügelt auf Land und Arbeitskräfte aus waren, zurückzuhalten, obwohl sie deren Habgier am Ende meist tolerierten und irgendwann billigten. Selbst die völkermörderische Entscheidung im namibischen Krieg wurde auf lokaler Ebene getroffen, von einem Militärbefehlshaber, der die Vorbehalte des Kolonialgouverneurs und seiner Vorgesetzten in Berlin ignorierte. Daheim aber entfachten koloniale Gräueltaten häufig heftige Kritik.
Im Gegensatz dazu starteten die Nationalsozialisten ihren rassischen Unterwerfungs- und Vernichtungskrieg im Osten ohne die geringste Provokation und ohne jegliche Zweifel oder kritische Stimmen, außer aufseiten einer Handvoll konservativer Wehrmachtsoffiziere. Überdies koordinierten und leiteten sie den ganzen Krieg hindurch Operationen vom Zentrum aus und handelten nach Weisungen von Hitler persönlich. Damit soll nicht bestritten werden, dass es innerhalb der NS-Elite Auseinandersetzungen über die Durchführung der ethnischen Säuberung und Vernichtung gab. Aber die Grundrichtung der Politik war klar und gipfelte 1942 im „Generalplan Ost“, in der Vernichtung von mindestens 30 Millionen und möglicherweise bis zu 45 Millionen Slawen durch Hunger und Krankheit sowie in der Neubesiedlung des größten Teils von Osteuropa durch deutsche Kolonisten. Hier lag er also, wie Baranowski es ausdrückt, der „Platz der Nazis an der Sonne“.
Deutsche Pläne für Afrika, die in den 1930er-Jahren wiederbelebt wurden, als Hitler aufs Neue die Forderung nach Rückgabe ehemaliger Kolonien aufgriff, sahen keine solche Politik des Völkermords vor; vielmehr unterschieden sie sich im Kern kaum von herkömmlichen europäischen Paradigmen kolonialer Entwicklung. Zwar sollten die „Eingeborenen“ von der europäischen Siedlergesellschaft abgesondert werden, aber deutsche Verwaltungsbeamte sollten die indigenen Afrikaner erziehen, ernähren, ihre Gesundheit verbessern und damit die kolonialen Wirtschaften entwickeln, um die Lieferung von Rohstoffen und Nahrungsmitteln für das Mutterland zu gewährleisten. Dies lag zum Teil daran, dass die Nationalsozialisten afrikanische Länder nicht als Hauptziel deutscher Besiedlung ansahen, aber auch daran, dass sie in deren Bewohnern keine Bedrohung ihrer Art sahen, wie sie Slawen und vor allem Juden in der Vorstellungswelt der Nationalsozialisten verkörperten. Diente die Vernichtung der Slawen und Juden in der NS-Politik der Reinhaltung der deutschen Rasse selbst, so spielte dieser Gedanke in der kolonialen Situation keine Rolle. Osteuropa aber durchstreiften SS-Einheiten sogar auf der Suche nach „rassisch wertvollen“ blonden, blauäugigen Kindern, entführten Zehntausende von ihnen und arrangierten ihre Adoption durch deutsche Eltern unter neuer Identität. Schlussendlich war die NS-Politik aber auch in Osteuropa zumindest teilweise von der unmittelbaren Notwendigkeit getrieben, eine ausreichende Lebensmittelversorgung für Deutschland sicherzustellen, dessen Landwirtschaft in keiner Weise in der Lage war, das Reich und seine Armeen zu ernähren. Deshalb radikalisierten die Nationalsozialisten einmal mehr imperialistische Praktiken oder wichen in wesentlicher Hinsicht von ihnen ab, statt sie einfach fortzuführen.
Wie fügt sich die Judenvernichtung in das koloniale Paradigma ein? Natürlich banden radikale Vorkriegsnationalisten den Antisemitismus in ihre Vorstellung von internationalen Beziehungen als einem Darwin’schen Kampf zwischen Rassen ums Überleben und um die Vorherrschaft ein. Die Maßnahmen zur Absonderung, Deportation und Enteignung, denen deutsche und später europäische Juden zum Opfer fielen, hatten sämtlich ihre Vorläufer in den Kolonien. Aber das bewusste Durchkämmen eines ganzen Kontinents und möglicherweise – wie im Protokoll der Wannsee-Konferenz zur „Endlösung der Judenfrage in Europa“ vorgeschlagen – der gesamten Erdoberfläche nach Juden, um sie zur fabrikmäßigen Vernichtung in Gaskammern oder Exekutionsgruben abzutransportieren, war ohne Beispiel.
Klugerweise zieht Baranowski die Behauptungen einiger Historiker in Zweifel, die vor 1914 von deutschen Kolonialbeamten und Militärbefehlshabern begangenen Massenmorde seien nicht nur mit dem späteren NS-Völkermord vergleichbar, sondern hätten gar eine völkermörderische Mentalität geschaffen, die unweigerlich zur „Endlösung“ geführt habe. Sie weist darauf hin, dass andere europäische Mächte eine ähnliche Politik betrieben, die ebenso wie die der Deutschen in erster Linie darauf abzielte, die wirtschaftliche Unabhängigkeit unterworfener Bevölkerungen zu zerstören, sie in fügsame Arbeitskräfte zu verwandeln oder sie zu vertreiben, um Platz für die Besiedlung zu schaffen.
Etwas Ähnliches hatten die Nationalsozialisten in Osteuropa vor, und dabei bedienten sich NS-Verwaltungsbeamte gelegentlich durchaus auch jüdischer Arbeitskräfte für die Kriegswirtschaft, aber langfristig handelte es sich mit ihren Worten dort vor allem um eine langsamere Form der „Vernichtung durch Arbeit“. Obwohl der „Generalplan Ost“ also zweifellos die völkermörderische Vernichtung mehrerer Millionen Slawen vorsah, war er getrieben von ideologischen Imperativen, die sich grundlegend von jenen der „Endlösung“ unterschieden. In Letzteren fungierten die Juden als der „Weltfeind“ – nicht als regionales Hindernis, wie es „Wilde“ darstellen, sondern als Weltverschwörung, die von einem gerissenen und ruchlosen Feind mit dem Ziel der vollständigen Vernichtung des deutschen Volkes initiiert wurde.
Obwohl Baranowski ursprünglich ein Lehrbuch schreiben wollte, hat sie etwas viel Wichtigeres vorgelegt: eine gekonnte und sorgsam differenzierte Synthese einiger der ergiebigsten Ideen, die in der Debatte über die Ursprünge des Nationalsozialismus und seiner Auswüchse in den letzten Jahren aufgekommen sind. Gegenwärtige Besorgnisse widerspiegelnd, konzentrieren sich diese Diskussionen nicht so sehr darauf, wie oder warum die Nationalsozialisten an die Macht kamen, als darauf, was sie taten, sobald sie diese erlangt hatten, vor allem während des Krieges. Aus diesem Blickwinkel beschäftigen sie sich mit recht anders gearteten Fragen als jene, welche die alte These vom „Sonderweg“ aufwarf. Baranowskis Buch macht diese verschiedenen Blickwinkel zweifellos bekannt, die Autorin erörtert mit Scharfsinn und Raffinesse ihr Für und Wider, und ihr Werk sollte von jedem gelesen werden, der sich für den verhängnisvollen und letztendlich exterminatorischen Weg interessiert, den die deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert einschlug.