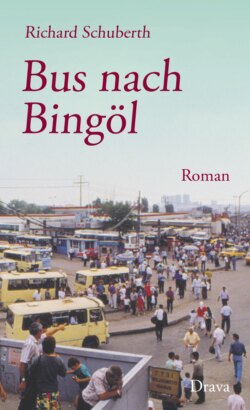Читать книгу Bus nach Bingöl - Richard Schuberth - Страница 16
Oktay und die Liberalen
ОглавлениеAhmet fragte sich nach dem Grund seiner guten Laune. War es das Interesse der jungen Frau an ihm? Oder dass ihm solch ein prägnantes Pamphlet gelungen war, an das er selbst nicht glaubte – noch dazu in einer Sprache, die er nur noch bei seinen Männerabenden in Wien pflegte? Dort redete man nicht nur aus Rücksicht gegenüber den türkischen Freunden Türkisch. Auch nicht deshalb, weil es sich bei den Muttersprachen der Kurden um Dialekte handelte, die untereinander schwer verständlich waren. Und nicht einmal der Umstand, dass die meisten von ihnen von Abstammung her Kurden waren, aber nie Kurdisch gelernt hatten. Einige holten es nach und radebrechten dann in Kurmandschi, obwohl sie aus Gegenden kamen, in denen Zaza üblich war. Die meisten aber plauderten bei ihren Treffen in von Kurden geführten Pizzerias in der Sprache, in der sie politisiert wurden, in der sie Gedichte schrieben und in der auch ihre Helden Nâzım Hikmet, Yaşar Kemal und Aziz Nesin schrieben.
In theoretischen Belangen hatte sich Ahmet Arslan stets unzulänglich gefühlt. Auch wenn er in Wien von Fachkollegen und -kolleginnen konsultiert wurde, schwärte lange noch diese Wunde in ihm. Seine Organisation damals in İstanbul war leninistisch ausgerichtet gewesen. Viele seiner Genossen aber hatten den maoistischen Weg gewählt, der von all den linken Wegen, die die wenigsten, die darauf schritten, auch wirklich verstanden, der dümmste war. Der chinesische Bauernkommunismus sprach die opferbereiten Dorfburschen am meisten an. Moderne, Industrialisierung, Urbanität und Zivilisation waren ihnen fremde Konzepte, und ihre ersten Marxtexte lasen sie wie epische Dichtungen oder Zaubersprüche, die man eingerollt in Glücksamuletten mit sich herumträgt, am liebsten hätten sie diese zur Saz gesungen, so wie sie auf Kurdisch sangen: Bîrnakim ha bîrnakim, riya Lenin bîrnakim – Vergiss nicht, vergiss nicht den Weg Lenins.
Als die Nachrichten von der Kulturrevolution, von Hungersnöten und Staatsterror auch nach Holike, Çemişgezek oder in die Vororte İstanbuls drangen, wandten sich viele von Mao ab und suchten Ersatz. Da die Leninisten und Trotzkisten zu viel umständliches Zeug redeten, fanden sie ihn in Maos europäischer Filiale, bei Albaniens Diktator Enver Hoxha. Ein Genosse hatte ihm das Verhältnis zu diesem neuen Leitstern einmal folgendermaßen erklärt: Wenn es in Tirana regnete, spannten wir in İstanbul die Regenschirme auf.
Ahmet Arslan begann ein Politologiestudium an der Istanbuler Universität und trat der Dev-Yol, einer Nachfolgeorganisation der Dev-Genc, bei. In Wien setzte er sein Studium fort. Hatte er in İstanbul die gesamte Theoriegeschichte bis zur Frankfurter Schule rezipiert (die ihm das größte Kopfzerbrechen bereitete, und das nicht nur wegen der schlechten Übersetzungen), so stürzte er sich in Wien mit Ehrgeiz auf all die neuen französischen Lehren, die bereits in der Türkei die Vorherrschaft des Neomarxismus an den Unis zu unterwandern begannen. Doch fand er in ihnen keinen Halt. In der Wiener Szene gab es zwei Intellektuelle, die er bereits in İstanbul gekannt hatte. Er und sie gehörten völlig verschiedenen Welten an, obwohl der österreichische Blick ihrer aufgeschlossenen Bekannten sie ein und derselben zuordnete. Cahir und Alparslan hatten sich in der Heimat schon die neuen Jargons zugelegt. Sie gehörten zu der Schicht, die Ahmet und die anderen anatolischen Landeier belächelte, wenn diese mit unsicherer Leidenschaft halbverstandene Slogans aus dem marxistischen Fundus predigten. Es waren Jungs aus İstanbuler Bürgerfamilien. Linksliberale – Ahmet und die seinen nannten sie etwas abfällig Liboşlar. Dabei bewunderten die Liboşlar sie, die Genossen und Genossinnen aus Dersim, Gaziantep, Erzurum, Diyarbakır, Hakkari, den Tauros- und den Pontosbergen, und suchten ihre Freundschaft. Intellektuell nahmen die Liboşlar sie nicht für voll. Sie waren deren Indianer. Edle Wilde aus dem Osten. .
Ahmet Arslan verstieg sich wieder einmal in Reflexionen über sein Verhältnis zu den liberalen Genossen, mit denen er noch die eine oder andere Rechnung offen hatte.
Die Liboşlar versuchten sowohl unsere grobschlächtige Unmittelbarkeit als auch unsere naiv-blumigen Redewendungen nachzuahmen. Wir waren ihre Reservoirs für ihr Selbstbild als Revolutionäre: Männlichkeit, Ehre, verträumte Rauheit, Brüderlichkeit, Sazspiel. Sie klaubten uns die Distelkletten von den speckigen Jacketts und steckten sie sich auf ihre bunten Pullis. Mit ihren langen Haaren und Bärten sahen sie wie Banditen aus den Bergen aus, während wir Bergbanditen lange Zeit unsere Scheitel kämmten und Schnurrbärte stutzten, bis wir selbst der Mode erlagen. Dennoch scherzten wir darüber, wie ihre Mütter ihnen vor den Demonstrationen die Mähnen und Schnauzer frisierten und sie sich diese dann, kaum außer Haus, wieder zerrupften. Ausgiebig naschten sie von unserer Entschlossenheit im Straßenkampf. Doch während wir uns mit den Grauen Wölfen Schusswechsel lieferten, warteten sie lieber mit gezückter Pistole hinter der Ecke ab, wie die Schlacht ausging. Trieben wir die Feinde in die Flucht, und meistens taten wir das, kamen sie aus ihren Deckungen hervor, umarmten uns und feierten mit uns den gemeinsamen Sieg. Der Unterschied: Sie gingen nach der Aktion, nach der Demonstration, nach der Schießerei nach Hause, weil Mamas Abendessen auf sie wartete und sie Dallas nicht versäumen wollten. Das, wie mich mein kluger Freund Erol Sentürk aufklärte, gar nicht so dumme Kapitalismuskritik sei, zumindest schön zeige, wie Macht in repressiv-imperialistischen Gesellschaften gestaffelt ist. Ich verstand nichts, ich verstand nur, dass sich wir anatolischen Helden in den Baracken am Stadtrand verstecken mussten. Doch vielleicht nehme ich den Mund zu voll. Denn ich teilte mit zwei anderen Freunden eine Wohnung in Cihangir mit Bosporusblick, und mein Vater finanzierte mein Studium mit, so gut es halt ging. Ich war so etwas wie ein Missing Link zwischen den Liboşlar und den ruhmreichen Bauernterroristen. Und dennoch lud mich Erol Sentürk nie zu sich nach Hause ein. Und die Liboşlar uns Bauern allgemein nicht. Teils weil sie sich für ihren Wohlstand genierten, teils weil sie dort unter sich sein wollten, ihren Deleuze und Guattari diskutieren und die neueste Led-Zeppelin-Scheibe hören wollten. Von uns erwarteten sie alevitische Lieder.Von den wichtigen gesellschaftlichen Fragen des sozialistischen Umbaus der Gesellschaft, der Hegemonien und der Praxen der Macht schlossen sie uns aus. Anstatt ihr Wissen mit uns zu teilen, sahen sie Analphabeten oder moskautreue Totalitäre in uns, was für sie aufs selbe rauslief. Und diese feinen Eselsöhne hatten sogar recht, doch hatten sie kein Recht, rechtzuhaben. In ihren klimatisierten Kinderstuben glaubten sie, bloß eine repressive Demokratie zu erleben, die sich eben wie die USA ihrer linken Opposition erwehren musste, und die es mit friedlichen und demokratischen Mitteln zu einer gerechten Gesellschaft zu transformieren galt. Ich wurde selbst nicht aus ihnen schlau. Für uns verhielten sie sich in ihrem Denken wie bei den Straßenkämpfen. Unsicher wankten sie zwischen linkem Kemalismus, Eurokommunismus, Sozialdemokratie oder Anarchismus hin und her, aber nicht wie wirkliche Zweifler, deren Unentschlossenheit die Ehre selbstquälerischen Denkens ist, sondern eher wie solche, die abwarten, wer angeschossen am Boden zurückbleibt, um dann die Partei des Siegers zu ergreifen. Es stimmt, wir waren totalitär. Das war unser Fehler. Sie waren feig. Das war der ihre. So kann man es belassen.
Ihre Türkei war eine andere als die unsere. Unsere war die der Bauern, Kurden, der Landlosen, Tagelöhner und Getretenen. Wir hatten nichts zu verlieren. Sie ihre Häuser, Plattenspieler und Haare. Ja, wir beteten den Moskauer Katechismus nach, aber wir taten es mit den besten Absichten. Sie wollten den Faschismus nicht wahrhaben. Wir erlebten ihn. Wenn wir uns in den Fabriken gewerkschaftlich organisieren wollten. Wenn wir uns in der Schule weigerten, die Liebesgedichte für Atatürk aufzusagen. Wenn wir einen der Grauen Wölfe abknallten, nachdem er einen der unseren umgelegt hatte, und wenn ein Polizist mal eine blutige Nase abbekam, nachdem er Dutzende unserer Nasen eingeschlagen hatte, warnten sie uns oft vor der Sinnlosigkeit gewaltvoller Eskalationen. Jahrzehnte hatte es gedauert, bis ich erkannte, dass all ihre subtilen, komplizierten Theorien der Gesellschaft auch die Funktion hatten, den einzigen klaren Unterschied zwischen Zivilisation und Barbarei auf der einen, den zwischen Kapital und Arbeit auf der anderen Seite mit interessanten Spekulationen auszupolstern, bis man ihn nicht mehr sah. Darauf bauten sie ihre akademischen und politischen Karrieren.
In Wien dann versuchte ich wie sie zu werden, weil wir dort die Annehmlichkeiten einer sozialen Demokratie genossen. Wir begegneten einander freundlich, doch ich spürte weiter ihre Herablassung. Noch immer war ich ein Indianer in ihren Augen. Und zwar ein Indianer, der den Liboş spielen konnte, das machte mich zu ihrem natürlichen Feind. Denn gegenüber den reinrassigen kurdischen Indianern konnten sie selber ein bisschen den Bruder und den gefühlvollen Anatolier raushängen lassen. Ich aber drang in ihr Revier ein, ich kannte ihre Lieder, durchschaute sie und konnte mich gut ausdrücken, obwohl ich ihnen gegenüber noch immer die alte Unsicherheit verspürte.
Auf Podien, auf die uns wohlmeinende Österreicher einluden, welche unsere unausgesprochenen Konflikte nicht kannten, entwickelten sich kultivierte Gespräche. Die Liboşlar erweckten den Eindruck, als wären wir alte Kumpels, ein Debattierclub gar, der sich wöchentlich trifft. Nach der Podiumsdiskussion wurde nicht politisiert. Wir misstrauten einander. Wir waren noch immer die dummen Radikalinskis und sie die feigen Arschkriecher, die sich mit ihrer seriösen Verbindlichkeit gewinnbringend den Weg zu ansehnlichen Positionen im akademischen und kulturellen Bereich geebnet hatten. Als ich meine Dozentur an der Uni hatte, hofierten sie mich und richteten mich hinter meinem Rücken aus. Als Sozialarbeiter war ich schließlich bedeutungslos für sie.
Ahmet Arslan legte den Kopf in die Nackenstütze und musste schmunzeln. Wie sehr ihn das noch immer bewegt. Wenn er es sich recht überlegte, handelte es sich bei der Gegnerfront der Wiener Liboşlar aus der Türkei doch bloß um eine Handvoll Menschen. Und vielleicht tat er ihnen doch unrecht, denn sie waren zumindest Linksliberale geblieben, während so mancher seiner radikaleren Freunde unpolitisch oder AKP-Sympathisant geworden war.
Noch immer war Ahmet in ihren Augen also das unkorrumpierbare Ausrufezeichen vor ihrer Anpassung. Wie sehr sie ihn überschätzten. Sie wussten offenbar nicht, dass ihm selbst der Hüftspeck der Konformität gewachsen war. Und vielleicht war er es, von dem die abweisenden Signale kamen. In Wirklichkeit wartete er auf die große letzte Aussprache, in welcher er mit ihnen souverän und gut begründet abrechnen würde. Und das wussten sie, und deshalb vermieden sie diese Option durch unverbindliche Höflichkeit, um derentwillen er ihnen einfach grollen musste. Und zeigte er seinen Groll, dann hatten sie gesiegt, weil dann er derjenige war, der die Probleme macht. Er wusste, dass sie es noch immer mit den Kemalisten hielten; es waren dieselben Leute, welche, um von den Grünen und den Multikultifeministinnen gemocht zu werden, jede Kopftuchträgerin mit liberalen Theorien verteidigten, aber beim İstanbultrip mit größter Verächtlichkeit über sie spotteten.
Genug der schlechten Gedanken, dachte sich Ahmet, er müsse noch mit Oktay ins Reine kommen. Drei Sitze vor ihm auf der rechten Seite saß der junge Reservist. Geduldig wartete Ahmet, bis sich Ali nach ihm umdrehen würde. Und als er es tat, konnte er Ahmets Blicken nicht mehr ausweichen. Dieser schlug mit der flachen Hand auf den leeren Sitz neben sich und schickte Oktayein vertrauensseliges Lächeln, das von dessen breitem Kindergesicht erwidert wurde. Oktay kam zurück. Als er sich entschuldigen wollte, wehrte Ahmet mit einer eindeutigen Handbewegung ab. Eine halbe Stunde plauderten die beiden in bester Eintracht, ehe sie bei Sonnenuntergang in Ankara einfuhren und es Zeit war, Abschied zu nehmen. Sie umarmten einander. Dann verließ der Rekrut den Bus. Er wurde draußen von einem jungen Mann und dessen Frau erwartet. Oktay blickte nicht mehr zurück. Ahmet stellte sich vor, wie man den Reißverschluss über Oktays bleichem Gesicht zuzieht, wenn er dereinst seinen Eltern überstellt wird.
Ahmet überlegte sich, ob er sich zu Dilek setzen sollte, denn eine gierige Spätnachmittagswollust hatte in ihm das Bedürfnis entfacht, ihr nah zu sein, sie zu riechen, seinen Oberschenkel an ihrem zu reiben. Er blickte zurück und sah sie mit offenem Mund schlafen. Auch recht.
Als der Bus Ankara verließ, hatte sich blaue Dunkelheit über das Land gelegt.