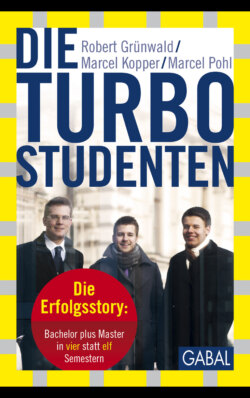Читать книгу Die Turbo-Studenten - Robert Grünwald - Страница 8
2. An Bologna scheitern oder das Steuer selbst in die Hand nehmen
ОглавлениеFehlende Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Hochschulen
An dieser Stelle scheint eine weitere hochschulpolitische Zwischenüberlegung nötig. Ist es nicht paradox, in Zeiten eines durch die Bologna-Studienreform ohnehin beschleunigten Hochschulstudiums für den Turbo-Abschluss zu plädieren? Wäre es nicht im Sinn einer soliden Bildungsstrategie, sich gerade angesichts umgreifender Beschleunigungsprozesse in Sachen Bildung für Verlangsamung des Studiums einzusetzen, für mehr Zeit bei der Bewältigung von modularisierten Arbeitsbelastungen, für mehr Vertiefung und Qualität in den Lerninhalten und letztlich auch mehr zeitlichen Spielraum für Zusatzprogramme wie Auslandsaufenthalt oder berufsspezifisches Praktikum?
Dem gegenüber stehen einerseits die gewachsenen Qualifikationsanforderungen an einem dynamisch wachsenden Arbeitsmarkt, die gestiegenen Anforderungen von Unternehmen an persönliche und fachliche Flexibilität. Andererseits ist ein wichtiges Ziel auch der Verfechter der traditionellen Bildungsidee längst noch nicht eingelöst: die Ersetzung von Verordnungen, Reglementierungen, bürokratischen Systemvorgaben durch Anreizsysteme, welche die Selbstverantwortlichkeit, Eigeninitiative und Motivation der Studierenden fordern und befördern. Ebenso wenig kann von einer gesteigerten Mobilität und Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Hochschulen und Hochschularten (öffentlich vs. privat) die Rede sein. Nicht einmal die hochschulübergreifende Anerkennung zertifizierter Abschlüsse ist von Bundesland zu Bundesland für jeden Studierenden heute gesichert.
Wer die aktuellen Debatten im Kontext des zehnjährigen Bologna- Reform-Jubiläums betrachtet, könnte daher tatsächlich zu dem Ergebnis kommen, dass nur ein radikaler Kurswechsel innerhalb des europäischen Reformprojekts »Bologna« dazu führen wird, dass die Reform in absehbarer Zeit jene Ziele erreicht, deren Umsetzung sie bis heute für Studierende wie Hochschulverantwortliche schuldig geblieben ist. Das bedeutet allerdings, im Warten auf politische Lösungen wertvolle Zeit und Selbstinitiative zu verlieren. Und auf weitere Verlangsamung zu setzen, birgt in diesem Zusammenhang auch die Gefahr, die seit der Bologna-Reform erhöhte Bürokratisierung (ECTS-System, Zertifizierungen etc.) weiter zu befördern. Wer sollte daran ernstlich ein Interesse haben? So bleibt die Suche nach aktiven und selbstverantwortlichen Auswegen aus der europäischen Reform- Sackgasse in unseren Augen das Gebot der Stunde.
Boykott und Unmut gegen Pseudo-Reform
Das Ziel, Studenten beschleunigt zum Abschluss zu führen, gehörte zwar zu den ursprünglichen Leitideen des hehren Bologna-Reformprojekts. Nach einem ganzen Jahrzehnt verpasster Änderungschancen wird heute jedoch im Tenor bilanziert, dass die Rahmenbedingungen für das Studieren nicht wirklich der veränderten gesellschaftlichen Wirklichkeit angepasst wurden. Was aber bleibt Positives von einer Reform zu halten, wenn sie genau das nicht leistet?
Statt die Probleme bei der Wurzel zu packen, verlieren sich die hochschulpolitischen Debatten zwischen Studierendenvertretern und Kultusministern, Professoren, Hochschulrektoren und Hochschulleitungen bis heute in gegenseitigen Schuldzuweisungen für eine ehrgeizige, jedoch verpatzte Reform. So bleibt viel Reformpotenzial häufig entweder in Unmutsbekundungen, anklagender Kritik oder auch gleich in Boykotthaltungen stecken – mit dem aus unserer Sicht entscheidenden Nachteil, dass der Gestaltungsspielraum der Reform bis heute noch nicht radikal von den Betroffenen selbst – den Studierenden – in ihrem Sinn genutzt werden kann.
Vor allem zwei der wesentlichen Grundforderungen der Studienstrukturreform sind bis heute nicht eingelöst und wirken sich hemmend auf die persönliche Motivation und letztlich die individuelle Studiergeschwindigkeit aus: die Entscheidungsautonomie (als Gestaltungstätigkeit beispielsweise hinsichtlich Zeiteinteilung und Studienorganisation) und die Flexibilität. Das bedeutet, dass die eigentlich von der Reform betroffenen Akteure im Hochschulsystem mit ihren Interessen außen vor bleiben. Das betrifft selbstverständlich auch das individuelle Bedürfnis nach der eigenen Leistungsfähigkeit und danach, mit der eigenen Geschwindigkeit zu studieren. Wer schneller abschließen will, hat es nicht automatisch leichter – unser Studienprojekt hat unter anderem genau das zum Ergebnis. Vielfältige Bürokratisierungen, formelle und formaljuristische Barrieren (zum Beispiel unflexible Verträge) stehen dem Versuch im Wege, das zu leisten, wozu ein Studium auch dienen sollte: seine individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten so auszubauen, dass Leistungsorientierung und Selbstverantwortung zum Bestandteil der Persönlichkeitsentwicklung werden und Gesichtspunkten der Effizienzsteigerung gleichzeitig nicht im Wege stehen. Weder der schnellere noch der langsamere Student sind grundsätzlich die besten Studenten. Sie können es aber dadurch werden, wenn sie ihre Potenziale im Studium besser nutzen. Das Hochschulsystem sollte ihnen für dieses Anliegen die besten organisatorischen, finanziellen und personellen Ressourcen zur Verfügung stellen.
Drei Wege aus dem Systemzwang
Somit stellt sich die entscheidende Frage: Kann das Turbo-Studium ein Ausweg aus einer scheinbar verfahrenen Reformsituation sein? Unsere Antwort fällt eindeutig aus: ja. Bei einer methodischen Betrachtung der jetzigen Reformsituation bleiben nach unserer Einschätzung genau genommen drei Wege, auf denen man sich gemäß der persönlichen Prioritäten zu dem durch das Reformmodell vorgegebenen Systemzwang verhalten kann:
Man kann erstens den systemkritischen »konservativen« Weg von unten favorisieren. Dann wird man im Humboldt’schen Geist für die Restauration des langsamen Studiums und für das Rückgängigmachen der Ökonomisierung der Bildung plädieren – und die bedingt zweckbefreite Bildung und Reifung am »Rohstoff Bildung« zum erklärten Hauptziel des Studierens gegen das »Humankapital« hochhalten. Als Hauptakteure dieser Richtung kommen in erster Linie die etablierten Professoren und Lehrstuhlverantwortlichen in Betracht, denn nur sie können diese strukturverändernden Maßnahmen hochschulpolitisch auch umsetzen.
Man kann zweitens den systemerhaltenden Weg in der Mitte suchen, das heißt, sich mit dem Gegebenen abfinden und sich zwischen den Zumutungen der modularisierten Studiengänge und ihrer vielfach als überfrachtet empfundenen Leistungsanforderungen so »durchwursteln«, dass man den Prüfungsanforderungen nachkommt. Mit dem Nachteil, dass man bei dieser Art von »Durchstudieren« viel Energie, Engagement und Kreativität verschenkt. Eigene Zielstellungen in diesem Modell einer studentischen Fremdbestimmung zu entdecken, fällt erfahrungsgemäß den meisten Studierenden sehr schwer.
Schluss mit den Klagen und Schuldzuweisungen!
So bleibt drittens ein radikalisierender Weg von unten – und das ist der hier von uns als Turbo-Studium propagierte. Er setzt den Entschluss voraus, als Studierender das Ruder wieder selbst in die Hand zu nehmen, anstatt für das Scheitern der Bologna-Reform immer wieder andere verantwortlich machen zu wollen. Hört man mit dem Klagen und Schuldzuweisen auf, werden Energien für die selbstverantwortliche Studiengestaltung frei, und das Turbo-Studium ist genau die Gestaltungsform, die diese Energien, dieses Engagement in eigener Sache in vollem Umfang verlangt. Im Kern erweist sich nach unseren Erfahrungen das Turbo- Studium somit als der Versuch, das Studieren radikal von den gegebenen eigenen Potenzialen der eigentlichen Akteure – der Studierenden – her zu denken, es gegen den Gängelungsgedanken grundlegend zu autonomisieren.
Unsere mit dem Turbo-Modell verbundene Grundidee war dabei von Anfang an, dass es viele Wege für das Studium gibt und geben sollte, dass jeder Student anders ist, das heißt, unterschiedliche Eignungen mitbringt und entsprechend seine Chancen im Studiensystem bekommen sollte. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass neue Strukturen der individuellen Förderung an Hochschulen und Universitäten eingerichtet werden müssen. Es bedeutet zuerst den Appell an jeden Einzelnen, das Heft des Handelns selbst in die Hand zu nehmen und sich durch seine Studienplanung positiv stimulierende Rahmenbedingungen zu schaffen. So betrachtet ist also die im Turbo-Studium praktizierte Beschleunigung nicht nur ein Verfahren zur »Verfrühung« des berufsbezogenen Abschlusses. Mit ihm kann es gelingen, das zu entwickeln, was unabhängig von der speziellen Fachqualifikation im Berufsleben gefragt ist: Zupacken, Selbstgestalten, Selbst- statt Fremdbeschleunigen.