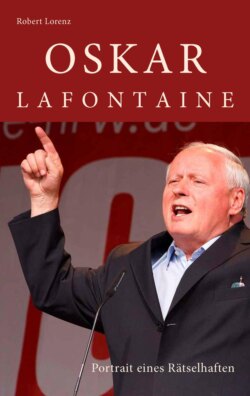Читать книгу Oskar Lafontaine - Robert Lorenz - Страница 10
Lafo-Dämmerung: Rücktritt
ОглавлениеIm März 1999 bewahrheitet sich die eineinhalb Jahre zuvor geäußerte Prognose des FAZ-Journalisten Volker Zastrow, demnach die „dick aufgetragene Einigkeit von Lafontaine und Schröder“ nur so lange bestehen bliebe, „wie jeder von ihnen glaubt, auf diese Weise dem eigenen Ziele näher zu kommen“.101 Auch Hans-Jochen Vogel hatte also nicht Unrecht, wenn er schon früher behauptete, dass Lafontaine „die Wahrnehmung der vollen Verantwortung in einer Spitzenfunktion leichter fallen würde als Ein- oder gar Unterordnung“102.
Nicht grundlos lässt sich behaupten, dass der spätere Antagonismus der beiden Urheber des Machtwechsels, Lafontaine und Schröder, vorgezeichnet gewesen ist. Lafontaine und Schröder – bereits Mitte der 1990er Jahre, als die SPD in politischen Dimensionen noch Lichtjahre vom Status einer Kanzlerpartei entfernt war, lagen die beiden schon einmal im Clinch. In der einen Ecke der saarländische Ministerpräsident, der mit einem wachen Blick in die Zukunft für die SPD ein ökologiepolitisches Profil einforderte; in der anderen der niedersächsische Ministerpräsident, der Mann der Auto-Industrie, der sich innerhalb der SPD von keinem was sagen lassen wollte.103 Natürlich lässt sich aus einer seinerzeit fernen Zukunft mit Leichtigkeit davon sprechen, dass die spätere Eskalation des Konflikts dieser beiden sozialdemokratischen Alphatiere vorhersehbar war. Doch war sie auch vermeidbar? Und ließ sich damals wirklich mehr sagen, als dass sich das spätere Zerwürfnis im Zusammentreffen zweier Politiker mit absolutistischem Machtanspruch zwar erkennbar anbahnte, jedoch keinesfalls den völligen Ausstieg Lafontaines, also auch die Aufgabe des Parteivorsitzes, verhieß?
Der Bruch mit Schröder und der Rücktritt vom Amt des Bundesfinanzministers allein wären vermutlich nachvollziehbar gewesen und als ebenso legitim wie entschuldbar erachtet worden. Doch die vollständige Kapitulation in Form eines zusätzlichen Rücktritts vom Bundesparteivorsitz hatte etwas unergründlich Totalitäres an sich. Und dafür haben im Frühjahr 1999 auch nicht viele Verständnis. Nur wenige, auch einschlägig als solche bekannte, Sympathisanten schlagen sich auf Lafontaines Seite: So schwärmt bspw. der saarländische Schriftsteller Ludwig Harig von dem Akt eines „Überzeugungstäters, der nur sich selbst verpflichtet und verantwortlich ist“, der außerdem die Frage aufwerfe, ob „die hellsichtige Entscheidung des Deserteurs, mit Rücktritt wider den Stachel zu löcken, nicht höher zu bewerten sei als der blinde Gehorsam des Mitläufers, sich im Fraktionszwang zu disziplinieren“.104 Für die meisten anderen ist Lafontaine dagegen ein gefallener König, mitunter ein Feigling, der seine treuen Anhänger im Stich lässt und ohne Not und Widerstand kapituliert hat, kurz: einen unverzeihlichen Fehltritt begangen hat.
So überraschend für viele Lafontaines Ausstieg auch erfolgte, so war er doch in gewisser Weise absehbar gewesen. Wenn es nun auch im Nachhinein naturgemäß leicht fällt, in der Vergangenheit Hinweise zu finden, so gab es sie dennoch – Lafontaines Rücktritt mag sich zwar nicht als Zwangsläufigkeit abgezeichnet haben, aber Indizien verdichteten sich in den letzten Wochen von Lafontaines Zeit im Kabinett und an der Parteispitze. „So kann man nicht regieren“105, brach es aus ihm nach nur kurzer Zeit vor der Bundestagsfraktion heraus; er wollte sich nicht mehr – insbesondere mit Blick auf seine Sympathien bei der Parteilinken – für die Politik von Schröder, Riester oder Müntefering in Haft nehmen lassen, bekam nun die unangenehmen Begleiterscheinungen von Kabinettsdisziplin und Kanzleramtsvorgaben zu spüren. Sein anfängliches Amüsement über einen von Außenstehenden unterstellten Konflikt mit Schröder, den er mit der vorgeblich gelassenen Bemerkung herunterspielte, er gehe, wenn nötig, eben auch zum „Chef“106, erwies sich nur kurze Zeit später als genauso gespielt wie die demonstrativen Eintrachtsbekenntnisse107 der beiden Rivalen.
Die einstige Vorstellung, innerhalb der Ministerriege als Chef des Finanzressorts der „Erste unter Gleichen“108 zu sein, war übertrieben optimistisch und hielt nicht lange vor. Die Mehrfachbelastung der gleichzeitigen Amtsführung als Finanzminister, der sämtliche Ausgaben der Regierung zu überblicken und kontrollieren hatte, und als Parteivorsitzender, der auseinanderdriftende Lager zusammenzubringen und Wahlniederlagen zu verarbeiten hatte, überstiegen nun ganz offenbar Lafontaines Toleranzschwelle für das persönliche Leiden an Politik.109 Und das war eigentlich auch kein Wunder: Einer, der zwanzig Jahre hinweg ständig nur aufgestiegen war und stets als herausragende Persönlichkeit gegolten hatte, war nun der „Kassenwart“ unter dem „Kanzler“, mindestens degradiert, mitunter unweit von gedemütigt.110 Das widersprach seiner Führungspraxis im Saarland, wo er die unangefochtene Autorität darstellte, alles und jeden kontrollierte, die wichtigen Entscheidungen traf – diese Gewohnheit war in Bonn dahin.
Außerdem hatte Lafontaine im Unterschied zu manchem anderen Kabinettsmitglied ungewöhnlich viel zu tun, musste das jahrelang unionsgeführte Bundesfinanzministerium neu aufstellen, musste als Vorsitzender die innerparteiliche Kritik am Regierungskurs auffangen und sich um eine ob empfindlicher Niederlagen wie der Hessenwahl im Februar 1999 beunruhigte Partei kümmern, musste seinen erodierenden Machtstatus innerhalb der SPD und gegenüber dem nunmehrigen Kanzler Schröder verteidigen, ja musste nun nicht mehr nur zwischen Saarbrücken und Bonn pendeln, sondern auch Auslandsreisen unternehmen. Strategisch hatte sich Lafontaine auf dem politischen Schachbrett in eine missliche Lage begeben.
Und Lafontaine musste nun, nachdem er jahrelang das Gefühl von Unverzichtbarkeit erfahren hatte, erkennen, dass er für den Mann im Kanzleramt austauschbar, nahezu gleichgültig geworden war. Denn Schröder hatte erreicht, was er erreichen wollte; Lafontaines Autoritätsgebaren konnte für Schröder auf Dauer nur lästig sein. Zwischen den beiden hatten sich die Machtverhältnisse verändert: In den 1980er Jahren zählte Lafontaine bereits zu den SPD-Stars, schien sich den Zeitpunkt zur Übernahme von Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz aussuchen zu können – zu einem Zeitpunkt, da Gerhard Schröder noch fernab jeglicher Exekutivmacht war. Dieses Gefühl bestand fort oder wurde sogar noch verstärkt: So waren nach dem Attentat im April 1990 einige in der SPD-Führung bereit, Lafontaine den Parteivorsitz anzutragen, wenn er doch bloß weitermachte.111 Und obwohl Lafontaine 1990 die Wahl verlor, daran mit seiner tiefen Einheitsskepsis auch augenscheinlich alles andere als schuldlos war, gehörte er auch anschließend zur Führungsspitze der SPD, zu einer neuen, jedoch kurzlebigen Troika mit Parteichef Björn Engholm und Fraktionschef Hans-Ulrich Klose.112 Nachdem diese zerfallen war, bildete Lafontaine mit dem rasant emporgestiegenen Gerhard Schröder ein Duo, einstweilen bis zur Bundestagswahl 1998 sogar ein Traumpaar, das die SPD nach sechzehn Jahren zurück an die Macht bugsierte. Jedenfalls: Zu all diesen Zeiten war Lafontaine aus der Parteielite nicht wegzudenken, war immer im Gespräch für höchste Weihen, eine „Ausnahmeerscheinung“113, schien selbst nach 1990 jederzeit eine neue Kanzlerkandidatur bevorzustehen. Überflüssig und mittelmäßig, insofern austauschbar oder gar entbehrlich war er indessen nie. Umso drastischer fiel nun, zur Jahreswende 1998/99, für ihn der Statuswandel aus.
Dort, wo Lafontaine nun im Herbst 1998 stand, war er unzähligen Schwierigkeiten und Problemen ausgesetzt, befand sich in einer für ihn völlig neuen, ungewohnten, nachteiligen Position. Im Grunde war jetzt kaum mehr etwas wie zuvor: Menge und Intensität zeit- und kraftraubender Arbeit nahmen binnen kurzer Zeit exponentiell zu – und das alles bei einem Politiker, der weniger als viele andere aufgrund seiner hedonistischen Neigungen dazu bereit war. Im Saarland lebte das Konzept Lafontaine, das provokante Spiel mit den Medien und die rhetorische Überlegenheit, schon früh von der personellen Alternativlosigkeit, dem Fehlen eines ebenbürtigen Rivalen – dort musste sich Lafontaine nicht mit der Sicherung seiner Macht herumschlagen, diese bewahrte und steigerte er eher beiläufig.114 Zum ersten Mal in seiner Karriere ist Lafontaine von den Gegebenheiten seines politischen Umfelds übermannt worden – was die manchmal schwächere Bedeutung des Faktors Persönlichkeit veranschaulicht. Zugleich blieb der persönliche Einfluss jedoch wirksam, denn die Drastik der Reaktion war dann doch Veranlagung und Zustand des Protagonisten geschuldet.
So gesehen war Lafontaines Scheitern in der damaligen Konstellation also nur noch eine Frage der Zeit gewesen, ein unausweichlicher Prozess. Form und Ausmaß dieses nahezu unvermeidlichen Scheiterns waren hingegen weit weniger festgelegt; Lafontaine standen sicherlich noch andere Optionen zur Auswahl – er entschied sich bekanntlich für die radikalste von ihnen.
Das hatte etwas von einem trotzigen Wegwerfen politischer Macht, wie es in der Geschichte nur selten vorkommt. Wie viel Arbeit ist da zunichte gemacht worden? Aber bei Lafontaine ist dies aus der Retrospektive nicht unbedingt überraschend gewesen; Anzeichen eines solchen Bruchs hatte es schon vorher gegeben. Vorhersehbar muss er deshalb aber noch lange nicht gewesen sein. In manchen Momenten konnte die Enttäuschung ob Lafontaines politischem Verhalten daher groß, ja gewaltig sein. Die an Liebe grenzende Zuneigung und Verbundenheit vieler SPD-Mitglieder für „Oskar“ hatte deshalb neben dem Verehrungsaspekt auch eine Kehrseite. Das war sicherlich vor allem 1999 der Fall, als viele seiner Anhänger sich im Stich gelassen, aufgrund ihres pflichtvergessenen Anführers Lafontaine urplötzlich der neoliberal anmutenden Schröder-SPD ausgeliefert fühlten. Bis heute dürften ihm das ziemlich viele Menschen verübeln.
Doch wie gesagt, auch früher schon hatte sich diese Charakteristik gezeigt: Noch vor der Kür zum Ministerpräsidenten 1985 sahen Beobachter in Lafontaine einen politischen Aufsteiger, der „vordergründig mit der Rolle des politischen Aussteigers, der sich keiner Disziplin zu beugen habe“115, kokettiere. Und 1989/90 meinten viele Lafontaine-Anhänger, ihr Kanzlerkandidat verspiele leichtfertig seine Siegeschancen, schmeiße das bislang Erreichte mit einer geringen Handbewegung einfach weg, statt mit wenig Mühe seine Chancen zu wahren. Denn fast jeder ahnte bereits Ende 1989, als Lafontaine sich zum Einheitsskeptiker aufschwang, dass das Kanzlerschaftsvorhaben unter diesen politischen Vorzeichen scheitern würde. Dabei schien Lafontaine doch das beste Pferd im Stall zu sein, jahrelang als Spitzenkandidat herbeigesehnt, von politisch ausschlaggebenden Parametern wie Redetalent und Programmatik dem amtierenden Kanzler Kohl augenscheinlich haushoch überlegen. Und dann Lafontaine: Wollte die DDR-Bürger „drüben“ halten, schien geistige Mauern zu errichten, wo doch gerade die steinerne gefallen war. Lafontaine-Fürsprecher wie der nordrhein-westfälische Fraktionschef Friedhelm Farthmann verzweifelten angesichts von „Oskars“ trotziger Uneinsichtigkeit: „Wir haben uns jahrzehntelang wegen unserer Ostpolitik prügeln lassen, und jetzt erwecken wir bei den Bürgern den Eindruck, als ob wir Angst vor der Wiedervereinigung hätten.“116
Darin drückte sich die ungeheure Enttäuschung, ja Frustration darüber aus, dass ein ansonsten durchsetzungswilliger, bisweilen genialer Politiker wie Lafontaine im erkennbar günstigen Moment sämtliche Chancen auf einen großen, lange herbeigesehnten und vielleicht nie wieder so leicht zu erringenden Sieg einfach ausschlug. So sehr Lafontaines Schaffenskraft faszinierte, so konnte dessen sporadisch aufblitzende Destruktivität abstoßen – ähnlich zeigte sich dies nach 2010 in der LINKEN. Natürlich würde die Einheit nicht leicht zu bewältigen sein – aber wer wollte das in den stürmischen Tagen des Mauerfalls und der anschließenden Wiedervereinigungsphase schon hören? Natürlich fiel der Umgang mit einem Machiavellisten wie Gerhard Schröder 1998/99 nicht leicht; doch warum musste er neben dem Kabinettsplatz auch gleich noch den Parteivorsitz aufgeben? Welche Botschaft zum Stellenwert dieses ehrwürdigen Amtes wollte Lafontaine damit entbieten?
Einerseits. Doch andererseits muss man Lafontaine auch zugestehen, dass er schon des Öfteren mit Ausstiegsgedanken geliebäugelt hatte. Ob das jeweils Ernst oder Koketterie war, muss dahingestellt bleiben. Aber auf die nach dem Kölner Attentat im Frühjahr 1990 gestellte Frage, ob er über ein vorzeitiges Ende seiner politischen Karriere nachgedacht habe, antwortete Lafontaine, „in diesem Spannungsverhältnis ja schon seit Jahren“117 zu stehen: „Ich bin auf der einen Seite politisch engagiert, auf der anderen Seite weiß ich, wieviel ich dafür preisgeben muss.“ Auch seine Biografen Werner Filmer und Heribert Schwan schrieben 1990 lakonisch: „Oft droht er, alles hinzuschmeißen.“118 Und spätestens nach dem Attentat, als Lafontaine beinahe nach dem Messerstich der Adelheid Streidel in Köln gestorben wäre, schien er wie nach einem überfälligen Weckruf Gefallen zu finden an dem Gedanken: „Fünf, zehn Jahre mal kürzer treten, leben, wie es mir gefällt.“119 Er fühlte sich von einigen der Spitzengenossen, allen voran Parteichef Vogel, in der Deutschlandfrage – einem mehr als gewichtigen Politikum – hintergangen, um zweifelsfreie Absprachen betrogen. Warum sollte er jetzt weitermachen? Was oder wie viel sprach dagegen, in noch jungem Alter, zumal nach einem fast tödlichen Attentat, einen Rückzieher zu machen und es seinen für den Moment verzweifelten Gegnern damit heimzuzahlen? Sein Rücktrittsbrief war damals schon geschrieben.120
Doch vermutlich waren sein eigener Glaube in den Erfolg seiner Kanzlerkandidatur und die Verlockung des machtvollsten politischen Amtes dann doch schlichtweg zu groß, als dass er den vermeintlich greifbaren Sieg auslassen würde. Bereits in den 1980er und frühen 1990er Jahren dürften in Lafontaine zwei Kräfte gegeneinander gewirkt haben: Die pure Lust am Politzirkus mitsamt dessen von großem Publikum umsäumter Manege; und der Unwille, sich für eine so langsame, oftmals auch undankbare Sache wie den politischen Prozess der demokratischen Mehrheitsfindung kaputtzumachen, kostbare Lebenszeit in Gremien, Kommissionen und Plenen zu vergeuden, wo doch die Hochgenüsse der westeuropäischen Zivilisation darauf warteten, von einem Gourmet ausgekostet zu werden. Aber vielleicht dienten ihm die koketten Allüren ganz einfach auch bloß als Gradmesser für seinen persönlichen Status, um zu erkennen, ob er noch wichtig genug ist, um sie ihm durchgehen zu lassen. Auch in diesem Punkt ist Lafontaine rätselhaft genug, um mehrere Deutungsvarianten zuzulassen.
Das Attentat, so Lafontaine, habe ihn „verändert“121, ihn für viele Facetten des Lebens sensibilisiert, die er als aufstrebender Berufspolitiker vernachlässigt habe. Demnach scheint seine Aufopferungsbereitschaft für das politische Leben – überhaupt dessen Stellenwert – infolge der existenziellen Erfahrung, dem Tod knapp zu entrinnen, deutlich zurückgegangen zu sein. Es wäre an dieser Stelle unfair, als Außenstehender den Wahrheitsgehalt von Lafontaines Aussage zu bestreiten. Da eine wissenschaftliche Herangehensweise dennoch zu einem quellenkritischen Blick anhält, sei zumindest eine Relativierung gestattet: Vermutlich hätte das Attentatserlebnis Lafontaine nicht davon abgehalten, noch einige Jahre länger, über 1999 hinaus, im SPD-Parteivorsitz, allgemein: in politischen Spitzenämtern zu verweilen. Viel eher lässt sich annehmen, dass es eine bereits zuvor existierende Verhaltensdisposition verstärkte, statt dass es eine neue Veranlagung schuf.