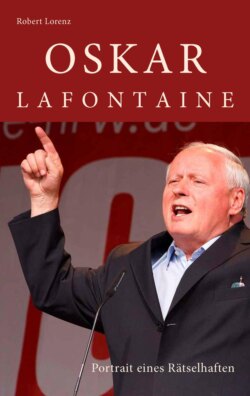Читать книгу Oskar Lafontaine - Robert Lorenz - Страница 8
Kanzlerkandidatur, Parteivorsitz und Machtwechsel: die 1990er Jahre
ОглавлениеFolgerichtig lässt sich Lafontaine zum Kanzlerkandidaten küren. So will er es haben: Die Partei ruft ihn, womit er misserfolgsvermeidend nicht in der Rolle des Drängenden, sondern Gedrängten steckt, zumal er sich durchaus in der Lage sieht, Kohl im Kanzleramt abzulösen. Bis 1990 hätte man die Geschichte von Lafontaines politischer Karriere auch als vorgezeichneten Weg zur Kanzlerschaft erzählen können. Denn was lag näher, als dass ein Mann vom politischen Profil Lafontaines – ökologiebewusst, pazifistisch, insgesamt progressiv, dabei aber auch sozialstaatlich – angesichts eines Kontrahenten vom Schlage Helmut Kohls nach der Bundestagswahl im Dezember 1990 Kanzler werden würde? Bis dahin ist Lafontaine ein faszinierender Siegertyp gewesen, jung, dynamisch, fortschrittlich, mediengewandt – oder wie die Konstellation in jenen Tagen beschrieben wird: Die SPD tritt an mit dem „sieggewohnten, managementerfahrenen Internationalisten aus Saarbrücken gegen den bräsig-nationalen CDU-Kanzler aus Oggersheim“77. Und tatsächlich scheint irgendetwas dran zu sein an der überschwänglichen These, Lafontaines Erfolge hätten „bei den Genossen zu fast mystischem Vertrauen in Fortüne und Fähigkeiten des saarländischen Lebenskünstlers und Tabubrechers geführt“78. Doch es ist Kohl, der am Ende gewinnt. Denn Lafontaines politische Biegsamkeit reicht für einen Wahlsieg im zwischenzeitlich wiedervereinigten Deutschland nicht aus. Lafontaines Kandidatur ist auf eine allein westdeutsche Wahl ausgelegt gewesen. Womöglich hat er sich in der neuen Situation der „Wende“ ganz einfach überschätzt, indem er irrtümlich annahm, Kohls Kurs der schnellen Verschmelzung zweier wirtschaftlich gänzlich konträr situierter Staaten würde sich noch vor dem Wahltag als falsch erweisen.79
Die Gründe für die Niederlage des politischen Shootingstars der 1980er Jahre, Lafontaine – gegen den als „Birne“ verspotteten Amtsinhaber Kohl, der schon Ministerpräsident war (1969), als Lafontaine noch frischgebackenes Parteimitglied war (seit 1966) –, sind schnell benannt: Die Menschen in beiden Teilen Deutschlands, dem Osten wie dem Westen, wollen 1990 die damaligen Geschehnisse mit historischer Bedeutung aufgeladen wissen und die Teilung in einer Wiedervereinigung aufgelöst sehen. Lafontaine aber begegnet der Vereinigungseuphorie mit demonstrativer Geringschätzung, ja Verachtung.80 In dieser Angelegenheit gibt er sich sogar als Hardliner, will nach dem Mauerfall nur solche DDR-Bürger in sein Bundesland übersiedeln lassen, die sich von ihrer Heimat aus bereits Wohnung und Job besorgt haben,81 will „die prämieren, die bleiben“82. Jeder Wahlkampfberater würde angesichts dieser Haltung die Hände über dem Kopf zusammenschlagen – und viele in der SPD tun dies auch in jenen Tagen. Lafontaine aber, nun einmal nicht der politische Fährtenleser, sondern der sachverständige Bedenkenträger, sieht zuvorderst die mit einer überstürzten Vereinigung verbundenen Probleme, antizipiert den wirtschaftlichen Kraftakt, der seitens der Westdeutschen notwendig sein wird. Damit mag er zwar eine realistischere Haltung einnehmen als Kohl – doch dessen optimistische Aussicht, aus der maroden DDR „blühende Landschaften mitten in Europa zu machen“83, ist eben um einiges erbaulicher als Lafontaines politischer Pessimismus, der vielen Bürgern und öffentlichen Meinungsmachern schlicht missfällt. Das Pressebild ist nicht der schlechteste Indikator für die Stimmung einer Zeit: Kurz vor dem Wahltag berichtet der Spiegel vom „längst abgeschriebenen Kandidaten“, der sich zwar gut schlage, aber „nahezu ohne Siegeschance gegen den amtierenden Kanzler Helmut Kohl ist“.84
Aus der Sicht des SPD-Kanzlerkandidaten ist es aber auch eine frustrierende Situation: Die plötzlich hereingebrochene Wiedervereinigung verdichtet sich zu einem politischen Ereignis, das als überraschende Zäsur das politische Programm von Lafontaine mit einem Mal obsolet werden lässt.85 Und ob es nun Trotz oder Überzeugung ist: Die Persönlichkeit des Kandidaten ist nicht in der Lage, sich dem gewandelten Umfeld anzupassen; hier ist der Saarländer, dem häufig Opportunismus unterstellt wird, alles andere als opportunistisch. Lafontaine trifft nicht die politische Stimmung der Vereinigungsromantik, Kohl schon. Unter diesem holen die Unionsparteien (43,8 Prozent) zehn Prozent mehr als die SPD (33,5 Prozent) – obendrein erhalten die Sozialdemokraten sogar 3,5 Prozent weniger, als sie 1987 mit Johannes Rau an der Spitze erreichten. Hätte Lafontaine lautstark in den Wiedervereinigungschor eingestimmt, wäre er zwar noch immer nicht automatisch Bundeskanzler geworden; doch zweifelsohne hätten sich seine Chancen enorm verbessert. So aber ist er in der Tat der „falsche Mann zur falschen Zeit“86. Und wer Stoff für gerechtfertigte Politikverdrossenheit sucht, kann Lafontaines Niederlage als einen Beleg auffassen für die politikverdrießliche Annahme, dass sich skeptischer Realismus in der Politik eben nicht auszahlt. Die Erwartungshaltung der Wähler, so zukunftsvergessen diese auch sein mag, will bedient, zumindest nicht ignoriert werden.
Für Lafontaine ist 1990 ein knallhartes Jahr: Am Abend des 25. April sticht ihn in der Köln-Mühlheimer Stadthalle die psychisch kranke Adelheid Streidel – eine 43-jährige Arzthelferin, die nach eigener Aussage von Jesus den Auftrag erhalten habe, einen Politiker zu töten87 – mit einem Messer in den Hals. Das lebensbedrohliche Attentat und die missglückte Kanzlerkandidatur markieren den Beginn einer Pechsträhne in Lafontaines bis dahin weitgehend im kontinuierlichen Aufstieg begriffener Karriere. Einen weiteren Rückschlag erleidet er dann 1992: Im Mai thematisiert ein Spiegel-Bericht die Pensionsregelungen saarländischer Politiker – am Beispiel Lafontaines. Der Ministerpräsident, obwohl aktiver Politiker, beziehe bereits Pensionszahlungen aus seiner Amtszeit als Saarbrücker Oberbürgermeister. Dem Anschein nach ein unerhörter Vorgang. Lafontaine sieht sich hingegen im Recht, argumentiert, langfristig würden ihn die Regularien mitnichten begünstigen.88 Nicht wenige Beobachter des politischen Geschehens dürfte diese Angelegenheit indes empört haben, bestätigt sie doch ein allgemeines Unbehagen gegenüber der politischen Elite und deren Umgang mit vermeintlichen Privilegien. Lafontaine ist jedenfalls Gegenstand öffentlicher Kritik, Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth anberaumt eine Parlamentssitzung, in der Abgeordnetenbezugsregelungen überprüft und hinterfragt werden sollen.
Im Januar 1993 ist es erneut der Spiegel, der Lafontaine in die Bredouille bringt: Diesmal werden Lafontaine, und seinem politischen Kompagnon Reinhard Klimmt, Kontakte in die Unterwelt nachgesagt.89 Ein im französischen Metz wegen Mordverdachts einsitzender Nachtclubbetreiber soll Lafontaine und Klimmt um Hilfe gebeten haben, ansonsten würde er kompromittierende Fotos in der Öffentlichkeit lancieren. Und Klimmt, der den Delinquenten persönlich kennt, soll mit diesem tatsächlich korrespondiert und Hilfe geleistet haben. Für Lafontaine ist das ein Desaster. Nun steht neben der noch frischen „Pensions-“ mit der „Rotlichtaffäre“ abermals ein Imagekiller im Raum. Obendrein übt der saarländische Ministerpräsident mit der Bundesratspräsidentschaft gerade ein höchst respektables und repräsentatives Amt aus, was den Rücktrittsdruck verstärkt. Aber Lafontaine tritt nicht zurück. Erst zwei Jahre später, im Januar 1995, stellt sich heraus, dass es offenbar gar keine delikaten Bilder des saarländischen Regierungschefs gibt. Aber die fiktiven Bilder der „Milieu-Affäre von Saalermo“90 sind in der Welt: Demnach sahnt Lafontaine Staatsgelder zum privaten Vergnügen ab und unterhält Beziehungen zu gemeingefährlichen Ganoven; der saarländische Ministerpräsident und Ex-Kanzlerkandidat – ein zwielichtiger Typ, gierig und erpressbar, aber von der Justiz unbehelligt.
Plötzlich ist aus dem Reformer Lafontaine, zumindest was die Klischeevorstellung der politischen Elitenmoral anbelangt, ein Politiker wie jeder andere geworden.91 Die Skandalserie blamiert und entzaubert die politische Figur Lafontaine und bedeutet einen der seltenen Tiefpunkte in seinem Leben. Die politische Presse fügt den jahrelangen Aufsteiger sogleich in das Muster gescheiterter Spitzenpolitiker ein: „Hohe Sterne fallen tief.“92 Es ist das einzige Mal bis zu seinem Rücktritt im März 1999, dass Lafontaine nicht mehr als Hoffnungsträger und Wunderheiler gesehen, sondern zweifelsfrei als Belastung für die SPD empfunden wird. Keiner der sozialdemokratischen Ministerpräsidenten nimmt ihn in Schutz, die wenigen Solidaritätserklärungen aus der Parteispitze wirken wie diplomatische Pflichtübungen ohne eigentliche Aussagekraft.93 Unter Demografen macht die Rede vom „Lafontaine-Effekt“94 die Runde, der die SPD in Meinungsumfragen einige Prozentpunkte koste.