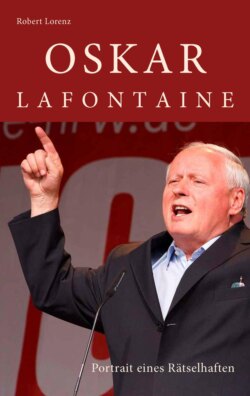Читать книгу Oskar Lafontaine - Robert Lorenz - Страница 9
Zwischen Bonn und Unterwelt
ОглавлениеNach den schwerwiegenden Verfehlungen, die im Hinblick auf seine früheren Sottisen auf die „Sesselfurzer“ der öffentlichen Verwaltung umso schwerer wiegen, scheint der einstige Politstar nun vor dem Karriereaus zu stehen. Was, in August Bebels Namen, hat sich dieser vorgebliche Sozialdemokrat da geleistest? Muss er jetzt nicht den Hut nehmen, ist Rücktritt nicht die einzig gebotene Reaktion, sind Renommee und Integrität nicht auf ewig ruiniert? Diese – zweifelsohne naheliegenden und nicht ungerechtfertigten – Fragen stehen damals jedenfalls im Raum. Umso mehr muss der Ausgang dieser politischen Episode verblüffen. Denn in Lafontaines politischem Leben bleibt dieser Vorgang tatsächlich nur eine Episode, seine Karriere geht vergleichsweise unvermindert weiter. Ja, sie soll sogar noch auf einen Höhepunkt zusteuern, auf den Parteivorsitz und den Wahlsieg 1998, ganz abgesehen von seiner maßgeblichen Beteiligung an der Parteigründung der LINKEN in den Jahren 2005 bis 2010. Denn ganz ehrlich: Wer hat sich denn noch erinnert an jene Fehltritte der frühen 1990er Jahre, als Lafontaine – Populist und Wunderkind der Politik – 2005 seine Rückkehr in die Tagespolitik antrat und sich einem kühnen Projekt, der Gründung einer neuen Linkspartei, verschrieb?
Die Halbwertszeit des politischen Skandals um Lafontaine ist sogar gering genug, um das Ganze nur ein Jahr später bereits vergessen zu machen. Denn da handeln die politischen Deutungseliten den Delinquenten bereits wieder für höchste Führungsämter in der SPD.95 Mit der Barschel-Affäre und Björn Engholms Verwicklung darin hat nämlich längst ein anderer, weitaus größerer und demnach sensationeller Skandal den Lafontaine’schen überdeckt. Außerdem rückt die öffentliche Meinung wieder auf die Seite des Saarländers, nachdem sich neuerliche Skandalvorwürfe des Spiegels als offensichtliches Resultat übermütiger Schlussfolgerungen in tendenziösen Berichten herausstellen.96 Dass z.B. der Ministerpräsident mit dem ehemaligen Rocker-Kneipier Totila Schott einen vorbestraften Schläger in die Staatskanzlei geholt und seinen „Kumpel aus dem Rocker- und Zockermilieu mit einer großkalibrigen Schusswaffe ausgerüstet“97 habe, erweist sich als übertriebene Schilderung, da Schotts Straffälligkeit aus Jugendjahren datiert und dieser sich inzwischen, zumindest in Saarbrücken und der Staatskanzlei, offenbar den Ruf eines ehrbaren Bürgers und tüchtigen Arbeitnehmers, nicht jedenfalls den eines offensichtlichen Schurken erworben hat. Damit hat der Spiegel letztlich dem angeschlagenen Lafontaine einen erholsamen Rollenwechsel ermöglicht, vom Täter zum Opfer. Und außerdem: Denkbar ist ebenfalls, dass Lafontaine einen Sympathiebonus erhielt – denn eindeutig kriminell und damit untragbar ist er ganz offenbar nicht; aber seine vermeintlichen Eskapaden, der Umgang mit Knastbrüdern, leichten Mädchen und Whisky-getränkte Nächte, verleihen ihm einen verwegenen Zug, der den ein oder anderen Saarlandbewohner vielleicht sogar ein wenig stolz macht; stolz darauf, dass da in der Staatskanzlei kein Langweiler hockt, sondern ein Mensch aus Fleisch und Blut, ein Draufgänger, der zugleich seine Amtsgeschäfte ganz ordentlich verrichtet. Zumal, die Geschichte wurde nie dominant genug, um das Lafontaine-Image zu bestimmen, sondern ergänzte eine Vielzahl anderer Facetten, sodass der Politiker Lafontaine dadurch noch schillernder, bunter wurde. Zwingend geschadet haben muss die Affären-Serie ihm also nicht.
In den folgenden Jahren wandelt sich die politische Situation wieder zugunsten Lafontaines. Unter ihrem Vorsitzenden Rudolf Scharping stürzt die SPD nach der neuerlich verlorenen Bundestagswahl 1994 in eine Parteikrise. Während Scharping mit dem Stigma der Niederlage behaftet ist, verteidigt Lafontaine bei der Landtagswahl 1994 mit 49,4 Prozent seinen Machtstatus an der Saar; sein eigenes Scheitern 1990 ist da längst Bestandteil einer weit zurückliegenden Epoche der SPD-Geschichte. Und so erhört Lafontaine die Rufe vieler Genossen, tritt überraschend gegen Scharping in einer Kampkandidatur an und wird auf dem erst dadurch legendären Mannheimer Parteitag im November 1995 doch noch SPD-Parteivorsitzender – ein Amt, das er auch schon in den 1980er Jahren hätte haben können, das er jedoch mehrmals ausschlug.
Im angestaubten Kohl-Bonn lässt Lafontaine frischen Wind wehen. Jedenfalls empfindet so die Hauptstadtpresse. „Im standardisierten Bonn, wo neues Denken todsicher alte Ängste aufwühlt, wirkt er als Unruhestifter. Das Unaussprechbare aussprechen! Das Undenkbare denken!“98, so hält es 1992 beinahe schwärmerisch der Zeit-Journalist Gunter Hofmann fest. Und Lafontaine gelingt die Zusammenbindung der unterschiedlichen Parteiteile.99 Der als sozialdemokratischer Lebemann bekannte SPD-Chef leistet nun knochenharte Parteiarbeit, reist häufig entgegen seiner Gremienabneigung in die Parteizentrale nach Bonn, führt eine Unmenge von Telefonaten mit unterschiedlichen Parteigliederungen und verpflichtet seine Genossen auf einen geschlossenen Oppositionskurs. Und ausgerechnet der von ihm brüskierte Scharping trägt als Vorsitzender der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion zum Gelingen bei. Lafontaines Leistung im Parteivorsitz gerät jedenfalls zu einer unerlässlichen Voraussetzung für den Wahlsieg 1998. So will offenbar auch Lafontaine seinen Beitrag verstanden wissen, steht doch dazu auf seiner Homepage: „Nach dem Sieg der SPD bei der Bundestagswahl am 27. September, den er als Parteivorsitzender maßgeblich zustande brachte, wird Lafontaine zum Finanzminister ernannt.“100