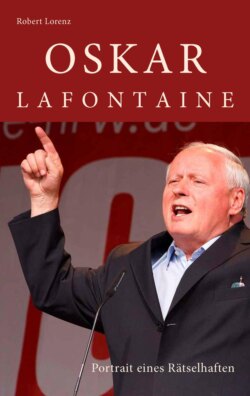Читать книгу Oskar Lafontaine - Robert Lorenz - Страница 6
Aus der Arbeiterfamilie in die Staatskanzlei
ОглавлениеDarüber hinaus verfügt Lafontaine für seinen politischen Erfolg über eine Reihe von förderlichen Eigenschaften. Zunächst seine soziale Herkunft: Diese scheint wie gemacht für die Nachkriegssozialdemokratie. Er entstammt einer Arbeiterfamilie; seine Mutter arbeitete als Sekretärin, sein Vater – der als Wehrmachtssoldat den Krieg nicht überlebte – war gelernter Bäcker.39 In der Generation der Großeltern ging es noch proletarischer zu, der eine Großvater war Maschinist, der andere Bergmann. Nach dem Krieg – der Verbleib des Vaters war noch ungeklärt, das Familienhaus zerbombt – wuchs Lafontaine mit seinem Zwillingsbruder Hans und der Mutter in spärlichen Verhältnissen auf, womit er freilich das Schicksal vieler deutscher Familien in der Nachkriegszeit teilte: eine alltäglich improvisierte Lebensweise im ständigen Mangel.40 Es wäre daher zwar naheliegend und stimmig, aus der Sicht von Biografen auch verführerisch, jedoch keineswegs sinnvoll, anzunehmen, Lafontaines sozialer Aufstiegsdrang und seine Schwäche für kulinarische und materialistische Extravaganzen stammten allein aus dieser Erfahrung einer entbehrungsreichen Kindheit. Wie gesagt, in solchen Umständen aufzuwachsen, war damals kein Sonderfall. Und auch, ob der kindliche Oskar im Dillinger Stadtteil Pachten, in dem er aufwuchs, in Prügeleien mit anderen Kindern tatsächlich lernte, „sich selbst zu behaupten, als Einzelkämpfer zu überleben, gegenüber Älteren zu bestehen, oft allein, meist zusammen mit seinem verschüchterten Bruder“41, wie es Interpreten seiner Biografie vermutet haben, kann zumindest relativiert werden. Diese Umstände sprechen sicherlich nicht gegen den Charakter des späteren Politikers, der oft genug in die Kategorie „Alphamännchen“ eingeordnet wurde; doch daraus eine kontinuierliche Entwicklungslinie, ein frühzeitiges Merkmal abzuleiten, geht womöglich doch zu weit.
Und auch hier gilt: Allenfalls war das eine weitere Bedingung auf dem Weg zum späteren Spitzenpolitiker, jedoch keine entscheidende – waren doch höchstwahrscheinlich etliche Gleichaltrige ähnliche Raufbolde wie der junge Lafontaine. Die Notwendigkeit zur Behauptung in sozialen Rangeleien wurde im Übrigen noch dadurch abgeschwächt, dass die verwitwete Mutter viel Aufmerksamkeit und Kraft darauf verwendete, ihre beiden Söhne von den übrigen Kindern im Viertel abzuheben. Sie beschenkte sie mit ungewohnten Gaben wie Roll- oder Schlittschuhen, kleidete sie stets adrett und schickte sie sogar aufs Gymnasium, was im sozialen Umfeld der Lafontaines auch noch für einige Zeit danach außergewöhnlich war.42 Unwillkürlich tritt der spätere Lafontaine aber auch in den Worten einer ehemaligen Lehrerin desselben vor das geistige Auge: „Als Erstklässler war er schon ein Macher. […] Manchmal überraschte er mich mit Fragen und Antworten […] Viele Klassenkameraden haben unter ihm gelitten. Denn dieses kleine Kraftpaket benutzte schon früh die Ellenbogen und langte zu. Ehrgeiz war nicht sein herausragendster Charakterzug. Er wusste aber, was er wollte.“43 Doch derart prädestiniert sind politische Lebenswege kaum.
Neben der vermeintlichen sozialdemokratischen Musterherkunft kommt dem späteren Ministerpräsidenten zugute, dass er sich in unterschiedliche soziale Zusammenhänge begab. In seiner Schulzeit und während des Studiums traf Lafontaine auf vielfältige Sozialkontakte, die ihm Einblicke in unterschiedliche Bereiche der Gesellschaft gewährten. Als Schüler des Prümer Konvikts wuchs er inmitten katholischer Geistlicher auf; als Stipendiat des Cusanuswerkes konnte er auf verpflichtenden Ferienakademien während seines Studiums den Umgang mit Theologen nochmals vertiefen; an der Saarbrücker Universität experimentierte er zwei Jahre lang in einem physikalischen Labor; parallel saß er im Stadtrat; auch hatte er sich im Stahlbau und auf dem Finanzamt ein paar Mark dazu verdient.44 Diese Phase seines Lebens gab ihm die Gelegenheit, reichlich gesellschaftliches Kontextwissen zu sammeln und unterschiedliche Lebenswelten kennenzulernen.
Sofern es sich nicht um eine naturgegebene Fähigkeit handelt, resultiert daraus womöglich Lafontaines Geschick im Umgang mit Menschen, mit potenziellen Wählern. Denn Lafontaine ist einer der wenigen Politiker, denen der sichere Gang auf dem Parkett der Hauptstadtbühne ebenso gelingt wie die legere Teilnahme an Straßenfesten und der volkstümliche Besuch des lokalen Fußballstadions; er kann ebenso intellektuelle Debatten führen wie an der Biertheke bestehen. Die gleichzeitige Beherrschung des Provinziellen und Weltbürgerlichen ist jedenfalls eine wichtige Voraussetzung, um im Saarland Regierungschef zu bleiben, parallel aber in der Bundespolitik mitzumischen und auch mit ausländischen Staatsmännern zu verkehren.
Eine weitere zentrale Ressource seiner politischen Machtstellung sind eine fortschrittliche Programmatik und ein zeitgemäßer Habitus. In Saarbrücken profiliert er sich als ökologiebewusster Rathauschef, der die bundesweit erfolgreichen Grünen derart überflüssig erscheinen lässt, dass sie 1985 in Hessen unter dem Sozialdemokraten Holger Börner eine Regierungskoalition eingehen, im selben Jahr aber nicht einmal den Einzug in den saarländischen Landtag schaffen, dort überhaupt erst 1994 mit drei Abgeordneten vertreten sind: Der Oberbürgermeister Lafontaine pflanzt Bäume, lässt Energie sparen, legt Radwege und Fußgängerzonen an und versieht die Fahrzeugflotte der Stadtwerke mit umweltfreundlicheren Modellen.45 Als frischgebackener Ministerpräsident hebt er 1985 sogleich den Radikalenerlass auf – auch auf die Gefahr hin, einer Verfassungsklage entgegenzusehen.46
Überdies wirken die noch tonangebenden Genossen der Nach-Schmidt-SPD im Unterschied zu Lafontaine optisch und rhetorisch wie Relikte einer vergangenen Zeit. Gestalten wie Hans-Jochen Vogel (Jahrgang 1926), Johannes Rau (Jahrgang 1931) oder Hans-Jürgen Wischnewski (Jahrgang 1922) stammen sichtbar aus einer anderen Politikwelt, die nicht so recht zu den postindustriellen Leistungseliten der späten 1980er und der 1990er Jahre passen will. Im Gegensatz zu ihnen befindet sich Lafontaine hinsichtlich seiner politischen Einstellungen, seinem Wertehaushalt und Erscheinungsbild näher an 2000 als an 1960. Auch das dürfte ihm in den Wahlkabinen Zuspruch verschafft haben.
Außerdem zeigen sich damals schon zentrale Elemente von Lafontaines Machtmethodik, die auch in Zukunft einen wesentlichen Beitrag zu seinem Erfolg leistet: erstens das Regieren im Umfeld von Vertrauten, die seine persönlichen Schwächen komplementär ausgleichen; und zweitens eine raffinierte Mediennutzung. Schon als Saarbrücker Oberbürgermeister, und wie später auch als Ministerpräsident, nimmt Lafontaine nach seinem Amtsantritt einen Personalaustausch vor, in dessen Folge er wichtige Positionen an den Schaltstellen der Macht mit Vertrauten besetzt.47 So macht er seinen Anwalt zum Justizminister und seinen Kultus- und Wissenschaftsminister hat er bereits Jahre zuvor als seinen Stellvertreter im SPD-Unterbezirk Saarbrücken-Stadt kennengelernt. Aus dem Rathaus nimmt er fähige und zugleich loyale Verwaltungs- und Exekutivexperten mit in die Staatskanzlei. Und zum Fraktionschef macht er seinen langjährigen Gefährten Reinhard Klimmt, der bei Abstimmungen die denkbar knappe Parlamentsmehrheit von nur einem Mandat sicherstellen soll. Das ist freilich keine ausnehmend geniale, sondern eher eine übliche Machtmethode, die schon seit Urzeiten von Politikern angewandt wird – doch ob sie auch der gegenwärtigen Politikkohorte im 21. Jahrhundert noch annähernd so selbstverständlich geläufig ist, kann zumindest bezweifelt werden. Lafontaine jedenfalls hat sie noch beherrscht, damit auch Kritik auf sich gezogen, doch diese geflissentlich ignoriert – womit er letztlich gut gefahren ist. Als er später SPD-Parteivorsitzender, noch später LINKE-Chef wird, erinnert sich niemand mehr an das „Geschmäckle“ seiner Personalpolitik im Saarland.
Doch Lafontaine schart nicht allein Persönlichkeiten um sich, auf deren Integrität er sich vollauf verlassen kann, die ihre Aufgaben zufriedenstellend erledigen und ihm nicht in absehbarer Zeit als Konkurrenten gegenüberzutreten drohen; darüber hinaus halten sie ihm auch – und vor allem – den Rücken frei. Erst dadurch kann er sich auf seine bundespolitischen Eskapaden, seinen Machtgewinn in der SPD und seine Rolle in der bundesweiten Öffentlichkeit konzentrieren. Der freche Oskar ist eine Folge des geschickten Machtinhabers Lafontaine. Neben Fraktionschef Klimmt zählt zu diesem Ensemble Staatskanzleichef Reinhold Kopp.48 Der bürokratisch versierte Jurist, den Lafontaine in eine großzügige Besoldungsstufe hievt, kontrolliert die Kabinettstätigkeit und setzt Lafontaines Willen um – auch er dabei stets loyal und zuverlässig. Daneben umgibt sich Lafontaine zwar mit etlichen Lakaien, von denen er keinen Widerstand zu befürchten, aber auch keine Inspiration zu erwarten hat, jedoch auch mit zwei „geistigen Sparringspartnern“49: dem Germanisten Hans-Georg Treib und dem Volkswirt Lothar Kramm. Wie kaum jemand sonst können die beiden sich in Lafontaine intellektuell hineinversetzen und ihn mit Gedankenimpulsen und Redemanuskripten versorgen. Ihnen ist wohl ein nicht unerheblicher Anteil daran zuzuschreiben, dass Lafontaine mit zahlreichen Büchern zu zeitgenössischen Gesellschaftsproblemen in der zusätzlichen Rolle eines politischen Intellektuellen auftreten kann.
Am wichtigsten ist dennoch Reinhard Klimmt: Kaum einem Beobachter bleibt verborgen, dass Lafontaine und Klimmt „in einer symbiotischen Beziehung“50 agieren, in Klimmts Worten „ein Kopf und ein Arsch“51 sind. Der nahezu gleichaltrige Klimmt ist einer der wenigen – manche würden sagen: der einzige –, deren Widerspruch Lafontaine duldet und sogar als Ratschlag aufgreift. Klimmt entlastet Lafontaine wie kaum ein zweiter: Vor schwierigen Entscheidungen besprechen sie sich; und wenn der Ministerpräsident mal wieder keine Lust auf zeitraubende, letztlich langweilige Kabinettsgespräche hat und entnervt von dannen zieht, übernimmt einfach der ebenfalls anwesende Fraktionschef Klimmt die Sitzungsleitung.52 Normalerweise ist Präsenz an Entscheidungsorten im politischen Geschäft eine unverzichtbare Grundlage von Machtsicherung und Machterwerb; doch bei Klimmt kann sich Lafontaine seine Abwesenheit erlauben, weil er weiß, dass dieser sie nicht zugunsten eigener Ambitionen ausnutzt, sondern die Regierungsgeschäfte in seinem Sinne führt. Derartig loyale Partnerschaften finden sich in der Politik tatsächlich selten – Lafontaine hat mit Klimmt an seiner Seite daher auch viel Glück. Denn Klimmt verschafft ihm Spielräume, die ihm ansonsten seine Persönlichkeit – die ihn gelegentlich selbstverliebter und unduldsamer als die meisten anderen Politiker sein, zumindest wirken lässt – verwehrt hätte. Während „der Oskar“ polarisiert und mancherorts in der Partei für Unmut sorgt, ist es „der Klimmt“, der versöhnt – eben ein mustergültiger Troubleshooter.53 Mithin: Ohne Klimmt wäre es wohl nicht (gut-)gegangen.
Insgesamt verfügt Lafontaine während seiner Zeit als saarländischer Ministerpräsident also über ein extrem schlagkräftiges, in sich komplementäres Team, das seine Schwächen ausgleicht und ihm viel Freiraum für politische Aktivitäten jenseits seiner unmittelbaren Amtspflichten verschafft. Denn er mag zwar ein politischer Tausendsassa sein, ein Alleskönner ist er aber dennoch nicht. Auch hier gilt: Dass politische Anführer der Unterstützung durch einen Mitarbeiterstab bedürfen, ist Standard nahezu jeder Herrschaftspraxis und schon immer so gewesen. Doch gibt es stets Unterschiede in der Funktionstüchtigkeit solcher „Küchenkabinette“, die erheblichen Einfluss auf Bestandskraft und Qualität von politischer Führung besitzen.54 Lafontaine beweist also entweder die Fähigkeit oder hat einfach das Glück, lange Zeit auf taugliches Personal zurückgreifen zu können.
Daneben setzt Lafontaine weiterhin auf die Medien als Machtinstrument. Noch ehe Parteifreunde und offizielle Gremien von seinen Ideen, Vorhaben und Forderungen erfahren, teilt er sie Journalisten mit. Das sorgt zwar häufig bei seinen Parteifreunden für unliebsame Überraschungen, doch hat er damit naturgemäß den Überraschungsmoment auf seiner Seite und sieht sich zudem nicht durch die zeitaufwändige Kommunikation mit anderen Ebenen blockiert. Nicht viele andere Politiker haben den inzwischen durchaus üblichen Austausch von Information gegen Publizität, der zwischen Politikern und Medienmachern stattfindet, derart häufig und drastisch praktiziert wie Oskar Lafontaine; Gerhard Schröder und Joschka Fischer mag dies noch gelungen sein. Davon zeugen insbesondere Lafontaines zahlreiche Gespräche mit dem in den 1980er und frühen 1990er Jahren auflagenstarken Spiegel: „Der Druck wird immer stärker“55, „Die Koalitionsfrage unverkrampft sehen“56, „Jetzt habe ich den Schnuller ausgespuckt“57, „Saarland – Asyl für linke Lehrer?“58, „Bonn hat heute kein Konzept“59, „Ich allein bin nicht die Mehrheit“60, „Wenn wir eine Mehrheit hätten…“61, „Ich habe nicht gekniffen“62, „Die traditionellen Rollen aufbrechen“63, „Man muß auch anstößig sein“64 – um hier nur einige zu nennen. Mit solchen Stellungnahmen in Leitmedien inszeniert er sich als Intellektueller unter den Politikern, als Impulsgeber und Reformer; zugleich setzt er andere Akteure unter Zugzwang, um seinerseits am Ende als weiser Avantgardist da zu stehen, wohingegen der übrige Politikertross ihm lediglich nacheilt.
Merkwürdigerweise ist Lafontaines unstetes Familienleben kein Malus für den Fortgang seiner Politikkarriere. Eigentlich müsste man annehmen, das mit inzwischen drei Trennungen auf den ersten Blick instabile Familienleben habe Lafontaine stark belastet. Schließlich kann man sich leicht vorstellen, wie viel emotionale Kraft solche Brüche in Partnerschaften beanspruchen können, wie schwer sie überdies als prominenter, noch dazu in staatlicher Verantwortung stehender Persönlichkeit der Öffentlichkeit zu vermitteln und unter dem Druck der Medienaufmerksamkeit auszuhalten sind. Zumal, dass im katholisch geprägten Saarland ein seit 1988 zweifach Geschiedener mit absoluten Mehrheiten regierte, ist zumindest nicht selbstverständlich, wenn man die Religionszugehörigkeit nicht endgültig als wahlrelevanten Faktor ignorierte. Im Gegenteil verschaffte ihm dieser Umstand vermutlich sogar Sympathien: Denn die Bürger – somit auch: Wahlberechtigten – sahen in ihm keinen leblosen Politikroboter, kein selbstverleugnendes, gefühlskaltes Konstrukt, sondern einen Menschen mit Fehlern, die dieser auch als solche freimütig eingestand65, statt sie hinter unechten Inszenierungen zu verbergen.
War eine offizielle Trennung nicht viel besser, weil aufrichtiger als eine künstlich und lediglich für die Öffentlichkeit, somit aus wahltaktischen Gründen aufrechterhaltene Partnerschaft? Ließen sich in den Eheproblemen des Oberbürgermeisters bzw. Ministerpräsidenten nicht auch Parallelen zu eigenen Schwierigkeiten erkennen? Lafontaine führte kein Leben nach erzkatholischen Maßstäben; aber er schien sich zumindest an moralische Richtlinien zu halten, achtete via Eheschließung und -scheidung wenigstens auf einen aufrichtigen Familienstand, schien in seiner privaten Familienpolitik nachvollziehbare, ehrliche Entscheidungen zu treffen, trotz seines Freiheitsdrangs immerhin kein zügelloser Hallodri zu sein. Damit fügte er sich ganz gut in eine Gesellschaft, in der Scheidungen häufiger wurden und die formelle Zugehörigkeit zur Kirche abnahm. Lafontaines Partnerschaftsverhalten dürfte ihn daher eher entlastet haben; schließlich kann es genauso oder noch anstrengender sein, eine Beziehung nur noch für die Augen der Öffentlichkeit als strategische Camouflage aufrechtzuerhalten – die sich in der Geschichte der Bundesrepublik sicherlich nicht wenige Politikerpaare zum Leidwesen der gesamten Familie angetan haben.