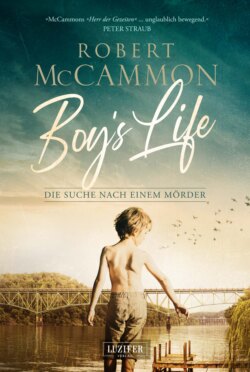Читать книгу BOY'S LIFE - Die Suche nach einem Mörder - Robert Mccammon - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Osterwespen
ОглавлениеDer Meteor, so stellte sich heraus, musste auf seinem feurigen Weg aus dem Weltall zu Asche verbrannt sein. Ein paar Kiefern hatten Feuer gefangen, aber Sonntagnacht begann es zu regnen und das Feuer erlosch. Montagmorgen, als die Schulglocke läutete, regnete es immer noch und der Regen fiel den ganzen langen, grauen Tag. Am darauffolgenden Sonntag war Ostern, und Mom sagte, dass sie hoffte, der Regen – welcher der Vorhersage nach mehr oder weniger die ganze Woche über fallen sollte – würde am Samstag nicht die Merchants Street Osterparade verderben.
Am frühen Karfreitagmorgen, ab ungefähr sechs Uhr oder so, begann in Zephyr stets eine andere Art von Parade. Sie fing in Bruton an, in einem kleinen Holzhaus, das lila, orange, rot und sonnengelb gestrichen war. Eine Prozession dreier schwarzer Männer in schwarzen Anzügen, weißen Hemden und Krawatten ging von einer Gruppe strenggekleideter Frauen und Kindern gefolgt von Haus zu Haus. Zwei der Männer trugen Trommeln und schlugen einen langsamen, gleichmäßigen Rhythmus, der den Schritten den Takt setzte. Die Prozession marschierte über die Eisenbahnschienen hinweg und die Merchants Street entlang durch die Stadt und niemand sagte ein Wort. Da es ein alljährliches Ereignis war, kamen viele der weißen Einwohner von Zephyr aus ihren Häusern, um an den Straßen entlang zuzuschauen. Meine Mutter gehörte dazu, nur mein Dad war um die Zeit bereits auf der Arbeit. Ich ging meist mit ihr, denn ich verstand die Bedeutung dieser Parade genau wie alle anderen.
Die drei schwarzen Männer, die den Umzug anführten, trugen Jutesäcke. Um ihre Hälse hingen über der Krawatte Ketten aus Bernsteinperlen, Hühnerknochen und den Schalen kleiner Flussmuscheln. An diesem Karfreitag waren die Straßen nass und der Regen rieselte herunter, aber die Mitglieder der schwarzen Parade hatten keine Regenschirme. Sie sprachen mit niemandem auf den Gehwegen und gaben keinem Antwort, der so unhöflich war, sie anzusprechen. Ich sah Mr. Lightfoot in ungefähr der Mitte des Umzugs gehen, und obwohl er jedes weiße Gesicht in der Stadt kannte, sah er weder nach rechts noch links, sondern starrte dem Mann, der vor ihm marschierte, auf den Rücken. Marcus Lightfoot war in den zusammengehörenden Kommunen Bruton und Zephyr ein wichtiger Mann, ein Handwerker, der jedes der menschlichen Erfindungsgabe entsprungene Ding reparieren konnte, auch wenn er im selben Tempo wie wachsendes Gras arbeitete. Ich sah Mr. Dennis, den Schulhausmeister. Ich entdeckte Mrs. Velvadine, die in unserer Kirchenküche arbeitete, und ich sah Mrs. Pears, die im Merchants Street Bake Shoppe stets lachte und fröhlich war. An diesem Tag war sie allerdings todernst und hatte einen Regenhut aus Plastik auf.
Das hinterste Ende der Prozession, noch nach den Frauen und Kindern, bildete ein dürrer Mann in schwarzem Frack und Zylinder. Er trug eine kleine Trommel und seine schwarz behandschuhten Hände markierten mit ihrem Schlagrhythmus den Takt. Die meisten Menschen waren an diesem kühlen, verregneten Morgen rausgekommen, um diesen Mann und seine Frau zu sehen. Seine Frau würde später kommen; er marschierte allein mit nach unten gekehrtem Gesicht.
Wir nannten ihn den Mondmann, weil wir seinen richtigen Namen nicht kannten. Er war sehr alt, aber wie alt genau, war unmöglich zu sagen. Außerhalb von Bruton sah man ihn bis auf diesen Umzug äußerst selten, genau wie seine Frau. Ein Geburtsfehler oder eine Hautkrankheit hatte eine Seite seines langen, schmalen Gesichts hellgelb gefärbt, während die andere Seite dunkel wie Ebenholz war. Die beiden Hälften trafen sich in einem Krieg der Farbflecke auf seiner Stirn und seinem Nasenrücken, sowie dem weißbärtigen Kinn. Der rätselhafte Mondmann trug an beiden Handgelenken zwei Armbanduhren, und ein vergoldetes Kruzifix von der Größe eines Schinkens hing an einer Kette um seinen Hals. Wir nahmen an, dass er der offizielle Taktgeber der Parade war und auch eines der königlichen Mitglieder.
Der Umzug wand sich Schritt für Schritt durch Zephyr zur Gargoylebrücke über dem Tecumseh River. Die Parade dauerte ihre Zeit, aber dieser Anblick war es wert zu spät zur Schule zu kommen. Deswegen begann der Unterricht am Karfreitag auch nie so richtig vor zehn Uhr.
Als die drei Männer mit den Jutesäcken die Mitte der Brücke erreicht hatten, hielten sie an und verharrten wie schwarze Statuen. Der Rest des Umzugs schloss so dicht wie möglich auf, ohne die Brücke zu blockieren, obwohl Sheriff Amory entlang der Strecke Sägeböcke mit Warnlichtern aufgestellt hatte.
Einen Moment später fuhr ein Pontiac Bonneville, der von der Kühlerhaube bis zum Kofferraum mit glänzendem Strass bedeckt war, von Bruton aus langsam auf derselben Strecke wie die Parade die Merchants Street entlang. Als das Auto in der Mitte der Gargoylebrücke angekommen war, stieg der Fahrer aus und öffnete die hintere Tür und der Mondmann nahm die faltige Hand seiner Frau entgegen und half ihr heraus.
Die Lady war da.
Sie war dünn wie ein Schatten und genauso dunkel, hatte eine Baumwollwolke weißer Haare. Ihr Hals war lang und königlich, ihre Schultern gebrechlich, aber ungebeugt. Sie trug kein wildgefärbtes oder -geschnittenes Kostüm, sondern ein einfaches schwarzes Kleid mit einem silbernen Gürtel, weiße Schuhe und einen weißen Pillbox-Hut mit Schleier. Ihre weißen Handschuhe reichten ihr bis an die knochigen Ellbogen. Als der Mondmann ihr aus dem Auto half, spannte der Fahrer einen Regenschirm auf und hielt ihn über ihren königlichen, uralten Kopf.
Die Lady, so erzählte man sich, war im Jahre 1858 geboren. Damit musste sie hundertsechs Jahre alt sein. Meine Mom sagte, dass die Lady in Louisiana eine Sklavin gewesen und vor dem Zivilkrieg mit ihrer Mutter davongelaufen war und sich in den Sumpf geflüchtet hatte. Die Lady war in einer Kolonie aus Leprakranken, entflohenen Häftlingen und Sklaven im Bayou bei New Orleans aufgewachsen, und das war, wo sie alles gelernt hatte, was sie wusste.
Die Lady war eine Königin und Bruton war ihr Königreich. Niemand außerhalb von Bruton – und niemand in Bruton, soviel ich wusste – kannte sie unter einem anderen Namen als »die Lady«. Er passte zu ihr; sie verkörperte durch und durch Eleganz.
Jemand reichte ihr eine Glocke. Sie stand und starrte auf den gemächlich fließenden braunen Fluss hinunter. Langsam begann sie die Glocke hin und her zu schwenken.
Ich wusste, was sie tat. Meine Mom wusste es auch. Alle, die zuschauten, wussten es.
Die Lady rief das Flussmonster aus seiner schlammigen Villa heraus.
Ich hatte das Monster namens Old Moses nie gesehen. Als ich neun Jahre alt war, meinte ich, in einer Nacht nach einem Sturzregen, als die Luft so dicht wie Wasser war, Old Moses rufen gehört zu haben. Es war ein dunkles Grollen gewesen, wie die tiefste Note einer Kirchenorgel, so tief, dass man sie in seinem Knochenmark spürt, bevor die Ohren sie auffangen. Das Geräusch schraubte sich zu einem heiseren Brüllen hoch, das die Hunde der Stadt durchdrehen ließ. Und dann war es weg. Es hatte kaum fünf, sechs Sekunden lang angedauert. Am nächsten Tag gab es in der Schule kein anderes Gesprächsthema als dieses Geräusch. Ben und Davy Ray meinten, dass es das Pfeifen eines Zuges gewesen war. Johnny verriet seine Gedanken dazu nicht. Meine Eltern sagten, dass es der Zug auf der Durchfahrt gewesen sein musste, aber später fanden wir heraus, dass der Regen über zwanzig Meilen von Zephyr entfernt ein Schienenstück weggespült hatte und dass der Frachtzug nach Birmingham in jener Nacht gar nicht gefahren war.
So etwas wirft Fragen auf.
Einmal wurden unter der Gargoylebrücke die Überreste einer Kuh angetrieben. Ohne Kopf und Eingeweide, erfuhren mein Vater und ich von Mr. Dollar, als wir zum Haareschneiden gingen. Zwei Männer, die kurz hinter Zephyr vom Ufer Netze nach Flusskrebsen auswarfen, verbreiteten ein Gerücht über eine menschliche Leiche, die an ihnen vorbeigetrieben war; mit sperrangelweitem Brustkorb wie eine offene Sardinenbüchse und abgerissenen Armen und Beinen. Aber es wurde stromabwärts nie eine Leiche gefunden. In einer Oktobernacht rammte irgendetwas eins der Fundamente, auf denen die Brücke stand, und hinterließ Risse in den Stützpfeilern, die mit Zement gefüllt werden mussten. »Ein großer Baumstamm« lautete Bürgermeister Swopes offizielle Erklärung im Adams Valley Journal.
Die Lady läutete ihre Glocke, bewegte ihren Arm wie ein Metronom. Sie begann zu singen, überraschend klar und laut. Der Gesang bestand nur aus afrikanischen Worten, die ich ungefähr so gut verstand wie Nuklearphysik. Ab und zu hielt sie inne, legte den Kopf zur Seite, als hielte sie nach etwas Ausschau oder horchte, und dann fing sie wieder an die Glocke zu schwingen. Nicht ein einziges Mal sang sie den Namen »Old Moses«. Sie wiederholte ständig »Damballah, Damballah, Damballah«, und dann schraubte ihre Stimme sich wieder in ein afrikanisches Lied empor.
Schließlich hörte sie auf die Glocke zu läuten und ließ sie sinken. Sie nickte, woraufhin der Mondmann die Glocke entgegennahm. Die Lady sah mit starren Augen zum Fluss hinunter, aber was sie dort sah, wusste ich nicht. Dann trat sie einen Schritt zurück und die drei Männer mit den Jutesäcken stellten sich an die Brückenbrüstung. Aus den Säcken holten sie in Papier und Klebeband eingewickelte Päckchen heraus. Das eine oder andere Papier war blutdurchtränkt, und man konnte den Kupfergeruch von frischem Fleisch riechen. Dann fingen sie an, das blutige Mahl auszuwickeln und warfen die Steaks, Bratenstücke und Rippchen in das wirbelnde braune Wasser. Ein ganzes gerupftes Huhn fiel in den Fluss, sowie Hühnerinnereien, die aus einem Plastikbecher geschüttet wurden. Kälberhirn rutschte aus einer grünen Tupperware-Schüssel und nasse rote Rindernieren und Leber aus einem der feuchten Päckchen. Ein Glas mit eingelegten Schweinefüßen wurde aufgedreht und der Inhalt platschte ins Wasser. Das letzte Stück war ein Rinderherz, größer als die Faust eines Boxers. Es klatschte in den Fluss wie ein roter Stein. Dann machte die Lady wieder einen Schritt nach vorn, wobei sie aufpasste, nicht auf dem Blut auszurutschen, welches auf den Asphalt getropft war.
Mir kam der Gedanke, dass gerade eine ganze Menge Sonntagsdinner ins Wasser gefallen waren.
»Damballah, Damballah, Damballah!«, sang die Lady noch einmal. Vier oder fünf Minuten lang beobachtete sie bewegungslos, wie der Fluss unter der Brücke hindurchströmte. Dann gab sie einen langen Seufzer von sich, und als sie sich zu ihrem Strass-Pontiac umdrehte, erhaschte ich hinter ihrem Schleier einen Blick auf ihr Gesicht. Sie runzelte die Stirn; was sie auch gesehen oder nicht gesehen hatte, stimmte sie nicht froh. Sie stieg ins Auto, der Mondmann folgte ihr, der Fahrer machte die Tür hinter ihnen zu und setzte sich ans Steuer. Der Pontiac fuhr bis zu einer Stelle, an der er wenden konnte, und setzte sich dann in Richtung Bruton in Bewegung. Die Prozession marschierte die gleiche Strecke zurück, die sie gekommen war. Normalerweise wurde nun viel gelacht und geredet und die Mitglieder des Umzugs blieben stehen, um sich unterwegs mit den weißen Zuschauern zu unterhalten. An diesem Karfreitag aber hatte sich die ernste Stimmung der Lady verbreitet und niemandem schien nach Lachen zumute zu sein.
Ich wusste ganz genau, um was es bei dem Ritual ging. Jeder im Ort wusste es. Die Lady warf Old Moses seinen alljährlichen Festschmaus zum Fraß vor. Wann das begonnen hatte, wusste ich nicht; es war schon lange ein Brauch gewesen, bevor ich überhaupt zur Welt kam. Vielleicht findet ihr es heidnisch oder Teufelswerk wie Reverend Blessett von der Freedom Baptist Church, und denkt, dass es der Bürgermeister und Stadtrat hätten verbieten sollen, aber genügend Weiße glaubten an Old Moses, um sich gegen die Beschwerden des Predigers durchzusetzen. Es war nicht viel anders als eine Hasenpfote als Glücksbringer anzusehen oder sich Salz über die Schulter zu werfen, wenn man welches verschüttet hatte. Es war einfach etwas, das zum Leben gehörte und das man zur Sicherheit machte, nur für den Fall, dass Gottes Wege unerklärlicher waren, als wir Christen begreifen konnten.
Am Tag danach regnete es noch stärker und Donnerwolken schoben sich über Zephyr. Die Osterparade der Merchants Street wurde zum großen Bestürzen des Kunstvereins und der Handelskammer abgesagt. Mr. Vandercamp Junior, dessen Familie der Futtermittel- und Baumarkt gehörte, verkleidete sich schon seit sechs Jahren als Osterhase und fuhr steht im letzten Auto der Parade mit. Er hatte diese Rolle von Mr. Vandercamp Senior geerbt, der zum Herumhüpfen zu alt geworden war. An diesem Ostern ertränkte der Regen jedoch jegliche Aussichten, einige der von diversen Ladenbesitzern und ihren Familien aus den Autos geworfenen Schokoladeneiern zu ergattern. Die Damen des Sunshine Clubs konnten weder ihre Osterkleider, Gatten noch Kinder zur Schau stellen, Zephyrs Kriegsveteranen konnten nicht hinter der Flagge hermarschieren und die Confederate Sweethearts – Mädchen, die die Adams Valley Highschool besuchten – konnten weder ihre Reifröcke anziehen noch ihre Sonnenschirme drehen.
Ostern dämmerte grau in grau heran. Mein Dad und ich mochten es beide nicht, wenn wir uns mit gestärkten Hemden, Anzügen und polierten Schuhen fein anziehen sollten. Mom hatte auf unser Grummeln stets die gleiche Antwort. »Es ist ja nur der eine Tag«, lautete ihr Spruch, als fühlten sich der steife Kragen und Krawattenknoten dadurch bequemer an. Ostern war ein Tag, an dem die ganze Familie zusammenkam. Mom rief Grand Austin und Nana Alice an, und Dad danach Granddaddy Jaybird und Grandmomma Sarah. Wie immer zu Ostern würden wir uns in Zephyrs First Methodist Church treffen, um unseren Reverend über der leeren Gruft predigen zu hören.
Als wir endlich einen Parkplatz für unseren Pick-up gefunden hatten, füllte sich die weiße Kirche in der Cedarvine Street bereits. Wir gingen durch den feuchten Dunst auf das Licht zu, das aus den Buntglasfenstern der Kirche strömte. Die Schuhcreme auf unserer feinen Fußbekleidung wurde von der Nässe aufgesogen. Unter dem Dachüberhang an der Eingangstür legten die Kirchgänger ihre Regenmäntel und Schirme ab. Es war eine alte Kirche, 1939 erbaut, deren Kalkanstrich sich löste und graue Flecken zum Vorschein brachte. Normalerweise wurde die Kirche für Ostern frisch geweißelt, aber in diesem Jahr hatte der Regen den Pinseln wie dem Rasenmäher das Handwerk gelegt. Vor dem Gebäude rankte das Unkraut.
»Hereinspaziert, meine Hübsche! Willkommen, Blümchen! Bitte aufpassen, Nudel! Einen schönen Ostermorgen, Sonnenschein!« Das war Dr. Lezander, der die Gemeinde begrüßte. Soviel ich wusste, tat er das jeden Sonntag. Dr. Frans Lezander war der Tierarzt von Zephyr. Er war es gewesen, der Rebel letztes Jahr von starkem Würmerbefall geheilt hatte. Er war Holländer, und obwohl er immer noch mit starkem Akzent sprach, waren er und seine Frau Veronica meinem Dad zufolge schon aus Holland weggezogen, bevor ich überhaupt geboren war. Er war Mitte fünfzig, ungefähr eins-fünfundsiebzig groß, hatte breite Schultern, eine Glatze und einen akkurat getrimmten grauen Bart. Er trug stets schicke dreiteilige Anzüge, immer mit Fliege und einer Nelke in der Brusttasche, und dachte sich für die Gottesdienstbesucher Namen aus. »Guten Morgen, Pfirsichflaum!«, sagte er zu meiner lächelnden Mutter. Und mit einem knöchelzermalmenden Handschlag zu meinem Vater: »Nasses Wetter, was, Donnervogel?« Er drückte mir die Schulter und grinste, dass das Licht an seinem silbernen Schneidezahn aufblitzte: »Hereinspaziert, Bronco!«
»Hast du gehört, wie Dr. Lezander mich genannt hat?«, fragte ich meinen Dad, als wir die Kirche betraten. »Bronco!« Für einen Tag lang einen neuen Namen zu bekommen war stets ein Highlight des Kirchenbesuchs.
Obwohl die Holzflügel der Ventilatoren sich drehten, war die Luft im Sanktuarium abgestanden und feucht. Vorn spielten die Glass-Schwestern auf Klavier und Orgel ein Duett. Die beiden waren die perfekte Definition des Wortes seltsam. Obwohl sie keine eineiigen Zwillinge waren, sahen die altjüngferlichen Schwestern sich so ähnlich wie verzerrte Spiegelbilder. Beide waren lang und dürr, Sonia mit hochaufgetürmten weißblonden Haaren und Katharina mit hochaufgetürmten blondweißen Haaren. Beide trugen Brillen mit breitem schwarzem Gestell. Sonia spielte Klavier, aber nicht Orgel, und bei Katharina verhielt es sich genau andersherum. Je nachdem, wen man fragte, waren die Glass-Schwestern – die ständig aneinander herumzunörgeln schienen, aber in der Shantuck Street zusammen in einem wie ein Lebkuchenhäuschen aussehenden Holzhaus wohnten – achtundfünfzig, zweiundsechzig oder fünfundsechzig. Ihre seltsame Aufmachung wurde von ihrer Kleidung vervollständigt: Sonia trug nichts außer Blau in all seinen Schattierungen, während Katharina sich sklavisch an Grün hielt. Was unweigerlich zur Folge hatte, dass wir Kinder Sonia Miss Blauglas nannten und Katharina … genau, ihr habt es erraten. Aber seltsam oder nicht; sie spielten wunderbar Klavier und Orgel.
Die Bänke waren fast vollbesetzt. Es war so feuchtwarm, dass die Kirche sich wie ein Gewächshaus anfühlte, in dem exotische Hüte blühten. Auch andere Kirchengänger suchten nach Plätzen, und einer der Platzanweiser – Mr. Horace Kaylor, der einen weißen Schnurrbart und ein wanderndes linkes Auge hatte, das gruselig aussah, wenn man es anstarrte – kam durch den Gang auf uns zu, um uns zu helfen.
»Tom! Hier! Herrgott nochmal, bist du blind?«
Auf der ganzen weiten Welt gab es nur einen einzigen Menschen, der in der Kirche wie ein Hirsch zur Brunftzeit losröhrte.
Er stand auf und winkte uns über das Meer von wogenden Hüten mit beiden Armen zu. Ich konnte spüren, wie meine Mutter beschämt den Kopf einzog. Mein Vater legte ihr den Arm um die Schultern, als wollte er ihr das Rückgrat stärken. Granddaddy Jaybird schaffte es jedes Mal seinen nackten Arsch zu zeigen, wie mein Dad es nannte, wenn er dachte, ich würde es nicht hören. Heute würde keine Ausnahme sein.
»Wir haben euch Plätze freigehalten!«, brüllte mein Großvater und brachte die Glass-Schwestern aus dem Konzept – eine spielte eine zu hohe Note, die andere eine zu tiefe. »Kommt, bevor sie jemand klaut!«
Grand Austin und Nana Alice saßen auf derselben Bank. Grand Austin hatte einen Leinenanzug an, der aussah, als wäre er im Regen um zwei Größen eingelaufen. Sein faltiger Hals wurde von einem gestärkten weißen Kragen und einer blauen Fliege eingeklemmt, seine schütteren weißen Haare waren nach hinten gekämmt und seine Augen voller Elend, so wie er dort das Holzbein unter die Bank vor sich gestreckt dasaß. Er saß neben Granddaddy Jaybird, was seinen Unmut nur noch verstärkte: Die beiden verstanden sich so gut wie Katz und Maus. Nana Alice dagegen war ein Bild reinen Glücks. Sie trug einen mit kleinen weißen Blumen verzierten Hut, ihre weißen Handschuhe und ihr grünes Kleid, das glänzte wie Meerwasser im Sonnenschein. Ihr hübsches ovales Gesicht glühte förmlich; sie saß neben Grandmomma Sarah und die beiden verstanden sich wie Blumen im gleichen Bouquet. Im Moment zupfte Grandmomma Sarah allerdings an Granddaddy Jaybirds Anzugjacke – er trug stets denselben Anzug, im Winter wie im Sommer, zu Ostern oder bei Beerdigungen –, damit er sich hinsetzte und aufhörte, den Verkehr zu lenken. Er wies die Menschen auf den Bänken an, enger zusammenzurücken und brüllte dann: »Hier ist noch Platz für zwei!«
»Setz dich hin, Jay! Setz dich!« Ihr blieb nichts anderes übrig, als ihn in seinen knochigen Hintern zu zwicken, woraufhin er ihr einen finsteren Blick zuwarf und auf der Bank Platz nahm.
Meine Eltern und ich drückten uns die Bank entlang. »Schön, dich zu sehen, Tom«, sagte Grand Austin zu Dad und sie schüttelten sich die Hände. »Das heißt, wenn ich dich sehen könnte.« Seine Brille war beschlagen. Er nahm sie ab und rieb sie mit einem Taschentuch trocken. »Ich würde sagen, das ist der größte Andrang in den letzten sechs Jah-«
»Voll wie ein Bordell am Zahltag, was, Tom?«, unterbrach Granddaddy Jaybird ihn, doch Grandmomma Sarah stieß ihm so hart ihren Ellbogen in die Rippen, dass seine falschen Zähne klickten.
»Es wär schon schön, wenn du mich wenigstens einmal einen Satz zu Ende sprechen lassen würdest«, sagte Grand Austin mit errötenden Wangen zu ihm. »Seit ich hier sitze, schaffe ich es nicht, auch nur drei Worte z-«
»Gut siehst du aus, Junge!«, redete Granddaddy Jaybird weiter und reckte sich an Grand Austin vorbei, um mir einen Klaps aufs Knie zu geben. »Rebecca, du gibst dem Jungen doch genügend Fleisch zu essen, oder? Du weißt doch, dass ein Junge im Wachstum Fleisch für seine Muskeln braucht!«
»Hörst du nicht?«, fragte Grand Austin ihn. Die Röte in seinen Wangen pulsierte förmlich.
»Hör ich was nicht?«, gab Granddaddy Jaybird zurück.
»Mach dein Hörgerät an, Jay«, sagte Grandmomma Sarah.
»Was?«
»Hörgerät!«, schrie sie, offenbar mit ihrer Geduld am Ende. »Mach es an!«
Es versprach ein denkwürdiges Osterfest zu werden.
Alle Leute begrüßten sich, und es kamen immer noch mehr nasse Menschen in die Kirche, während der Regen erneut aufs Dach zu prasseln begann. Granddaddy Jaybird mit seinem langen, ausgemergelten Gesicht und Haaren wie einer weißen Wurzelbürste wollte mit Dad über den Mord sprechen, aber Dad schüttelte den Kopf und ging nicht darauf ein. Grandmomma Sarah fragte mich, ob ich dieses Jahr Baseball spielen würde, und ich sagte ja. Sie hatte ein freundliches Gesicht mit dicken Wangen und blassblaue Augen in einem Nest aus Falten, aber ich wusste, dass Granddaddy Jaybirds Art sie oft vor Wut auf die Palme brachte.
Die Fenster waren wegen des Regens alle geschlossen und die Luft wurde immer schwüler. Die Fußbodenbretter waren nass, die Wände leckten und die Ventilatoren ächzten beim Drehen. Die Kirche roch nach hundert verschiedenen Parfüms, Rasierwassern und Haarwassern, sowie dem süßen Duft der Blumen, die Anzugstaschen und Hüte zierten. Die Mitglieder des Chors kamen in ihren lilafarbenen Gewändern herein. Schon bevor die erste Hymne zu Ende war, schwitzte ich in meinem Hemd. Wir erhoben uns, sangen eine Hymne und setzten uns wieder. Zwei äußerst beleibte Frauen – Mrs. Garrison und Mrs. Prathmore – gingen nach vorn, um über die Kollekte für die Armut leidenden Familien im Adams Valley zu reden. Dann standen wir auf, sangen noch eine Hymne und setzten uns wieder. Meine beiden Großväter hatten Stimmen wie Bullfrösche, die sich in einem Sumpfloch stritten.
Reverend Richmond Lovoy, dick und rundgesichtig, stellte sich an die Kanzel und begann zu predigen, was für ein glorreicher Tag dies war, denn schließlich war Jesus von den Toten auferstanden und so weiter. Dem Reverend hing eine braune Haarsträhne wie ein Komma über sein linkes Auge. An den Schläfen war er ergraut, und jeden Sonntag rissen sich seine nach hinten gebürsteten Haare aus ihrem pomadisierten Halt los, um sich während seines Predigens und Gestikulierens wie eine braune Flut über sein Gesicht zu ergießen. Seine Frau hieß Esther und ihre drei Kinder Matthew, Luke und Joni.
Während Reverend Lovoy im Wettkampf mit dem himmlischen Donner predigte, erkannte ich, wer direkt vor mir saß.
Die Dämonin.
Sie konnte Gedanken lesen. Das war eine von allen akzeptierte Tatsache. Und in dem Moment, in dem ich bemerkte, dass sie vor mir saß, drehte sie den Kopf und starrte mich aus diesen schwarzen Augen an, die selbst eine Hexe mitternachts erstarren lassen konnten. Die Dämonin hieß Brenda Sutley. Sie war zehn Jahre alt, hatte dünne rote Haare und ein blasses Gesicht voller brauner Sommersprossen. Ihre Augenbrauen waren dick wie Raupen und ihre ungleichmäßigen Gesichtszüge sahen aus, als hätte jemand mit der flachen Seite einer Schaufel versucht, darauf ein Feuer auszuschlagen. Ihr rechtes Auge sah größer als das linke aus, ihre Nase war ein Schnabel mit zwei klaffenden Löchern und ihr dünnlippiger Mund schien von einer Seite ihrer Miene zur andern zu wandern. Sie konnte aber nichts dafür; ihre Mutter war ein Feuerhydrant mit roten Haaren und einem braunen Schnurrbart, und gegen ihren rotbärtigen Vater sah selbst ein Zaunpfosten muskulös aus. Bei so viel Rot in der Familie war es kein Wunder, dass Brenda Sutley gruselig war.
Die Dämonin hatte ihren Namen bekommen, weil sie in Kunst einmal ein Bild von ihrem Vater mit Hörnern und einem gespalteten Teufelsschwanz gemalt hatte. Zu Mrs. Dixon, der Kunstlehrerin, und ihren Klassenkameraden hatte sie gesagt, dass ihr Papa hinten in seinem Schrank einen großen Stapel Zeitschriften besaß, in denen Dämonenjungs ihre Schwänze in die Löcher von Dämonenmädchen steckten. Aber die Dämonin hatte nicht nur ihre Familiengeheimnisse gelüftet. Sie hatte einer toten Katze Pennys auf die Augen geklebt und sie am Mitbringtag zur Schule mitgebracht; und sie hatte in Kunst aus grüner und weißer Knete einen Friedhof gebastelt, auf dessen Grabsteinen die Namen und Todesdaten ihrer Mitschüler standen, woraufhin einige Kinder hysterisch wurden, als sie entdeckten, dass sie nicht mal sechzehn werden würden. Außerdem hatte sie eine beunruhigende Schwäche für Streiche mit zwischen Brotscheiben gepresster Hundekacke. Alle erzählten sich, dass sie hinter der Abflussrohrexplosion steckte, als letzten November sämtliche Mädchentoiletten in der Schule mit Papier verstopft waren.
Um es mit einem Wort zu sagen: Sie war unheimlich.
Und jetzt starrte mich ihre königliche Unheimlichkeit an.
Ein langsames Lächeln dehnte ihren schiefen Mund. Ich konnte nicht von ihren durchdringenden schwarzen Augen wegsehen und dachte: Sie hat mich. Das Problem mit Erwachsenen ist, dass sie in Gedanken immer völlig woanders sind, wenn man will, dass sie etwas sehen und eingreifen; und wenn man will, dass sie sich um andere Dinge kümmern, sitzen sie einem auf der Pelle. Ich wollte, dass Dad oder Mom oder sonst wer Brenda Sutley sagte, sie sollte sich wieder umdrehen und Reverend Lovoy zuhören, aber natürlich war es, als hätte die Dämonin sich unsichtbar gemacht. Niemand außer mir, ihrem momentanen Opfer, konnte sie sehen.
Ihre rechte Hand schwebte empor wie der Kopf einer kleinen weißen Schlange mit schmutzigen Fängen. Langsam, mit bösartiger Eleganz, streckte sie den Zeigefinger aus und richtete ihn auf eins ihrer klaffenden Nasenlöcher. Der Finger bohrte sich tief ins Nasenloch, und ich dachte, dass sie ihn immer weiter hochschieben würde, bis ihr gesamter Finger verschwunden war. Doch dann wurde der Zeigefinger wieder herausgezogen. An der Spitze klebte eine grün glänzende Masse von der Größe eines Maiskorns.
Ihre schwarzen Augen blinzelten nicht. Langsam öffnete sich ihr Mund.
Nein, bettelte ich sie telepathisch an. Nein, bitte tu’s nicht!
Die Dämonin schob ihren grünbestückten Finger auf ihre feuchte rosafarbene Zunge zu.
Ich konnte nicht anders, als hinzustarren, während sich mein Magen zu einem harten kleinen Knoten zusammenzog.
Grün auf Rosa. Der Fingernagel dreckig. Ein klebriger, durchhängender Faden.
Die Dämonin leckte sich den Finger an der Stelle ab, an der das grüne Ding gewesen war. Ich musste wohl wild auf der Bank hin und her gerutscht sein, denn Dad packte mein Knie und flüsterte: »Hör zu!« Aber natürlich hatte er weder die unsichtbare Dämonin noch ihren grausamen Folterakt gesehen. Die Dämonin lächelte mich mit befriedigten schwarzen Augen an. Dann drehte sie den Kopf und die Tortur war vorbei. Ihre Mutter strich ihr mit behaarten Fingern über die feurigen Haare, als wäre sie das süßeste kleine Mädchen, dem Gott je seinen Atem geschenkt hatte.
Reverend Lovoy bat die Gemeinde zum Gebet. Ich senkte den Kopf und kniff die Augen zu.
Und etwa fünf Sekunden in das Gebet hinein prallte etwas hart an meinem Hinterkopf ab.
Ich drehte mich um.
Horror packte mich: Direkt hinter mir saßen Gotha und Gordo Branlin mit ihren zinnfarbenen Augen, der gleiche Farbton wie geschärfte Messerklingen. Ihre Eltern waren links und rechts von ihnen tief im Gebet versunken. Ich nahm an, dass sie um Erlösung von ihren Gören beteten. Beide Branlin-Jungs trugen dunkelblaue Anzüge und weiße Hemden. Auch ihre Krawatten sahen ähnlich aus, nur dass Gothas weiß mit schwarzen Streifen war und Gordos rote Streifen hatte. Gotha, der ein Jahr älter als sein Bruder war, hatte die weißer gebleichten Haare; Gordos waren etwas gelblicher. Ihre Gesichter waren wie scheußliche Schnitzereien in braunem Stein, und selbst in ihren Knochen – dem vorspringenden Unterkiefer, Wangenknochen, die fast durch die Haut stießen, eine Stirn wie eine Granitplatte – lag die Andeutung von geballter Wut. In den kurzen Sekunden, die ich es wagte, in diese verschlagenen Visagen zu gucken, stieß mir Gordo seinen ausgestreckten Stinkefinger entgegen. Gotha schob die nächste Erbse in seinen Strohhalm.
»Cory, dreh dich wieder um!«, flüsterte meine Mutter und zupfte an meinem Ärmel. »Mach die Augen zu und bete!«
Das tat ich. Die zweite Erbse prallte an meinem Kopf ab. Die Dinger stachen wie Wespen. Den ganzen Rest des Gebets hindurch konnte ich die Branlins hinter mir wie böse Trolle wispern und kichern hören. Mein Kopf war ihre Zielscheibe des Tages.
Als das Gebet zu Ende war, sangen wir noch eine Hymne. Ankündigungen wurden gemacht und Besucher willkommen geheißen. Die Kollekte wurde gesammelt. Ich steckte einen Dollar, den Dad mit extra dafür gegeben hatte, in das Säckchen. Der Chor sang zum Klavier- und Orgelspiel der Glass-Schwestern. Hinter mir kicherten die Branlins. Dann erhob sich Reverend Lovoy erneut, um seine Osterpredigt zu halten – und in dem Moment landete die Wespe auf meiner Hand.
Ich hatte meine Hand auf mein Knie gelegt. Ich bewegte sie nicht, obwohl die Angst mir wie ein Blitzschlag über den Rücken schoss. Die Wespe zwängte sich zwischen meinen Zeigefinger und Mittelfinger und blieb mit zuckendem blauschwarzem Stachel sitzen.
Lasst mich ein paar Dinge zum Thema Wespen sagen.
Sie sind anders als Bienen. Bienen sind dick und fröhlich und surren von Blume zu Blume, ohne ein Interesse an Menschenfleisch zu haben. Schwebfliegen sind neugierig und temperamentvoll, aber normalerweise so vorhersehbar und vermeidbar wie Bienen. Eine Wespe dagegen, besonders die dunklen, schlanken Wespen, die wie ein Dolch mit Kopf aussehen, ist dazu geboren ihren Stachel in Haut zu versenken und einen Schrei zu entlocken wie ein Weinconnaisseur, der einen guten Jahrgang entkorkt. Wenn man mit dem Kopf gegen ein Wespennest stößt, kann man im Nu das Gefühl haben, mit Schrotkugeln beschossen zu werden, habe ich mir sagen lassen. Ich habe das Gesicht eines Jungen gesehen, der eines Sommers in die Lippen und Augenlider gestochen wurde, als er ein altes verlassenes Haus auskundschaftete – grausam pralle Schwellungen, die ich nicht mal den Branlins wünsche. Wespen sind jenseits von Vernunft und Verstand. Sie stechen ohne Veranlassung oder Sinn. Sie würden dich bis ins Knochenmark stechen, wenn sie ihren Stachel so tief in dir versenken könnten. Sie sind voller Wut, genau wie die Branlins. Wenn der Teufel ein Haustier hat, dann ist es keine schwarze Katze, kein Affe und keine lederhäutige Echse: Es ist schon immer eine Wespe gewesen und wird immer eine sein.
Eine dritte Erbse traf mich am Hinterkopf. Es tat richtig weh. Aber ich starrte mit rasendem Herzen und Gänsehaut auf die Wespe, die zwischen meinen Fingern saß. Etwas flog an meinem Gesicht vorbei, und als ich hochsah, beobachtete ich, wie eine andere Wespe den Kopf der Dämonin umkreiste und oben auf ihren Haaren landete. Die Dämonin musste ein Kitzeln gespürt haben. Sie griff sich an den Kopf und wedelte die Wespe weg, ohne zu wissen, was es gewesen war, und das Insekt flog mit verärgert summenden schwarzen Flügeln hoch. Ich war mir sicher, dass die Dämonin gestochen werden würde, aber die Wespe musste ihre Artgenossen bemerkt haben, denn sie flog zum Dach empor.
Reverend Lovoy ging jetzt ganz in seiner Predigt auf, über die Kreuzigung von Jesus und Marias Tränen und den Stein, der weggerollt wurde.
Ich sah zur Decke hoch.
In der Nähe eines der sich drehenden Ventilatoren war ein kleines Loch, nicht größer als eine Fünfundzwanzig-Cent-Münze. Noch während ich hinsah, kamen drei Wespen heraus und summten zur Gemeinde herunter. Ein paar Sekunden später kamen noch zwei und surrten durch die schwüle parfümierte Luft.
Über der Kirche krachte Donner. Der Lärm des Regens ertränkte fast die wogende Stimme von Reverend Lovoy. Was er sagte, wusste ich nicht; ich sah zwischen der Wespe auf meiner Hand und dem Loch in der Decke hin und her.
Immer mehr kamen heraus, flogen in Spiralen durch die dunstig verrammelte regenfeuchte Kirche. Ich zählte. Acht, neun … zehn … elf. Manche hielten sich an den Flügeln des Ventilators fest und blieben sitzen, als fuhren sie Karussell. Vierzehn … fünfzehn … sechzehn … siebzehn. Eine dunkle, zuckende Faust aus Wespen drückte sich aus dem Loch heraus. Zwanzig … einundzwanzig … zweiundzwanzig. Bei fünfundzwanzig hörte ich auf zu zählen.
Oben im Dachstuhl musste ein Nest sein, dachte ich. Ein ballgroßes Nest, das wie ein Herz im Dunkeln schlägt. Ebenso hypnotisiert wie Maria von dem Fremden auf der Straße gewesen sein musste, der ihr die Wunden an seiner Körperseite zeigte, sah ich ein weiteres Dutzend Wespen aus dem Loch brodeln. Niemand sonst schien es zu bemerken; waren sie so unsichtbar wie die Dämonin, als sie den Popel aus ihrer Nase geholt hatte? Langsam kreisten die Wespen in Imitation der Ventilatoren an der Decke. Inzwischen waren es so viele, dass sie sich zu einer dunklen Wolke verdichten konnten, als hätte das Gewitter einen Weg herein gefunden.
Die Wespe zwischen meinen Fingern bewegte sich. Ich betrachtete sie und zuckte zusammen, als mich eine Erbse am Nacken traf, wo meine Haare kurzrasiert waren. Die Wespe krabbelte über meinen Zeigefinger und machte am Knöchel Halt. Ihr Stachel ruhte auf meiner Haut und ich konnte die winzige scharfe Spitze wie einen Glassplitter spüren.
Reverend Lovoy war jetzt ganz in seinem Element. Er schwenkte die Arme und seine Haare begannen in Richtung Stirn zu rutschen. Draußen krachte der Donner und Regen trommelte aufs Dach. Es tönte wie am Tag des Jüngsten Gerichts, als wäre es an der Zeit ein Boot zu bauen und die Tiere paarweise zusammenzutreiben. Alle außer den Wespen, dachte ich. Diesmal konnten wir Noahs Fehler begleichen. Mit einer Mischung aus Faszination und Furcht beobachtete ich weiter das Loch in der Decke. Mir kam der Gedanke, dass Satan einen Weg gefunden hatte, am Ostergottesdienst teilzunehmen, und dass er auf der Suche nach Fleisch über unseren Köpfen kreiste.
Dann geschahen zwei Dinge gleichzeitig.
Reverend Lovoy hob die Hände und sprach in seinem lauten Predigertonfall: »Und an jenem glorreichen Morgen nach dem finstersten Tag kamen die Engel, und aaaah!« Er hatte seine Hände den Engeln entgegengestreckt und entdeckte plötzlich, dass lauter kleine Flügel auf ihnen herumkrabbelten.
Meine Mom nahm meine Hand, auf der die Wespe saß, und drückte ergriffen zu.
Sie wurde im selben Moment gestochen, in dem die Wespen beschlossen, dass Reverend Lovoys Predigt lange genug angedauert hatte.
Sie schrie auf. Er schrie auf. Es war das Signal, auf das die Wespen gewartet hatten.
Eine blauschwarze Wolke von ihnen, über hundert Stachel stark, ließ sich wie ein Netz auf die Köpfe der eingepferchten Menschen fallen.
Ich hörte Granddaddy Jaybird »Scheißdreck!« brüllen, als er gestochen wurde. Nana Alice gab einen hohen, arienhaften Ton von sich. Die Mutter der Dämonin heulte auf, als Wespen ihren Nacken angriffen. Der Vater schlug mit seinen dürren Armen auf die Luft ein. Die Dämonin fing an zu lachen. Hinter mir krächzten die Branlins vor Schmerzen, hatten ihren Erbsenschießer vergessen. In der ganzen Kirche wurde geschrien und gebrüllt und Menschen in Sonntagsanzügen und -kleidern sprangen auf und kämpften mit der Luft, als hätten sie es mit den Teufeln des Reichs der Unsichtbaren zu tun. Reverend Lovoy tanzte einen Krampf der Qual, schüttelte seine mehrmals gestochenen Hände, als wollte er sie von den Handgelenken schleudern. Alle Chormitglieder waren auf den Beinen und sangen, diesmal allerdings keine Hymnen, sondern Schmerzensschreie, als die Wespen Wangen, Kinns und Nasen stachen. Die Luft war voller dunkel wirbelnder Ströme, die den Menschen ins Gesicht flogen und sich wie Dornenkronen um ihre Köpfe rankten. »Nach draußen! Raus!«, schrie jemand. »Lauft!«, brüllte ein anderer hinter mir. Die Glass-Schwestern waren die Ersten. Die Haare voller Wespen rannten sie auf den Ausgang zu. Plötzlich waren alle auf den Beinen, und was zehn Sekunden zuvor noch friedliche Schafe Gottes gewesen waren, verwandelte sich jetzt in eine panisch flüchtende Herde.
Das ist der Effekt, den Wespen haben.
»Mein verdammtes Bein steckt fest!«, schrie Grand Austin.
»Jay! Hilf ihm!«, kreischte Grandmomma Sarah, aber Granddaddy Jaybird kämpfte sich schon seinen Weg in den von um sich schlagenden Menschen verstopften Gang hinaus.
Dad zog mich auf die Beine. Neben meinem linken Ohr hörte ich ein bösartiges Summen und im nächsten Augenblick wurde ich an den Rand meines Ohrs gestochen; ein so schmerzhafter Stich, dass mir die Tränen in die Augen sprangen. »Au!«, hörte ich mich schreien, obwohl es auf das kleine Au in all dem Gekreische und Gebrüll auch nicht mehr ankam. Aber zwei Wespen hörten mich. Eine traf mich in die rechte Schulter, stach mich durch meine Anzugjacke und mein Hemd hindurch, und die andere flog wie eine afrikanische Lanze auf mein Gesicht zu und punktierte meine Oberlippe. Ich gab einen verzerrten Schrei der Art von mir – auaohauauau –, der Bände über die Intensität des Schmerzes spricht, aber buchstäblich keinen Sinn ergibt. Auch ich kämpfte jetzt gegen die wildgewordene Luft. Irgendjemand kreischte vor Lachen, und als ich mit meinen nassen Augen zur Dämonin hinübersah, entdeckte ich, dass sie grinsend auf der Bank herumhüpfte, das Gesicht mit roten Schwellungen bedeckt.
»Alle nach draußen!«, brüllte Dr. Lezander. Zuckend und stechend klammerten sich drei Wespen an seinen kahlen Kopf. Seine grauhaarige, ernste Frau stand hinter ihm, ihren Osterhut mit den blauen Blüten schief auf dem Kopf und die Schultern voller krabbelnder Wespen. Sie packte ihre Bibel mit der einen Hand, ihre Handtasche mit der anderen, und schlug kraftvoll nach den angreifenden Insektenschwärmen, die Zähne vor entrüsteter Wut zusammengebissen.
Ohne sich um ihre Regenmäntel und Schirme zu kümmern, kämpften die Menschen sich in ihrem Bemühen, vor den Qualen in die Sintflut zu flüchten, durch die Tür. Die Gottesdienstbesucher waren beim Betreten der Kirche ein Muster höflicher christlicher Zivilisation gewesen. Beim Verlassen waren sie durch und durch Barbaren. Frauen und Kinder fielen auf dem matschigen Vorplatz zu Boden, Männer stolperten über sie und landeten mit dem Gesicht zuerst in regengesprenkelten Pfützen. Osterhüte flogen von den Köpfen und rollten wie nasse Räder davon, bis die Sturzbäche sie flach zu Boden schlugen.
Ich half Dad, Grand Austins verkantetes Holzbein aus der Bank vor ihm zu befreien. Wespen flogen meinem Vater gegen die Hände, und jedes Mal, wenn eine zustach, hörte ich ihn scharf den Atem einziehen. Mom, Nana Alice und Grandmomma Sarah versuchten in den Gang vorzustoßen, wo Menschen stolperten, hinfielen und andere mit sich zogen. Reverend Lovoy versuchte mit seinen würstchendick geschwollenen Fingern die Gesichter seiner Kinder zu beschützen, die sich zwischen ihn und die schluchzende Esther gedrängt hatten. Die Chormitglieder hatten sich zerstreut und manche von ihnen hatten ihre Gewänder zurückgelassen. Dad und ich schafften es, Grand Austin in den Gang zu bugsieren. Wespen attackierten seinen Nacken, und seine Wangen waren nass. Dad wischte die Wespen weg, aber dafür umzingelten uns andere wie rachsüchtige Komantschen einen Planwagen. Kinder weinten, Frauen kreischten, und die Wespen griffen immer noch an und stachen. »Raus! Raus!«, rief Dr. Lezander an der Tür und schubste die dort zusammengedrängten Menschen ins Freie. Seine Frau Veronica, stämmig wie ein Bär, packte einen stolpernden Mann und warf ihn förmlich hinaus.
Wir hatten es fast geschafft. Grand Austin kam ins Taumeln, aber Dad hielt ihn auf den Beinen. Meine Mutter pflückte Grandmomma Sarah Wespen aus den Haaren wie Nesselblätter. Zwei heiße Nadeln stachen mich in den Nacken, kurz nacheinander, und es tat weh, als würde mein Kopf explodieren. Dann griff Dad nach meinem Arm und zog und Regen fiel auf meinen Kopf. Wir schafften es alle durch die Tür, aber Dad rutschte in einer Pfütze aus und fiel im Matsch auf die Knie. Ich fasste mir an den Nacken und rannte vor Schmerzen heulend im Kreis, und bald glitschten auch meine Füße unter mir weg und mein Osteranzug machte nähere Bekanntschaft mit Zephyrs Matsch.
Reverend Lovoy kam als Letzter aus der Kirche. Er knallte die Tür zu und lehnte sich mit dem Rücken dagegen, als wollte er das Böse drinnen festhalten.
Donner grollte und krachte. Der Regen hämmerte vom Himmel, schlug uns alle bewusstlos. Manche Kirchenbesucher saßen im Matsch, andere wanderten wie betäubt herum, und einige standen einfach da und ließen sich vom Regen begießen, um ihre heißen Schmerzen zu kühlen.
Mir tat auch vieles weh. Und in meinem Schmerzenswahn stellte ich mir vor, dass die Wespen hinter der geschlossenen Kirchentür feierten. Immerhin war es auch für sie Ostern. Sie waren von den im Winter Gestorbenen auferstanden, der Jahreszeit, die die Nester austrocknet und die schlafenden Larven zu Mumien macht. Sie hatten ihren eigenen Stein weggerollt und waren neugeboren in einen neuen Frühling ausgeschwärmt, und sie hatten uns eine unter die Haut gehende Predigt über die Zähigkeit des Lebens geliefert, die uns wesentlich länger im Gedächtnis bleiben würde als alles, was Reverend Lovoy je hätte sagen können. Jeder von uns hatte die Dornen und Nägel am eigenen Leib gespürt.
Jemand setzte sich neben mich. Ich spürte, wie mir kühler Matsch auf die Stiche im Nacken gedrückt wurde. Ich sah Granddaddy Jaybirds regennasses Gesicht. Seine Haare standen zu Berge, als hätte er in eine Steckdose gefasst.
»Alles in Ordnung mit dir, Junge?«, fragte er.
Er hatte allen von uns den Rücken zugedreht und seine eigene Haut gerettet. Er war ein Feigling und ein Judas gewesen und seine milde Schlammgabe bedeutete mir nichts.
Ich gab ihm keine Antwort, sah einfach durch ihn hindurch. »Gleich geht’s dir wieder gut«, sagte er, stand auf und ging, um nach Grandmomma Sarah zu sehen, die sich an Mom und Nana Alice drängte.
Für mich sah er wie eine halb ersoffene, ausgemergelte Ratte aus.
Wäre ich so groß wie mein Vater gewesen, hätte ich ihm vielleicht einen Faustschlag verpasst. Ich konnte nicht anders, als mich für ihn zu schämen, tief und stechend zu schämen. Und ich konnte nicht anders als mich zu fragen, ob ein Stück von Granddaddy Jaybirds Feigheit nicht auch in mir steckte. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass ich das schon sehr bald herausfinden sollte.
Irgendwo auf der anderen Seite von Zephyr läuteten die Glocken einer weiteren Kirche. Das Läuten drang durch den Regen zu uns wie ein Traum. Ich stand auf. Meine Lippen, Schultern und Nacken pulsierten. Schmerzen lehren einen Demut; selbst die Branlins greinten wie Babys. Ich habe noch nie jemanden großspurig daherkommen sehen, nachdem die Haut gerade mit Wespenstacheln gespickt wurde.
Das Ostergeläut hallte über die wässrige Stadt.
Die Predigt war zu Ende.
Halleluja.