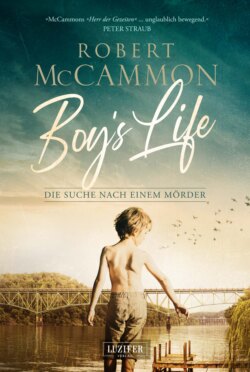Читать книгу BOY'S LIFE - Die Suche nach einem Mörder - Robert Mccammon - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Eine Einladung von der Lady
ОглавлениеNatürlich glaubte mir keiner meiner Freunde.
Davy Ray Callan lachte nur, schüttelte den Kopf und sagte, dass er sich beim besten Willen keine bessere Geschichte ausdenken könnte. Ben Sears sah mich an, als hätte ich im Lyric einen Monsterfilm zu viel gesehen. Johnny Wilson dachte auf seine langsame, sorgfältige Weise eine Weile darüber nach und gab dann seine Meinung ab: »Nee. Das ist nicht passiert.«
»Ist es aber!«, sagte ich ihnen. Wir saßen unter klarem blauem Himmel auf der Veranda meines Hauses im Schatten. »Ist es wirklich, ich schwöre!«
»Oh ja?« Davy Ray, der lebhafteste unserer Truppe, der am häufigsten dazu neigte, erstaunliche Geschichten zu erfinden, legte seinen braunhaarigen Kopf schief. Er starrte mich mit hellblauen Augen an, in denen immer ein Hauch von wildem Gelächter lag. »Und wieso hat Old Moses euch nicht einfach gefressen? Wieso ist ein Monster vor einem Kind mit einem Besen abgehauen?«
»Weil ich meine monstermordende Strahlenpistole nicht dabeihatte«, gab ich gereizt und wütend zurück. »Deshalb! Was weiß ich? Aber es ist passiert und du kannst gern …«
»Cory«, sagte meine Mutter leise von der Tür. »Ich glaube, du hörst jetzt besser auf, darüber zu reden.«
Also tat ich das. Und ich verstand, was sie meinte. Es war nutzlos zu versuchen, jemanden davon zu überzeugen. Selbst meine Mom konnte es nicht ganz verstehen, und das, obwohl Gavin seiner Mutter die gesamte Geschichte erzählt hatte. Übrigens ging es Mr. Thornberry wieder besser. Er hatte überlebt und gewann jeden Tag an Kraft, und ich hatte gehört, dass er gesund werden wollte, damit er Gavin zu mehr Zeichentrickfilmen ins Kino mitnehmen konnte.
Meine Freunde hätten mir aber geglaubt, wenn sie meine Kleidung hätten riechen können, bevor Mom sie weggeworfen hatte. Sie hatte auch ihre eigenen verdorbenen Sachen in den Müll geworfen. Dad hörte sich die Geschichte an, nickte und saß mit gefalteten Händen da, die großen Blasen vom Schaufeln auf seinen Handflächen und Fingern mit Bandagen bedeckt.
»Tja«, meinte Dad. »Alles, was ich sagen kann, ist, dass es seltsamere Dinge auf der Erde gibt, als wir uns erklären können, selbst wenn wir hundert Leben hätten. Ich danke Gott, dass euch beiden nichts passiert ist und dass niemand im Hochwasser ertrunken ist. Was gibt’s denn zum Abendessen?«
Zwei Wochen vergingen. Wir ließen den April hinter uns und genossen die sonnigen Tage des Mais. Der Tecumseh River kehrte in seinen Uferlauf zurück, nachdem er uns daran erinnert hatte, wer hier das Sagen hatte. Ein Viertel der Häuser in Bruton waren nicht mehr bewohnbar, darunter auch Nila Castiles Haus, weshalb man in Bruton fast rund um die Uhr den Lärm von Sägen und Hämmern hörte. Etwas Gutes hatten der Regen und das Hochwasser jedoch gehabt: In der Sonne explodierte die Erde geradezu mit Blumen und Zephyr leuchtete in allen Farben. Rasenflächen waren smaragdgrün, Geißblatt wuchs wie wilde Leidenschaft und Kudzu wucherte auf den Hügeln. Es war fast Sommer.
Ich konzentrierte mich darauf, für die Klausuren zu büffeln. Mathe war noch nie meine Stärke gewesen, und wenn ich nicht den Sommer über Nachhilfe nehmen wollte – der bloße Gedanke brachte mich zum Würgen –, würde ich eine gute Note bekommen müssen.
In meiner Freizeit grübelte ich darüber nach, wie ich es geschafft hatte, Old Moses mit einem Besen in die Flucht zu schlagen. Ich hatte Glück gehabt, dass ich dem Monster den Besen in den Hals gestoßen hatte, das war offensichtlich. Aber ich überlegte, dass es vielleicht auch noch etwas anderes gewesen sein konnte. Trotz seiner Größe und Angriffslust war Old Moses wie Granddaddy Jaybird: Er konnte beeindruckend brüllen, aber sobald er von irgendetwas getroffen wurde, rannte er davon. Oder schwamm davon, in Old Moses‘ Fall. Vielleicht hatte Old Moses sich daran gewöhnt, das zu fressen, was sich nicht wehrte – Welse und Schildkröten und verängstigte Hunde, die um ihr Leben paddelten. Mit einem Besenstiel im Hals hatte Old Moses sich möglicherweise gedacht, dass es da, wo er herkam, leichtere Beute gab; unten auf dem Grund des Flusses im kühlen, schlammigen Bankettsaal, wo nichts zurückbiss.
Zumindest ist das meine Theorie. Testen will ich sie aber nie wieder.
Ich träumte von dem Mann im langen Mantel mit dem grüngefiederten Hut. Ich träumte, dass ich auf ihn zu watete. Als ich ihn am Arm fasste, drehte er mir sein Gesicht zu. Er war ein Mann ohne menschliche Haut, sondern mit rautenförmigen Schuppen in Herbstfarben. Er hatte Zähne wie Dolche und Blut triefte ihm über das Kinn, und ich merkte, dass ich ihn dabei gestört hatte, einen kleinen braunen Hund zu essen, dessen zappelnde vordere Hälfte er in seiner linken Hand hielt.
Es war kein schöner Traum.
Aber vielleicht lag doch etwas Wahrheit darin. Irgendwo.
Ich ging jetzt immer zu Fuß, da ich kein Fahrrad mehr hatte. Zur Schule und nach Hause zu gehen gefiel mir, aber alle meine Freunde hatten Räder, und ich war in unserer Rangordnung definitiv ein Stück zurückgefallen. An einem Nachmittag, an dem ich für Rebel Stöckchen warf und mit ihm auf dem Rasen tobte, hörte ich ein klackerndes Geräusch. Ich sah hoch. Rebel sah ebenfalls hoch. Es war ein Pick-up, der auf unser Haus zufuhr.
Ich kannte das Auto. Es war voller Rostflecken und die Blattfedern hingen durch, und der Lärm, den es machte, brachte die Hunde zum Heulen. Rebel fing an zu bellen. Ich hatte Mühe, ihn zum Schweigen zu bringen. Auf der Ladefläche des Pick-ups war ein Metallrahmen befestigt, an dem eine verwirrende Vielzahl von Werkzeugen hing, von denen die meisten so antik und wertlos wie das Auto aussahen. Sie klickten und klackerten wie die Insassen eines Irrenhauses. Auf der Fahrertür stand in nicht sehr sorgfältigen Buchstaben LIGHTFOOT’S FIX-IT.
Der Pick-up hielt vor unserem Haus an. Von dem Klackern alarmiert kam Mom auf die Veranda heraus, aber Dad war noch für über eine Stunde auf der Arbeit. Die Autotür ging auf und ein großer dünner schwarzer Mann in einem staubigen grauen Overall stieg aus, so langsam, als verursachte ihm jede Bewegung Schmerzen. Er trug eine graue Kappe und seine dunkle Haut war von Staub wie mit Rauch bedeckt. Langsam schlenderte er auf die Veranda zu, und ich muss sagen, dass selbst das plötzliche Auftauchen eines angreifenden Stiers Mr. Marcus Lightfoot vermutlich nicht einen Schritt schneller hätte gehen lassen.
»Guten Tag, Mr. Lightfoot«, sagte Mom, die ihre Schürze umhatte. Sie war in der Küche beschäftigt gewesen und wischte sich die Hände an einem Papiertuch ab. »Wie geht’s?«
Mr. Lightfoot lächelte. Seine kleinen quadratischen Zähne waren blendend weiß. Unter seiner Kappe quollen graue Haare hervor. Er sprach wie das langsame Tropfen eines verstopften Rohrs: »Einen guten Tag wünsche ich auch, Miz Mackenson. Hey, Cory.«
Für Mr. Lightfoot, der seinen Beruf als Zephyrs und Brutons Reparaturmann vor über dreißig Jahren von seinem Vater gelernt hatte, war dies eine schwungvolle Konversation. Mr. Lightfoot war für sein Repariertalent bekannt, und obwohl er so langsam arbeitete, wie ein Zahn wehtat, machte er alles wieder funktionstüchtig, egal, wie rätselhaft das Problem auch sein mochte. »Äußerst schöner …« Er stockte und sah zum Himmel empor. Die Sekunden verstrichen. Rebel bellte und ich legte ihm meine Hand über die Schnauze.
»Tag«, entschied Mr. Lightfoot.
»Ja, das ist er.« Mom wartete, dass er wieder etwas sagte, aber Mr. Lightfoot stand einfach da und betrachtete jetzt unser Haus. Er griff in eine seiner vielen Taschen, holte eine Handvoll Nägel heraus und klickte sie gegeneinander, als wartete auch er auf etwas. »Äh …« Mom räusperte sich. »Kann ich Ihnen irgendwie helfen?«
»Ich fuhr grad vorbei«, antwortete er so langsam wie warmer Sirup. »Wollte wissen, ob Sie« – hier stockte er, um ein paar Sekunden lang die Nägel in seiner Hand zu betrachten – »was repariert haben wollen?«
»Hm, nein. Nicht wirklich. Mir fällt nichts …« Sie hielt inne. Ihr Gesichtsausdruck verriet mir, dass ihr doch etwas eingefallen war. »Der Toaster. Der ist seit vorgestern auf Streik. Ich hatte Sie anrufen wollen, aber …«
»Ja, Ma’am, ich weiß.« Mr. Lightfoot nickte wissend. »Man kommt zu nichts.«
Er ging an sein Auto, um den Werkzeugkasten zu holen, ein altes faszinierendes Ding aus Metall voller Schubladen und anscheinend jeder Schraube und sämtlichen Bolzen, die es unter der Handwerkersonne gab. Er legte sich seinen Werkzeuggürtel um, an dem unterschiedliche Hämmer, Schraubenzieher und vorsintflutlich aussehende Schraubenschlüssel hingen. Mom hielt Mr. Lightfoot die Tür auf, und als er ins Haus stapfte, warf sie mir einen Blick zu und zuckte die Achseln. Ich weiß auch nicht, warum er hier ist, schien sie zu sagen. Ich gab Rebel das zerkaute Stöckchen und ging ebenfalls ins Haus. In der kühlen Küche trank ich ein Glas Eistee und beobachtete Mr. Lightfoot dabei, wie er den Toaster anstarrte.
»Mr. Lightfoot, möchten Sie etwas trinken?«, fragte Mom.
»Nein, Ma’am.«
»Ich habe auch Haferkekse.«
»Nein, Ma’am, vielen Dank.« Aus einer anderen Tasche holte er ein sauberes weißes Tuch und faltete es auseinander. Er legte es auf den Sitz einer der Stühle am Küchentisch. Dann zog er den Stecker des Toasters aus der Steckdose, stellte den Toaster neben seinen Werkzeugkasten auf den Tisch und setzte sich auf das weiße Tuch. All dies geschah in Unterwassergeschwindigkeit.
Mr. Lightfoot wählte einen Schraubenzieher aus. Er hatte die langen, eleganten Finger eines Chirurgen oder Künstlers. Ihm bei der Arbeit zuzusehen zermarterte einem die Geduld, aber niemand konnte behaupten, dass er nicht wusste, was er tat. Er schraubte den Toaster auf und starrte die nackten Grillroste an. »Aha«, sagte er nach einem langen Moment des Schweigens. »Aha.«
»Woran liegt es denn?« Mom spähte über seine Schulter. »Kann man es reparieren?«
»Sehen Sie hier? Den kleinen roten Draht da?« Er tippte mit dem Schraubenzieher dagegen. »Der ist lose.«
»Und sonst ist nichts kaputt? Nur der kleine Draht?«
»Ja, Ma’am, das ist …« Er begann den Draht sorgfältig um das Verbindungsstück zu wickeln. Ihn dabei zu beobachten war fast wie Hypnose. »… alles«, beendete er schließlich seinen Satz. Dann schraubte er den Toaster wieder zusammen, stöpselte ihn ein, drückte den Hebel runter, und wir sahen alle zu, wie die Glühdrähte rot wurden.
»Manchmal …«, sagte Mr. Lightfoot.
Wir warteten. Ich meinte, meine Haare wachsen zu hören.
»… sind’s nur …«
Die Welt drehte sich unter unseren Füßen.
»… die kleinen Dinge.« Er begann sein weißes Tuch zusammenzufalten. Wir warteten, aber dieser Gedankengang war entweder verlorengegangen oder in einer Sackgasse angekommen. Mr. Lightfoot sah sich in der Küche um. »Sonst noch was zu reparieren?«
»Nein, ich glaube, jetzt funktioniert wieder alles.«
Mr. Lightfoot nickte, aber ich konnte sehen, dass er nach kaputten Dingen suchte wie ein Hund nach Wild. Er machte einen langsamen Rundgang durch die Küche, wobei er seine Hände sanft auf den Kühlschrank, Herd und Wasserhahn legte, als ermittelte er den Gesundheitszustand dieser Dinge durch seine Berührung. Mom und ich sahen uns verwirrt an. Mr. Lightfoot benahm sich wirklich seltsam.
»Der Kühlschrank stottert ‘n bisschen«, sagte er. »Soll ich mal gucken?«
»Nein, das brauchen Sie nicht«, antwortete Mom. »Geht es Ihnen gut, Mr. Lightfoot?«
»Sicher, Miz Mackenson. Sicher.« Er machte eine Schranktür auf und lauschte dem leichten Quietschen des Scharniers. Er nahm einen Schraubenzieher von seinem Gürtel und zog die Schrauben sowohl in der einen Schranktür als auch in der nächsten an.
Mom räusperte sich wieder, diesmal recht nervös. »Äh … Mr. Lightfoot, wie viel schulde ich Ihnen für den Toaster?«
»Das ist …«, sagte er, testete die Scharniere der Küchentür, ging dann zu Moms Mixgerät auf der Arbeitsplatte und begann es zu untersuchen. »… schon bezahlt«, sprach er zu Ende.
»Schon bezahlt? Aber … ich verstehe nicht.« Mom hatte bereits das Einmachglas mit dem Kleingeld vom Regal genommen.
»Ja, Ma’am. Ist bezahlt.«
»Aber ich habe Ihnen noch gar kein Geld gegeben.«
Mr. Lightfoot kramte in einer anderen Tasche und zog diesmal einen weißen Umschlag heraus. Er reichte ihn Mom, und ich sah, dass in blauer Tinte Die Mackenson Familie darauf stand. Die Rückseite war mit einem Klecks weißen Wachses versiegelt. »Na«, sagte er schließlich. »Dann bin ich hier wohl heute …« Er nahm seinen Werkzeugkasten. »… fertig.«
»Heute?«, fragte Mom.
»Ja, Ma’am. Sie kennen …« Mr. Lightfoot begutachtete jetzt die Lampen, als wollte er ihre elektrischen Tiefen erkunden. »… meine Nummer ja. Wenn was kaputt ist …« Er lächelte uns an. »… einfach anrufen.«
Wir begleiteten Mr. Lightfoot zur Tür. Er winkte, als er in dem klackernden Pick-up mit den an ihren Haken rasselnden Werkzeugen davonfuhr, während die Nachbarschaftshunde durchdrehten. »Das wird Tom mir nicht glauben«, sagte Mom mehr zu sich selbst. Dann machte sie den Umschlag auf, nahm einen Brief heraus und las ihn. »Hm«, machte sie. »Willst du hören?«
»Ja, Ma’am.«
Sie las mir vor: »Ich würde mich geehrt fühlen, wenn Sie mich diesen Freitag um neunzehn Uhr besuchen würden. Bitte bringen Sie Ihren Sohn mit. Und schau, von wem das ist.« Mom gab mir den Brief und ich sah die Unterschrift.
Die Lady.
Als Dad nach Hause kam, erzählte Mom ihm von Mr. Lightfoot und zeigte ihm den Brief fast noch bevor er seine Milchmannkappe abnehmen konnte. »Was glaubst du, was sie von uns will?«
»Keine Ahnung, aber mir scheint, sie hat beschlossen, uns Mr. Lightfoot als unseren persönlichen Reparaturmann zur Verfügung zu stellen.«
Dad las sich den Brief noch mal durch. »Dafür, dass sie so alt ist, hat sie eine schöne Schrift. Ich hätte gedacht, sie würde zittriger schreiben.« Er kaute an seiner Unterlippe. Ich konnte allein vom Beobachten sehen, dass er nervös wurde. »Weißt du, ich hab die Lady noch nie von Nahem gesehen. Auf der Straße schon, aber …« Er schüttelte den Kopf. »Nein. Ich glaube, ich will nicht zu ihr hin.«
»Was sagst du da?«, fragte Mom ungläubig. »Die Lady will aber, dass wir sie in ihrem Haus besuchen kommen!«
»Ist mir egal.« Dad gab ihr den Brief zurück. »Ich geh da nicht hin.«
»Warum, Tom? Sag mir nur einen einzigen guten Grund.«
»Freitagabend wird das Spiel von den Phillies gegen die Pirates im Radio übertragen«, sagte er und machte es sich in seinem Sessel bequem. »Das ist Grund genug.«
»Das finde ich nicht«, gab Mom zurück und biss die Zähne zusammen.
Hier hatten wir eine seltene Situation: Obwohl ich glaube, dass meine Eltern besser als neunundneunzig Prozent aller Ehepaare in Zephyr miteinander auskamen, stritten sie sich ab und zu. Genauso, wie es keinen perfekten Menschen gibt, kann auch keine Ehe zwischen zwei unvollkommenen Menschen ohne den einen oder anderen Moment der Spannung sein. Ich habe meinen Vater wegen einer unauffindbaren Socke die Geduld verlieren sehen, obwohl der eigentliche Grund seines Ärgers war, dass er auf der Arbeit keine Gehaltserhöhung bekommen hatte. Ich habe meine normalerweise friedfertige Mutter sich über dreckige Schuhabdrücke auf dem sauberen Fußboden aufregen sehen, wenn sie wegen der unfreundlichen Bemerkung eines Nachbarn verstimmt war. In dem verworrenen Netz aus Höflichkeiten und Wutausbrüchen, das unser Leben ist, trug sich das, was jetzt im Haus meiner Eltern heranreifte, immer wieder zu.
»Es ist, weil sie schwarz ist, stimmt’s?«, holte Mom zum ersten Schlag aus. »Das ist der wahre Grund.«
»Nein, ist es nicht.«
»In der Hinsicht bist du genauso schlimm wie dein Daddy. Ich schwöre, Tom …«
»Schweig!«, brüllte er. Selbst ich wich einen Schritt zurück. Mit der Bemerkung über Granddaddy Jaybird, dessen Rassismus allseits bekannt war, hatte sie unter die Gürtellinie gezielt. Dad hatte nichts gegen Schwarze, das wusste ich ohne jeden Zweifel. Aber vergesst nicht, dass Dad unter einem Mann aufgewachsen war, der jeden Morgen der Südstaatenflagge salutierte und dunkle Haut als ein Zeichen des Teufels betrachtete. Für meinen Vater war das eine schreckliche Belastung, da er Granddaddy Jaybird sehr mochte. Aber Dad war davon überzeugt und hatte mich auch so erzogen, dass es eine Sünde war, einen anderen Menschen zu hassen – egal, aus welchem Grund. Seine nächste Bemerkung hatte daher mehr mit Stolz als allem anderen zu tun: »Und ich werde von dieser Frau auch keine Almosen annehmen!«
»Cory«, sagte Mom. »Ich glaube, du hast noch deine Mathehausaufgaben zu machen, oder?«
Ich ging in mein Zimmer, konnte sie aber dennoch hören.
Sie wurden nicht sonderlich laut, eher heftig. Ich nahm an, dass der Streit sich schon seit einer Weile zusammengebraut hatte und sich in vielen verschiedenen Ursachen begründete; dem Auto im See, den Osterwespen, der Tatsache, dass Dad es sich nicht leisten konnte, mir ein neues Fahrrad zu kaufen, den Gefahren des Hochwassers. Als ich hörte, wie Dad zu Mom sagte, dass sie ihm keine Leine um den Hals legen und ihn in das Haus der Lady zerren konnte, bekam ich das Gefühl, dass es darauf hinauslief, dass die Lady ihm Angst machte.
»Nie und nimmer!«, sagte er. »Ich gehe niemanden besuchen, der mit Knochen und alten toten Tieren hantiert und …« Er stockte. Ich nahm an, er merkte selbst, dass er Granddaddy Jaybird beschrieb. »Ich tu’s einfach nicht«, beendete er sein Argument recht lahm.
Mom entschied, dass sie so nicht weiter kam. Ich konnte es ihrem Seufzer anhören. »Ich möchte wissen, was sie will. Hast du was dagegen?«
Stille. Dann, ganz leise: »Nein, hab ich nicht.«
»Und ich möchte Cory mitnehmen.«
Das machte ihn wieder wütend. »Warum? Willst du, dass er sich die Skelette ansieht, die diese Frau in ihrem Schrank hängen hat? Rebecca, ich habe keine Ahnung, was sie will, und es ist mir auch egal! Aber diese Frau spielt mit Voodoo-Puppen und schwarzen Katzen und Gott weiß, womit sonst noch! Ich finde es nicht richtig, Cory in ihr Haus zu bringen!«
»Sie bittet hier in dem Brief darum, dass wir Cory mitbringen. Siehst du das nicht?«
»Ich sehe es. Und ich versteh’s nicht, aber ich sag dir, die Lady versteht keinen Spaß. Erinnerst du dich noch an Burk Hatcher? Der 1958 in der Molkerei ab und zu für den Vorarbeiter eingesprungen ist?«
»Ja.«
»Burk Hatcher hat immer Tabak gekaut. Jede Menge, und er hat ständig ausgespuckt. Das wurde zu ‘ner schlechten Angewohnheit, der er sich nicht mal richtig bewusst war, und ein paarmal – wage es ja nicht, das weiterzusagen – hat er ohne es zu merken in einen Milchbottich gespuckt.«
»Tom! Das ist doch nicht dein Ernst!«
»Oh ja. Jedenfalls ist Burk Hatcher eines Tages die Merchants Street langgegangen – hatte sich grade bei Mr. Dollar die Haare schneiden lassen. Er hatte so dichte, volle Haare, dass er da kaum einen Kamm durchziehen konnte. Und er war in Gedanken und spuckte auf den Gehweg. Nur ist der Tabakbatzen nicht auf dem Gehweg gelandet, sondern auf den Schuhen vom Mondmann. Mitten drauf geklatscht. Soviel ich weiß, war das keine Absicht. Der Mondmann ging nur gerade an ihm vorbei. Na ja, Burk hatte einen komischen Sinn für Humor und fand das witzig. Er fing an zu lachen. Er hat dem Mondmann ins Gesicht gelacht. Und weißt du, was?«
»Was?«, fragte Mom.
»Eine Woche später fingen Burks Haare an auszufallen.«
»Ach, das glaube ich dir nicht!«
»Es stimmt aber!« Die Nachdrücklichkeit, mit der mein Vater sprach, unterstrich, dass zumindest er das glaubte. »Innerhalb eines Monats, nachdem Burk Hatcher dem Mondmann Tabaksaft auf die Schuhe gespuckt hatte, war er kahlköpfiger als eine Billardkugel! Er fing an eine Perücke zu tragen! Jawohl! Das hat ihn fast verrückt gemacht!« Ich konnte mir vorstellen, wie mein Vater sich im Sessel vorlehnte, sein Gesicht so grimmig, dass meine Mutter Mühe hatte, nicht loszulachen. »Und wenn du glaubst, dass die Lady nichts damit zu tun hatte, dann bist du verrückt!«
»Tom, also wirklich! Ich wusste nicht, dass du an schwarze Magie glaubst.«
»Glauben oder nicht, ich hab doch Burks kahlen Kopf gesehen! Mensch, ich kann dir alles Mögliche erzählen, was ich über diese Frau gehört habe! Dass Leuten Frösche aus dem Mund gesprungen sind und Schlangen in der Suppenschüssel liegen und … nee. In das Haus setze ich keinen Fuß!«
»Aber was, wenn es sie verärgert, wenn wir nicht kommen?«, fragte Mom.
Die Frage hing in der Luft.
»Könnte sie uns nicht verwünschen, wenn ich Cory nicht mit zu ihr nehme?«
Ich merkte am Ton ihrer Stimme, dass Mom Dad ein bisschen piesackte. Trotzdem antwortete er nicht. Vermutlich grübelte er über die potenziellen Katastrophen nach, die das Brüskieren der Lady nach sich ziehen konnte.
»Ich finde, ich sollte hingehen und Cory mitnehmen«, fuhr Mom fort. »Um zu zeigen, dass wir sie respektieren. Und bist du nicht ein bisschen neugierig, was sie von uns will?«
»Nein!«
»Überhaupt nicht?«
»Meine Güte«, sagte Dad, nachdem er noch etwas überlegt hatte. »Du kannst auf einer Sache herumreiten, bis einer Kröte die Warzen abfallen. Und vermutlich hat die Lady neben ihrem Mumienstaub und ihren Fledermausflügeln ganze Flaschen davon!«
Das Ergebnis war, dass meine Mutter und ich am Freitagabend, als die Sonne über der dunkler werdenden Erde zu versinken begann und ein kühler Wind durch die Straßen von Zephyr wehte, in den Pick-up stiegen und losfuhren. Dad blieb zuhause. Das Baseballspiel lief im Radio, auf das er gewartet hatte. Aber ich glaube, in Gedanken war er bei uns. Er wollte bloß nicht Gefahr laufen, die Lady durch irgendeine Bemerkung zu verärgern. Ich muss sagen, dass ich selbst nervös war. Unter meinem weißen Hemd und der Krawatte, die meine Mutter mir aufgezwungen hatte, verlor ich immer mehr die Nerven.
In Bruton wurde noch gearbeitet. Die Schwarzen sägten und hämmerten ihre Häuser wieder zusammen. Wir fuhren durch das Geschäftszentrum, ein paar Straßen mit einem Barbier, Lebensmittelgeschäft, Kleidungsladen und anderen Geschäften, die den Einwohnern gehörten. Mom bog auf die Jessamyn Street ab und hielt am Ende der Straße vor einem Haus an, bei dem in allen Fenstern Licht brannte.
Das kleine Holzhaus, das ich bereits erwähnt hatte, war in feurigem Orange, Lila, Rot und Gelb gestrichen. Eine Garage stand daneben, in der wohl der mit Strass bedeckte Pontiac aufbewahrt wurde. Der Rasen war gemäht und ein Weg führte vom Kantstein zur Verandatreppe. Das Haus sah weder angsteinflößend noch wie eine königliche Residenz aus; es war bloß ein Haus und unterschied sich außer der bunten Farbe nicht sonderlich von den anderen Gebäuden der Straße.
Trotzdem schreckte ich zurück, als Mom an meine Seite des Pick-ups kam und meine Tür aufmachte.
»Na komm«, sagte sie. Ihre Stimme klang angespannt, obwohl in ihrer Mimik nichts von ihrer Nervosität zu sehen war. Sie trug eines ihrer besten Sonntagskleider und gute Sonntagsschuhe. »Es ist gleich sieben.«
Sieben, dachte ich. War das nicht eine magische Zahl? »Vielleicht hat Dad recht«, sagte ich. »Vielleicht sollten wir das lieber nicht tun.«
»Es ist doch alles in Ordnung. Schau nur, wie viel Licht brennt.«
Falls mich das beruhigen sollte, funktionierte es nicht.
»Es gibt nichts, wovor du Angst haben musst«, sagte Mom – eine Frau, die sich vor Sorgen verzehrte, dass die graue Isolierungsmasse, die vor kurzem in den Dachstuhl meiner Schule gesprüht worden war, schlecht für die Lungen sein könnte.
Irgendwie schaffte ich es, die Treppe zur Tür hochzugehen. Die Glühbirne auf der Veranda war gelb angestrichen, damit sie keine Insekten anzog. Ich hatte mir den Türklopfer als einen Totenkopf über gekreuzten Knochen vorgestellt. Stattdessen handelte es sich um eine kleine Silberhand. »Also dann«, sagte Mom und klopfte an.
Wir hörten gedämpfte Stimmen und Schritte. Mir fuhr der Gedanke durch den Kopf, dass uns zur Flucht nicht mehr viel Zeit blieb. Mom legte mir den Arm um die Schultern und ich meinte, ihren Pulsschlag spüren zu können. Dann drehte sich der Knauf, die Tür ging auf, und das Haus der Lady lud zum Betreten ein. Ein großer schwarzer Mann mit breiten Schultern, der in einen dunkelblauen Anzug, ein weißes Hemd und eine Krawatte gekleidet war, füllte den Türrahmen aus. Er kam mir so groß und stämmig wie eine Schwarzeiche vor. Seine Hände sahen aus, als könnten sie Bowlingkugeln zerquetschen. Ein Teil seiner Nase schien mit einer Rasierklinge abgeschnitten worden zu sein. Seine Augenbrauen verschmolzen über seiner Nase zu einer einzigen Haarleiste wie ein Werwolfpelz.
In sieben magischen Worten: Er jagte mir eine tierische Angst ein.
»Äh …«, begann Mom. Dann versagte ihr die Stimme. »Äh …«
»Bitte treten Sie, Miz Mackenson.« Er lächelte. Das Lächeln nahm seinem Gesicht etwas des Grauens und ließ es offener wirken. Aber seine Stimme war so tief wie eine Pauke und vibrierte in meinen Knochen. Er trat beiseite und Mom nahm meine Hand und zog mich über die Türschwelle.
Die Tür schloss sich hinter unseren Rücken.
Eine junge Frau mit einer Hautfarbe wie Schokoladenmilch begrüßte uns. Sie hatte ein herzförmiges Gesicht und braune Augen und schüttelte meiner Mutter die Hand. »Ich bin Amelia Damaronde«, sagte sie mit einem Lächeln. »Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen.« Ihre Unterarme waren von Armreifen bedeckt und in jedem ihrer Ohren steckten fünf Goldstecker.
»Danke. Dies ist mein Sohn Cory.«
»Ach, das ist also der junge Mann!« Amelia Damaronde wandte mir ihre Aufmerksamkeit zu. Sie war so energiegeladen, dass es mir vorkam, als stände die Luft zwischen uns unter Strom. »Wie schön, auch dich kennenzulernen. Das hier ist mein Mann Charles.« Der große Mann nickte uns zu. Amelia reichte ihm ungefähr bis an die Achselhöhlen. »Wir kümmern uns um alles für die Lady«, sagte Amelia.
»Aha.« Meine Mutter hielt mich immer noch an der Hand. Ich war damit beschäftigt, mich umzusehen. Die Vorstellungskraft ist seltsam, oder? Sie spannt Spinnweben auf, wo es keine Spinnen gibt, und lässt Dunkelheit fallen, wo es hell ist. Das Wohnzimmer der Lady war kein Teufelstempel, kein Heim der schwarzen Katzen und blubbernden Hexenkessel. Es war ein ganz normales Zimmer mit Sesseln, einem Sofa, einem kleinen Tisch voller Schnickschnack, und an den Wänden standen Bücherregale. Daneben hingen gerahmte Bilder in lebhaften Farben. Eines erregte meine Aufmerksamkeit; es zeigte das Gesicht eines bärtigen schwarzen Mannes, der die Augen entweder gequält oder in Ekstase geschlossen hatte, und der eine Dornenkrone trug.
Ich hatte noch nie zuvor einen schwarzen Jesus gesehen. Der Anblick brachte mich durcheinander und öffnete gleichzeitig einen Teil meines Verstands, von dem ich nicht gewusst hatte, dass er verschlossen gewesen war.
Plötzlich kam der Mondmann durch einen Flur ins Zimmer. Sowohl meine Mutter als auch ich zuckten zusammen, als wir ihn aus nächster Nähe sahen. Der Mondmann trug ein hellblaues Hemd mit aufgekrempelten Ärmeln, schwarze Hose und Hosenträger. An diesem Abend hatte er nur eine einzige Armbanduhr um und statt seiner Kette mit dem riesigen vergoldeten Kruzifix war nur der Halsausschnitt eines weißen T-Shirts zu sehen. Er hatte seinen Zylinder nicht auf; die gesprenkelte Grenze zwischen hellgelblicher und schwarzer Haut setzte sich über seine hohe Stirn bis zu seinen krausen weißen Haaren fort. Sein weißer Kinnbart lief spitz zu und zeigte leicht nach oben. Der Blick seiner dunklen, von Falten umgebenen Augen ruhte erst auf meiner Mutter und dann auf mir. Er lächelte leicht und nickte.
Mit einem dünnen erhobenen Finger bedeutete er uns, ihm in den Korridor zu folgen.
Es war an der Zeit, die Bekanntschaft der Lady zu machen.
»Es geht ihr in letzter Zeit nicht so gut«, sagte Amelia zu uns. »Dr. Parrish hat ihr alle möglichen Vitamine gegeben.«
»Es ist hoffentlich nichts Ernstes?«, entgegnete meine Mutter.
»Der Regen hat ihrer Lunge zu schaffen gemacht. Feuchtes Wetter bekommt ihr nicht, aber seit die Sonne wieder scheint, geht es ihr etwas besser.«
Wir kamen an eine Tür. Der Mondmann öffnete sie. Seine Schultern waren gebrechlich und gebeugt. Ich roch den Duft von verstaubten Veilchen.
Amelia warf zuerst einen Blick in das Zimmer. »Ma’am? Ihr Besuch ist da …«
Laken raschelten. »Bitte«, sagte die zittrige Stimme einer alten Frau, »schick sie herein.«
Meine Mutter holte tief Luft und betrat das Zimmer. Ich musste ihr folgen, da sie immer noch meine Hand umklammerte. Der Mondmann blieb draußen stehen und Amelia sagte, bevor sie sanft die Tür schloss: »Wenn Sie irgendetwas brauchen, rufen Sie bitte.«
Und da war sie nun.
Sie lag in einem weißen Metallbett, den Rücken von einem Brokatkissen gestützt, und hatte das Laken bis über die Brust hochgezogen. Die Wände ihres Schlafzimmers waren mit grünen Palmwedeln und Blättern bemalt, und wäre da nicht das höfliche Summen eines Standventilators gewesen, hätten wir genauso gut am Äquator im Dschungel stehen können. Eine Nachttischlampe brannte, unter der Zeitschriften und Bücher gestapelt waren, und eine Brille mit Drahtgestell lag in Reichweite.
Die Lady starrte uns für einen Moment an und wir starrten zurück. In dem weißen Bett sah sie fast blauschwarz aus. Kein Millimeter ihres Gesichts war ohne Falten. Sie erinnerte mich an diese Puppen mit Köpfen aus Äpfeln, die in der Mittagssonne verschrumpeln. Ich hatte einmal eine Handvoll Schnee gesehen, die von den Rohren des Eishauses abgekratzt worden war; die weichen Wolkenhaare der Lady waren weißer. Sie hatte ein blaues Nachthemd an, dessen Träger über ihren knochigen Schultern lagen, und ihre Schlüsselbeine standen so hoch unter ihrer Haut hervor, dass es schmerzhaft aussah. Ebenso ihre Wangenknochen; sie wirkten so scharf, als könnte man einen Pfirsich daran aufschneiden. Um die Wahrheit zu sagen, sah die Lady nicht anders aus als irgendeine andere uralte, spindeldürre Frau, deren Kopf wegen Schüttellähmung wackelte. Bis auf einen Unterschied.
Ihre Augen waren grün.
Ich meine nicht irgendein gewöhnliches Grün. Ich meine die Farbe von hellen Smaragden, Edelsteinen, nach denen Tarzan in einer der verlorenen Städte Afrikas hätte suchen können. Sie leuchteten, randvoll mit gefangenem brennendem Licht, und wenn man in sie hineinsah, hatte man das Gefühl, als würde einem das tiefste Innere wie eine Sardinenbüchse aufgezogen und etwas daraus gestohlen. Und man hätte vielleicht nicht einmal etwas dagegen; man hätte es vielleicht sogar gewollt. Noch nie zuvor hatte ich derartige Augen gesehen, und ich habe solche auch nie wieder zu Gesicht bekommen. Sie machten mir Angst, aber ich konnte mich nicht abwenden, weil sie von der Schönheit eines wilden Tieres waren, das man stets vorsichtig im Blick behalten muss.
Die Lady blinzelte und ein Lächeln schwang sich auf ihren faltigen Mund. Falls es nicht ihre eigenen Zähne waren, dann war es ein gutes Gebiss. »Was sehen Sie beide schick aus«, sagte sie mit ihrer zittrigen Stimme.
»Danke, Ma’am«, brachte Mom heraus.
»Ihr Mann wollte nicht mitkommen?«
»Äh … nein, er … hört sich im Radio das Baseballspiel an.«
»Ist das seine Entschuldigung, Miz Mackenson?« Sie hob die weißen Augenbrauen.
»Ich … verstehe nicht, was Sie meinen.«
»Manche Leute haben Angst vor mir«, sagte die Lady. »Können Sie das glauben? Angst vor einer hundertsechs Jahre alten Frau! Lieben Sie Ihren Mann, Miz Mackenson?«
»Ja, das tue ich. Sehr.«
»Das ist gut. Starke, wahre Liebe kann einen durch schlimme Zeiten retten. Und ich sage Ihnen, meine Liebe, dass man viele schlimme Zeiten durchmachen muss, um so alt wie ich zu werden.« Die grünen, wundervollen und erschreckenden Augen in dem faltigen schwarzen Gesicht richteten ihre gesamte Kraft auf mich. »Hallo, junger Mann«, sagte sie. »Hilfst du deiner Mama im Haushalt?«
»Ja, Ma’am.« Es kam als Flüstern heraus. Mein Hals war wie ausgetrocknet.
»Trocknest du ab? Räumst du dein Zimmer auf? Fegst du die Veranda?«
»Ja, Ma’am.«
»Das ist gut. Aber ich wette, dass du noch nie einen Besen so benutzt hast wie den in Nila Castiles Haus, oder?«
Ich schluckte hart. Jetzt wussten meine Mutter und ich, worum es ging.
Die Lady grinste. »Ich wünschte, ich wäre dort gewesen. Wirklich!«
»Hat Nila Castile es Ihnen erzählt?«, fragte Mom.
»Das hat sie. Und ich habe mich auch lange mit dem kleinen Gavin unterhalten.« Ihre Augen ließen mich nicht los. »Du hast Gavin das Leben gerettet, junger Mann. Weißt du, wie viel mir das bedeutet?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Nilas Mutter, möge sie in Gott ruhen, war eine gute Freundin von mir. Ich habe Nila sozusagen adoptiert. Gavin war immer wie mein Urgroßenkel für mich. Gavin hat ein gutes Leben vor sich. Du hast dafür gesorgt, dass er es leben kann.«
»Ich hab nur … zugesehen, dass ich selbst nicht gefressen wurde«, sagte ich.
Sie lachte; es war ein keuchendes Geräusch. »Mit einem Besenstiel in die Flucht geschlagen! Gott, mein Gott! Er hatte sich für so ein brutales altes Biest gehalten, gedacht, dass er einfach aus dem Fluss rausschwimmen und sich eine gute Mahlzeit schnappen kann! Aber du hast es ihm gegeben, nicht wahr?«
»Er hat einen Hund gefressen«, sagte ich.
»Ja, so was macht er«, erwiderte die Lady und ihr Lachen versiegte. Ihre dünnen Finger verflochten sich über ihrem Bauch. Sie sah meine Mutter an. »Sie haben Nila und ihrem Daddy geholfen. Deshalb … wenn Sie irgendetwas repariert haben müssen, rufen Sie Mr. Lightfoot an und es wird erledigt. Ihr Junge hat Gavin das Leben gerettet. Darum möchte ich ihm etwas schenken, wenn Sie nichts dagegen haben.«
»Das ist unnötig.«
»Nötig ist nichts«, sagte die Lady und ließ etwas Verärgerung aufblitzen, was mir den Eindruck vermittelte, dass sie in jüngeren Jahren wohl kein allzu umgänglicher Mensch gewesen war. »Deswegen will ich das ja.«
»Na gut«, sagte Mom ganz eingeschüchtert.
»Junger Mann?« Die Lady richtete ihren Blick wieder auf mich. »Was möchtest du gern haben?«
Ich überlegte. »Egal, was?«, fragte ich.
»Natürlich nichts Übertriebenes«, sagte Mom nachdrücklich.
»Egal, was«, bestätigte die Lady.
Ich dachte noch ein bisschen nach, aber die Entscheidung fiel mir nicht schwer. »Ein Fahrrad. Ein neues Fahrrad, das vorher noch nie jemandem gehört hat.«
»Ein neues Fahrrad.« Sie nickte. »Eines, das einen Scheinwerfer hat?«
»Ja, Ma’am.«
»Willst du eine Hupe dran haben?«
»Das wäre toll«, sagte ich.
»Soll es ein ganz schnelles sein? Schneller, als ‘ne Katze einen Baum hochspringen kann?«
»Ja, Ma’am.« Jetzt wurde ich ganz aufgeregt. »Oh ja!«
»Dann wirst du das auch bekommen! Sobald ich meine alten Knochen aus dem Bett bewegen kann.«
»Das ist äußerst nett von Ihnen«, sagte Mom. »Wir sind Ihnen sehr dankbar. Aber Corys Vater und ich können eines vom Laden abholen, wenn das …«
»Es wird nicht aus einem Laden kommen«, unterbrach die Lady sie.
»Verzeihung?«, fragte Mom.
»Nicht aus einem Geschäft.« Sie wartete, um sicherzugehen, dass meine Mom sie verstand. »Im Laden gekauft ist nicht gut genug. Das wäre nichts Besonderes. Junger Mann, du willst doch ein ganz besonderes Fahrrad haben, oder nicht?«
»Ich … denke, ich werde froh sein über das, was ich kriege, Ma’am.«
Darüber musste sie wieder lachen. »Na, du bist ja ein kleiner Gentleman! Also, Mr. Lightfoot und ich werden die Köpfe zusammenstecken und sehen, was wir machen können. Geht das in Ordnung für dich?«
Ich sagte ja, aber um ehrlich zu sein verstand ich nicht ganz, wie mir das ein brandneues Fahrrad einbringen sollte.
»Komm mal her«, sagte die Lady zu mir. »Komm mal ganz nah ans Bett hier.«
Mom ließ mich los. Ich ging an die Seite des Bettes, und die grünen Augen leuchteten vor mir wie Geisterlampen.
»Was machst du noch gern, außer Fahrrad zu fahren?«
»Baseball spielen. Ich lese gern. Ich schreibe gern Geschichten.«
»Du schreibst Geschichten?« Ihre Augenbrauen schossen wieder in die Höhe. »Heiliger Herrgott, wir haben hier einen Schriftsteller vor uns?«
»Cory hat schon immer Bücher gemocht«, erklärte Mom. »Er schreibt kurze Geschichten über Cowboys und Detektive und …«
»Monster«, sagte ich. »Manchmal.«
»Monster«, wiederholte die Lady. »Wirst du über Old Moses schreiben?«
»Vielleicht.«
»Wirst du irgendwann ein Buch schreiben? Vielleicht über diese Stadt, und alle, die hier wohnen?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Ich weiß nicht.«
»Schau mir in die Augen«, sagte sie. Ich tat es. »Ganz tief«, sagte sie. Ich gehorchte.
Und dann geschah etwas Sonderbares. Sie begann zu reden, und als sie sprach, schien die Luft zwischen uns wie Perlmutt zu schillern. Ihre Augen hielten meine gefangen; ich konnte nicht wegsehen. »Mich hat man ein Monster genannt«, sagte die Lady. »Und noch Schlimmeres als ein Monster. Als ich nicht viel älter war als du, habe ich gesehen, wie meine Momma umgebracht wurde. Eine Frau, die eifersüchtig auf sie war, hat sie vergiftet. Ich schwor, dass ich diese Frau finden würde. Sie trug ein rotes Kleid und hatte einen Affen auf ihrer Schulter sitzen, der ihr Dinge zugeraunt hat. Ihr Name war LaRouge. Habe mein ganzes Leben gebraucht, um sie zu finden. Ich bin in Lepersville gewesen und habe ein Boot durch überflutete Herrenhäuser gerudert.« In dem schillernden Nebel begann ihr Gesicht die Falten zu verlieren. Sie wurde immer jünger, als ich sie anstarrte. »Ich habe die Toten herumspazieren sehen. Meine beste Freundin hatte eine Schuppenhaut wie ein Fisch und kroch auf dem Bauch.« Ihr Gesicht war jetzt noch jünger. Ihre Schönheit begann, mein Gesicht zu versengen. »Ich habe Schnitter Tod gesehen. Ich habe Satan ins Auge gespuckt und in den Sälen des Okkulten getanzt.« Sie war ein Mädchen mit langen schwarzen Haaren, ihre Wangenknochen hoch und stolz, ihr Kinn spitz, ihre Augen erschreckend mit all ihren Erinnerungen. »Ich habe gelebt«, sagte sie mit ihrer klaren starken Stimme. »Hundert Leben, und ich bin noch nicht tot. Kannst du mich sehen, junger Mann?«
»Ja, Ma’am«, antwortete ich und hörte mich selbst wie aus großer Ferne. »Ich kann Sie sehen.«
Der Bann zerbrach so schnell wie ein Herzschlag. Eben hatte ich noch eine wunderschöne junge Frau angesehen und im nächsten Moment war die Lady wieder so, wie sie tatsächlich war; hundertsechs Jahre alt. Ihre Augen wurden etwas kühler, aber mir war, als hätte ich Fieber.
»Vielleicht wirst du eines Tages meine Lebensgeschichte aufschreiben«, sagte die Lady. Es klang mehr wie ein Befehl als ein Vorschlag. »So, und wie wär’s, wenn du jetzt rausgehst und mit Amelia und Charles zusammensitzt, während ich mit deiner Momma rede?«
Ich sagte ja. Als ich an Mom vorbei zur Tür ging, waren meine Beine wie aus Gummi. An meinem Kragen hatte sich Schweiß gesammelt. An der Tür kam mir ein Gedanke, und ich drehte mich zum Bett um. »Entschuldigung, Ma’am?«, sagte ich. »Haben Sie … äh … irgendwas, das mir helfen würde, die Mathearbeit zu bestehen? Ich meine, einen Zaubertrank oder so was?«
»Cory!«, ermahnte meine Mutter mich.
Aber die Lady lächelte nur. »Das habe ich, junger Mann«, sagte sie. »Richte Amelia aus, dass sie dir Zaubertrank Zehn geben soll. Danach gehst du nach Hause und lernst ganz, ganz doll, mehr, als du je gebüffelt hast. So doll, dass du im Schlaf rechnen kannst.« Sie hob einen Finger. »Damit sollte es gut sein.«
Ich verließ das Zimmer und schloss die Tür hinter mir. Ich konnte den Zaubertrank kaum erwarten.
»Zaubertrank Zehn?«, fragte Mom.
»Ein Glas Milch mit ein bisschen Muskatnussaroma«, sagte die Lady. »Amelia und ich haben eine ganze Liste von Zaubertränken für Leute, die ein bisschen extra Mut oder Selbstvertrauen oder dergleichen brauchen.«
»So zaubern Sie also?«
»So ziemlich. Man muss den Leuten nur einen Schlüssel geben, dann können sie ihre Schlösser selbst aufschließen.« Die Lady legte den Kopf schief. »Aber es gibt noch andere Arten von Zauberei. Wegen denen muss ich mit Ihnen reden.«
Meine Mutter schwieg. Sie ahnte nicht, was gleich kommen würde.
»Ich habe Träume«, sagte die Lady. »In letzter Zeit träume ich, wenn ich schlafe und wenn ich wach bin. Die Dinge sind nicht mehr im Lot. Auf der anderen Seite ist auch alles durcheinander.«
»Auf der anderen Seite?«
»Da, wo die Toten hingehen«, sagte sie. »Auf der anderen Seite vom Fluss. Nicht dem Tecumseh. Dem breiten dunklen Fluss, an dem ich bald stehen werde. Dann werde ich einen Blick zurückwerfen und lachen und sagen: Das war also, worum es ging!«
Mom schüttelte verständnislos den Kopf.
»Alles ist durcheinander«, fuhr die Lady fort. »Im Land der Lebenden und in der Welt der Toten. Ich wusste, dass irgendetwas nicht stimmt, als Damballah sein Fressen verweigerte. Jenna Velvadine hat mir erzählt, was am Ostermorgen in Ihrer Kirche passiert ist. Das war auch die Geisterwelt.«
»Es waren Wespen«, sagte Mom.
»Für Sie waren es Wespen. Für mich war es eine Botschaft. Jemand auf der anderen Seite hat furchtbare Schmerzen.«
»Ich kann nicht …«
»Verstehen«, beendete die Lady Moms Satz. »Ich weiß. Ich begreife es auch nicht immer. Aber die Sprache der Schmerzen verstehe ich. Die habe ich von Kindesbeinen an gesprochen.« Die Lady streckte den Arm nach ihrem Nachttisch aus, öffnete eine Schublade und nahm ein liniertes Blatt Papier heraus. Sie reichte es meiner Mutter. »Erkennen Sie das wieder?«
Mom starrte auf das Papier. Darauf war eine Bleistiftzeichnung zu sehen. Anscheinend ein Totenschädel mit Flügeln an den Schläfen.
»In meinem Traum sehe ich einem Mann mit dieser Tätowierung an der Schulter. Ich sehe ein Paar Hände. In einer Hand ist ein mit schwarzem Klebeband umwickelter Schlagstock – wir nennen so was einen Crackerknüppel –, und in der anderen ein Draht. Ich kann Stimmen hören, aber nicht verstehen, was gesagt wird. Irgendwer schreit, und da ist ganz laute Musik.«
»Musik?« Mom war kalt. Sie hatte den geflügelten Totenkopf von Dads Beschreibung der Leiche im Auto wiedererkannt.
»Entweder eine Schallplatte«, sagte die Lady, »oder jemand verprügelt ein Klavier. Ich habe es Charles erzählt. Er hat mich an einen Artikel erinnert, den ich im März im Journal gelesen habe. Es war doch Ihr Mann, der einen Toten im Saxon’s Lake untergehen gesehen hat, oder?«
»Ja.«
»Könnte das hier irgendetwas damit zu tun haben?«
Mom atmete tief ein, hielt die Luft an und atmete aus. »Ja«, sagte sie.
»Das dachte ich mir. Kann Ihr Mann gut schlafen?«
»Nein. Er … hat schlimme Träume. Von dem See und … dem Mann im Wasser.«
»Er versucht Ihren Mann zu erreichen«, sagte die Lady. »Er versucht, seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ich bekomme die Botschaft bloß mit wie ein Mithörer am Telefon.«
»Botschaft?«, fragte Mom. »Was für eine Botschaft?«
»Das weiß ich nicht«, gab die Lady zu. »Aber diese Art von Qualen können einen Menschen garantiert um den Verstand bringen.«
Tränen begannen meiner Mom die Sicht zu verwischen. »Ich … kann nicht … ich …« Ihre Stimme versagte. Eine Träne rann ihr über die Wange wie Quecksilber.
»Zeigen Sie ihm das Bild. Sagen Sie, er soll mich besuchen kommen, wenn er darüber reden möchte. Sagen Sie ihm, er weiß, wo ich wohne.«
»Er wird nicht kommen. Er hat Angst vor Ihnen.«
»Sagen Sie ihm, dass es ihn in Stücke zerreißen wird, wenn er nichts unternimmt«, erwiderte die Lady. »Sagen Sie ihm, dass ich die beste Verbündete sein kann, die er je hatte.«
Mom nickte. Sie faltete das Blatt zu einem Quadrat zusammen und krallte ihre Finger darum.
»Wischen Sie sich die Augen ab«, riet die Lady ihr. »Wir wollen den jungen Mann nicht beunruhigen.« Nachdem meine Mutter sich wieder einigermaßen beruhigt hatte, grunzte die Lady zufrieden. »Na bitte. Nun sehen Sie wieder hübsch aus. Und jetzt gehen Sie und sagen dem jungen Mann, dass er sein neues Fahrrad bekommt, sobald ich es arrangieren kann. Und sehen Sie zu, dass er seine Hausaufgaben macht. Zaubertrank Zehn wirkt nicht, wenn die Momma oder der Daddy keine Regeln aufstellen.«
Meine Mutter bedankte sich bei der Lady für ihre Freundlichkeit. Sie sagte, sie würde mit meinem Vater darüber reden, ihr einen Besuch abzustatten, dass sie aber nichts versprechen konnte. »Ich erwarte ihn, wenn ich ihn sehe«, sagte die Lady. »Kümmern Sie sich nur um sich und Ihre Familie.«
Mom und ich verließen das Haus und gingen zu unserem Pick-up. In meinen Mundwinkeln klebte noch ein kleiner Rest Zaubertrank Zehn. Ich fühlte mich bereit, das Mathebuch auseinanderzunehmen.
Wir verließen Bruton. Der Fluss strömte sanft zwischen seinen Ufern entlang. Der Abendwind hauchte durch die Zweige und in den Fenstern glühte Licht, wo die Menschen ihr Abendessen beendeten. Mir gingen zwei Dinge im Kopf herum; das unvergesslich schöne Gesicht einer jungen Frau mit grünen Augen und ein neues Fahrrad mit einer Hupe und einer Lampe.
Meine Mutter dachte an einen toten Mann, dessen Leiche auf dem Grund des Sees lag, dessen Geist aber die Träume meines Vaters und jetzt auch die der Lady heimsuchte.
Es war fast Sommer und sein Geruch nach Geißblatt und Veilchen durchtränkte das Land.
Irgendwo in Zephyr spielte jemand Klavier.