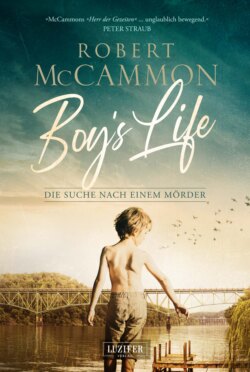Читать книгу BOY'S LIFE - Die Suche nach einem Mörder - Robert Mccammon - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Old Moses kommt zu Besuch
ОглавлениеMom war ans Telefon gegangen, als es ungefähr eine Woche nach unserem Besuch bei Mr. Sculley abends nach zehn Uhr klingelte.
»Tom!«, sagte sie mit einem hektischen Ton in der Stimme. »J.T. sagt, dass der Damm am Lake Holman brechen wird! Sie trommeln alle am Gericht zusammen!«
»Oh Gott!« Dad sprang vom Sofa auf, wo er im Fernsehen die Nachrichten geschaut hatte, und zog sich Schuhe an. »Das gibt garantiert eine Flut! Cory!«, rief er. »Zieh dich an!«
Sein Ton verriet mir, dass ich mich besser schnell in Bewegung setzte. Ich legte die Geschichte weg, die ich über einen schwarzen Dragster mit einem Gespenst am Steuer zu schreiben versuchte, und sprang fast in meine Jeans. Wenn deine Eltern Angst haben, fängt dein Herz an, neunzig Meilen die Minute zu hämmern. Ich hatte Dad Flut sagen hören. Die letzte hatte es gegeben, als ich fünf war, und außer, dass die Schlangen aus dem Sumpf kamen, hatte sie nicht viel Schaden verursacht. Von dem, was ich über Zephyr gelesen hatte, wusste ich aber, dass der Fluss 1938 die Straßen mehr als einen Meter hoch überflutet hatte, und dass das Frühlingshochwasser 1930 einigen Häusern in Bruton fast bis an die Dachgiebel gestiegen war. Meine Stadt neigte dazu, äußerst nass zu werden, und mit all dem Regen, den wir und der Rest des Südens seit April bekommen hatten, war nicht abzuschätzen, was dieses Jahr passieren würde.
Lake Holman war die Quelle des Tecumseh River, etwa vierzig Meilen nördlich von uns. Da alle Flüsse ins Meer fließen, stand uns also etwas bevor.
Ich sah nach, dass Rebel in seinem Zwinger hinter dem Haus nicht in Gefahr war, dann klemmten meine Mom, Dad und ich uns in den Pick-up und fuhren zum Gerichtshaus, einem alten gotischen Bauwerk, das am Ende der Merchants Street stand. So gut wie überall war Licht an; die Nachricht verbreitete sich in Windeseile. Jetzt nieselte es nur, aber da die Kanalisation überflutet war, stand das Wasser unserem Auto bis an die Felgen. Manche Einwohner hatten überflutete Keller; aus genau diesem Grund war mein Freund Johnny Wilson mit seinen Eltern vorübergehend zu Verwandten nach Union Town gezogen.
Autos und Pick-ups bevölkerten den Gerichtsparkplatz. In der Ferne zuckten Blitze über den Himmel und die tiefhängenden Wolken leuchteten auf. Die Menschen wurden in den Konferenzsaal des Gerichtsgebäudes gescheucht, einen großen Raum mit einem Wandbild an der Decke, das Engel zeigte, die Baumwollballen umflogen. Das Bild war ein Überbleibsel von den Baumwollauktionen, die hier bis vor zwanzig Jahren abgehalten wurden, bevor die Baumwollfabrik mit ihren Lagerhallen ins flutsichere Union Town umgesiedelt wurde. Zum Glück fanden wir noch auf einer der roh gezimmerten Bänke Platz, denn es strömten so viele Menschen herein, dass bald kaum noch genügend Platz zum Atmen blieb. Jemand hatte die gute Idee, die Ventilatoren anzumachen, aber die heiße Luft, die den Menschen aus dem Mund stieg, schien unerschöpflich zu sein. Mrs. Kattie Yarbrough, eine der größten Plaudertaschen der Stadt, quetschte sich neben Mom und begann aufgeregt zu plappern, während ihr Mann, der auch für Green Meadows als Milchmann arbeitete, meinen Vater in die Zange nahm. Ich sah Ben mit Mr. und Mrs. Sears hereinkommen, aber sie setzten sich auf die andere Seite des Saals. Die Dämonin, deren Haare aussahen, als wären sie frisch mit Fett gekämmt worden, kam mit ihrer monströsen Mutter und ihrem spindeldürren Vater auf den Fersen herein. Sie fanden in unserer Nähe Plätze, und ich erschauderte, als die Dämonin meinen angewiderten Blick auffing und mich angrinste. Reverend Lovoy kam mit seiner Familie herein, Sheriff Amory und seine Frau und Töchter, die Branlins und Mrs. Parlowe, Mr. Dollar, Davy Ray und seine Eltern, Miss Blauglas und Miss Grünglas kamen, und noch viele andere Menschen, die ich weniger gut kannte. Es war voll.
»Ruhe, allesamt! Ruhe!« Mr. Wynn Gillie, der Vizebürgermeister, war an das Podium getreten, an dem früher der Auktionator gestanden und die Baumwolle versteigert hatte. Hinter ihm saßen Bürgermeister Luther Swope und Hauptbrandmeister Jack Marchette, der auch dem Zivilschutz vorstand, an einem Tisch. »Ruhe!«, brüllte Mr. Gillie. An seinem dürren Hals standen die Adern hervor. Das Gerede versiegte und Bürgermeister Swope erhob sich, um zu sprechen. Er war groß und schlank, ungefähr fünfzig Jahre alt und hatte ein langes, ernstes Gesicht. Seine grauen Haare waren von den Geheimratsecken aus nach hinten gekämmt. Er paffte stets eine Bruyèrepfeife wie eine Lokomotive, die an einem langen, steilen Hang Kohle verbrennt. Er trug immer Hosen mit perfekter Bügelfalte und Hemden, auf deren Brusttasche seine Initialen gestickt waren. Er sah wie ein erfolgreicher Geschäftsmann aus, und das war er auch: Ihm gehörten sowohl der Stagg Shop for Men als auch Zephyrs Eishaus, das sich schon seit Jahren im Besitz seiner Familie befand. Seine Frau, Lana Jean, saß neben Dr. Curtis Parrish und der Gattin des Arztes, Brightie.
»Ich nehme an, dass inzwischen alle die schlechten Nachrichten gehört haben«, begann Bürgermeister Swope. Er wirkte wie ein versierter Politiker, aber er redete, als hätte er den Mund voll mit Haferbrei. »Leute, uns bleibt nicht viel Zeit. Chief Marchette sagt, dass der Fluss schon die Hochwassermarke erreicht hat. Wenn der Damm von Lake Holman bricht, haben wir ‘n echtes Problem. Könnte die schlimmste Flutkatastrophe sein, die wir je erlebt haben. Was heißt, dass Bruton zuerst überflutet wird, weil’s am nahesten am Fluss liegt. Vandy, wo sind Sie?« Der Bürgermeister ließ den Blick durch den Saal schweifen. Mr. Vandercamp Senior hob seine arthritische Hand. »Mr. Vandercamp wird den Baumarkt öffnen«, sagte Bürgermeister Swope. »Er hat Schaufeln und Sandsäcke, mit denen wir unsern eigenen Damm zwischen Bruton und dem Fluss bauen können. Vielleicht können wir das Schlimmste vom Hochwasser eindämmen. Was bedeutet, dass alle mit anpacken müssen; Männer, Frauen und auch Kinder. Ich hab die Robbins Air Force Base angerufen. Sie senden uns ein paar Männer zur Hilfe. Aus Union Town kommen auch noch Leute. Jeder, der arbeiten kann, sollte also rüber nach Bruton fahren und sich bereithalten, Sand zu schaufeln.«
»Einen verdammten Moment mal, Luther!«
Der Mann, der soeben gerufen hatte, stand auf. Sein Anblick konnte einem nicht entgehen. Ich glaube, ein Buch über einen weißen Wal war nach ihm benannt worden. Mr. Dick Moultry hatte ein hochrot geschwollenes Gesicht und trug seine Haare so kurz rasiert, dass sie wie ein braunes Nadelkissen aussahen. Er hatte ein T-Shirt in der Größe eines Zelts an und Bluejeans, die meinem Dad, Chief Marchette und Bürgermeister Swope zusammen gepasst hätten. Er hob einen speckigen Arm und zeigte mit dem Finger auf den Bürgermeister. »Mir scheint, du willst, dass wir unsere eigenen Häuser vergessen! Jawohl! Unsere eigenen Häuser vergessen und uns abrackern, um einen Haufen Neger zu retten!«
Dieser Kommentar trieb einen Keil in den bisherigen Gemeinschaftssinn der Versammlung. Einige riefen, dass Mr. Moultry das falsch sah, andere brüllten, er hätte recht.
»Dick«, sagte Bürgermeister Swope und schob sich die Pfeife in den Mund. »Du weißt, dass das Hochwasser immer in Bruton anfängt. Das ist Tiefland. Wenn wir das Wasser da eindämmen können, dann …«
»Und wo sind die Leute aus Bruton?«, fragte Mr. Moultry. Sein großer quadratischer Kopf drehte sich nach links und rechts. »Ich sehe hier kein schwarzes Gesicht! Wo sind sie? Wieso sind sie nicht hier und fragen uns um Hilfe?«
»Weil sie nie um Hilfe fragen.« Der Bürgermeister stieß eine blaue Rauchwolke aus: Die Lokomotive wurde angeheizt. »Ich kann dir garantieren, dass sie jetzt in diesem Augenblick am Fluss sind und versuchen einen Damm zu bauen, aber um Hilfe würden sie nicht fragen, selbst wenn ihnen das Wasser bis ans Dach steht. Die Lady würde das nie erlauben. Aber sie brauchen unsere Hilfe, Dick. Genau wie letztes Mal.«
»Wenn die auch nur einen Funken Verstand hätten, würden sie da wegziehen!«, beharrte Mr. Moultry. »Scheiße auch, ich hab die Schnauze voll von dieser verdammten Lady! Was bildet die sich eigentlich ein, wer sie ist, eine verdammte Königin?«
»Setz dich wieder hin, Dick«, wies Chief Marchette ihn an. Der Hauptbrandmeister war ein großer Mann mit einem markanten Gesicht und stechend blauen Augen. »Wir haben keine Zeit, darüber zu streiten.«
»Schwachsinn!« Mr. Moultry hatte beschlossen, starrköpfig zu sein. Sein Gesicht lief so rot an wie ein Feuerhydrant. »Lass die Lady Fuß aufs Land von uns Weißen setzen und uns um Hilfe fragen!« Das rief einen Sturm von Beifallsrufen und Gegenstimmen hervor. Mr. Moultrys Frau Feather stellte sich neben ihn und brüllte: »Himmel und Hölle, ja!« Sie hatte platinblonde Haare und war alles andere als federleicht. Mr. Moultry grölte über den Lärm hinweg: »Ich reiß mir doch nicht für Neger den Arsch auf!«
»Aber Dick«, sagte Bürgermeister Swope verwirrt, »es sind doch unsere Neger.«
Das Geschrei und Gegröle ging weiter. Manche Menschen sagten, es sei unsere Pflicht als Christen, Bruton davor zu bewahren, überflutet zu werden, und andere machten ihre Hoffnung laut, dass das Hochwasser Bruton ein für alle Mal von der Landkarte waschen würde. Meine Eltern waren still wie auch die meisten anderen; es war ein Krieg der Schreihälse.
Plötzlich breitete sich Stille aus. Sie begann hinten im Saal, wo eine Menschentraube in der Tür stand. Jemand lachte, aber das Lachen erstickte fast sofort. Ein paar Leute murrten und grummelten. Und dann betrat ein Mann den Saal. Man hätte den Eindruck bekommen können, dass das Rote Meer sich teilte, so wie die Menschen vor ihm zurückwichen, damit er Platz hatte.
Der Mann lächelte. Er hatte ein jungenhaftes Gesicht und braune Haare, die über eine hohe Stirn hingen.
»Was soll denn das Geschrei?«, fragte er. Er sprach mit Südstaatenakzent, aber man hörte, dass er ein gebildeter Mann war. »Gibt es hier Probleme, Bürgermeister Swope?«
»Äh … nein, Vernon. Keine Probleme. Oder, Dick?«
Mr. Moultry sah aus, als wollte er ausspucken und eine Grimasse ziehen. Das Gesicht seiner Frau unter den platinblonden Locken war so rot wie eine Rübe. Ich hörte die Branlins kichern, aber irgendwer brachte sie zum Schweigen.
»Ich hoffe, dass es keine Probleme gibt«, sagte Vernon, der immer noch lächelte. »Sie wissen doch, wie sehr Daddy Probleme hasst.«
»Setzt euch hin«, wies Bürgermeister Swope die Moultrys an und sie gehorchten. Ihre Hinterteile brachten fast die Bank zum Einsturz.
»Ich spüre … Uneinigkeit«, sagte Vernon. Mir wäre fast ein Kichern aus dem Hals entkommen, aber mein Vater packte mein Handgelenk und drückte so fest zu, dass es mir wieder verging. Andere Menschen rutschten unruhig auf ihren Plätzen umher, besonders einige der älteren Witwen. »Bürgermeister Swope, darf ich ans Podium treten?«
»Gott, hilf uns«, flüsterte mein Vater. Meine Mom bebte unter einem stillen Lachen, das ihr gegen die Rippen schlug.
»Äh … ich … denke schon, Vernon. Klar. Komm her.« Bürgermeister Swope trat einen Schritt zurück, den Kopf in Schwaden von Pfeifenrauch gehüllt.
Vernon Thaxter trat ans Podium und sah auf die versammelten Menschen. Im Licht der Lampen wirkte er sehr blass. Sein ganzer Körper war blass.
Er war splitternackt. Hatte kein Stück Kleidung am Leib.
Sein Dödel und seine Eier hingen für alle zu sichtbar. Er war ein dünner Mann, wahrscheinlich weil er immer zu Fuß ging. Die Sohlen seiner Füße mussten hart wie getrocknetes Leder sein. Regen glänzte auf seiner weißen Haut und seine Haare waren nass davon. Er sah wie dunkelhäutiger Hindu-Mystiker aus, den ich in einem meiner National Geographics gesehen hatte, nur dass er natürlich weder dunkelhäutig noch ein Hindu war. Ich muss auch zugeben, dass er kein Mystiker war. Vernon Thaxter war ganz einfach absolut und vollkommen verrückt.
Natürlich war es für Vernon Thaxter nichts Neues, splitternackt in der Stadt herumzulaufen. Er tat das immer, sobald es warm genug war. Im Spätherbst oder Winter dagegen sah man ihn nicht oft. Wenn er im Frühling das erste Mal auftauchte, war es immer ein Schock. Im Juli sah ihm schon niemand mehr hinterher und im Oktober war das fallende Laub interessanter als er. Dann kamen der nächste Frühling und somit auch Vernon Thaxter samt seiner Genitalien zur allgemeinen Ansicht.
Vielleicht fragt ihr euch, warum Sheriff Amory nicht aufstand und Vernon wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses im Gefängnis einlochte? Moorwood Thaxter, Vernons Vater, war der Grund, warum er das nicht tat. Moorwood Thaxter gehörte die Bank.
Außerdem gehörten ihm Green Meadows Dairy und das Immobiliengeschäft von Zephyr. So gut wie jedes Haus in Zephyr war bei Moorwood Thaxters Bank durch eine Hypothek finanziert. Ihm gehörten das Grundstück, auf dem das Lyric-Kino stand, sowie das Land, auf dem das Gerichtsgebäude gebaut war. Alles auf der Merchants Street war in seinem Besitz. Ihm gehörten die heruntergekommenen Hütten von Bruton und seine eigene Villa mitsamt ihrer achtundzwanzig Zimmer oben auf der Temple Street. Die Angst vor Moorwood Thaxter, der über siebzig war und selten gesichtet wurde, veranlasste Sheriff Amory auf seinem Platz sitzenzubleiben, und ließ den vierzig Jahre alten Vernon nackt durch die Straßen meiner Heimatstadt streifen. Soweit ich mich zurückerinnern konnte, war es schon immer so gewesen.
Mom sagte, dass Vernon ursprünglich ganz normal gewesen war. Aber dann hatte er ein Buch geschrieben, war nach New York gegangen und ein Jahr später nackt und närrisch heimgekehrt.
»Gentlemen und Ladies«, begann Vernon. »Und natürlich auch ihr Kinder.« Er streckte seine dürren Arme aus und klammerte sich an die Kanten des Podiums. »Wir sehen uns hier mit einer sehr ernsten Situation konfrontiert.«
»Momma!«, kreischte die Dämonin plötzlich. »Ich kann den Dödel von dem Typen …«
Eine Hand mit behaarten Fingern wurde ihr über den Mund gelegt. Ich nehme an, dass ihr Haus ebenfalls Thaxter Senior gehörte.
»Einer sehr ernsten Situation«, wiederholte Vernon, der nichts außer seiner eigenen Stimme registrierte. »Daddy hat mich mit einer Nachricht hergeschickt. Er sagt, er erwartet, dass alle Menschen dieser Stadt in dieser schwierigen Zeit wahre Brüderlichkeit und christliche Werte beweisen. Mr. Vandercamp Senior, Sir?«
»Ja, Vernon?«, antwortete der alte Mann.
»Würden Sie so nett sein, die Namen aller fähigen und rechtschaffenen Männer aufzuschreiben, die sich bei Ihnen Werkzeug ausleihen, um den Einwohnern von Bruton zu helfen? Mein Daddy würde das sehr schätzen.«
»Mit Vergnügen«, sagte Mr. Vandercamp Senior. Er war reich, aber nicht reich genug, um Moorwood Thaxter die Stirn zu bieten.
»Danke. Dann hätte mein Daddy eine Liste parat, wenn die Zinsen steigen, womit man in diesen unsicheren Zeiten rechnen muss. Mein Daddy hat schon immer gefunden, dass Männer – und Frauen –, die sich nicht davor scheuen, etwas für ihre Nachbarn zu tun, besondere Rücksichtnahme verdienen.« Lächelnd blickte er auf sein Publikum. »Hat sonst noch jemand etwas zu sagen?«
Niemand meldete sich zu Wort. Es ist irgendwie schwierig mit einem nackten Mann über etwas anderes als die Frage zu reden, warum er keine Kleidung tragen wollte, und niemand hätte im Traum daran gedacht, ein derart delikates Thema anzusprechen.
»Dann ist uns unsere Aufgabe klar«, sagte Vernon. »Ich wünsche uns allen viel Glück.« Er bedankte sich bei Bürgermeister Swope, dass er ihn hatte sprechen lassen, verließ das Podium und ging auf demselben Weg, den er gekommen war, aus dem Konferenzsaal. Das Rote Meer teilte sich erneut vor ihm und schloss sich hinter seinem Rücken.
Eine Minute lang oder so saßen alle schweigend da. Vielleicht warteten wir, dass Vernon Thaxter außer Hörweite war. Dann fing jemand an zu lachen und ein anderer stimmte in das Gelächter ein. Die Dämonin schüttelte sich vor Kichern und hüpfte auf und ab, aber andere Menschen riefen, es sollte mit dem Lachen aufgehört werden. Der Saal war wie ein fröhlich-flüchtiger Blick in die Hölle.
»Beruhigt euch! Alle Mann, beruhigt euch doch!«, schrie Bürgermeister Swope. Chief Marchette stand auf und brüllte wie ein Nebelhorn um Ruhe.
»Das ist Erpressung, verdammt noch mal!« Mr. Moultry war wieder auf den Beinen. »Nichts als verdammte Erpressung!« Ein paar andere stimmten ihm zu, aber Dad gehörte zu den Männern, die aufstanden und Mr. Moultry sagten, er solle den Mund halten und dem Fire Chief zuhören.
Und so wurde die Situation gelöst: Chief Marchette sagte, dass alle, die mit anpacken wollten, nach Bruton fahren sollten, wo der Fluss auf seinem Weg zur Gargoylebrücke über die Ufer trat, und dass er die Schaufeln, Spitzhacken und anderen Sachen aus Mr. Vandercamps Baumarkt mit ein paar Freiwilligen auf einen Pick-up laden würde. Nie war Moorwood Thaxters Macht offensichtlicher als in dem Moment, nachdem Chief Marchette seine letzte Anweisung gegeben hatte: Alle machten sich auf den Weg nach Bruton, sogar Mr. Moultry.
Brutons enge Straßen waren bereits überflutet. Hühner flatterten durchs Wasser und Hunde schwammen. Der Regen fiel wieder stärker, trommelte wie raue Musik auf die Blechdächer. Die schwarzen Bewohner der Bretterhäuser waren dabei, ihre Habseligkeiten herauszuholen, und versuchten sie an höhergelegene Stellen zu schaffen. Die Autos und Pick-ups aus Zephyr schlugen Wellen, die über die überfluteten Vordergärten schwappten und sich an den Hausfundamenten zu Schaum zerschlugen.
»Das wird übel werden«, sagte Dad.
Die meisten Einwohner von Bruton arbeiteten bereits in knietiefem Wasser am Flussufer. Eine Mauer aus nassem Sand wuchs in die Höhe, aber der Fluss war hungrig. Wir stellten unseren Pick-up in der Nähe eines Basketballplatzes am Bruton Sportcenter ab, wo bereits viele andere Autos geparkt waren, und wateten auf den Fluss zu. Nebelschwaden wirbelten über dem steigenden Hochwasser und die Lichtschwerter von Taschenlampen kreuzten sich in der Nacht. Blitze zuckten auf und Donner krachte. Ich hörte drängende Rufe von Menschen, dass schneller und härter gearbeitet werden musste. Meine Mutter griff nach meiner Hand und hielt mich fest, während Dad vorging, um einer Gruppe von Männern aus Bruton zu helfen. Jemand hatte einen Kipplaster mit Sand ans Flussufer gefahren. Ein Mann aus Bruton zog Dad auf die Ladefläche, und sie begannen, kleine Jutesäcke zu füllen und sie den regendurchweichten Männern zuzuwerfen. »Hier! Wir brauchen Hilfe! Hier!«, schrie jemand anderswo. »Das hält nicht!«, rief eine andere Person. Stimmen kreuzten und vermischten sich wie die Strahlen der Taschenlampen. In den Stimmen lag Angst. Ich hatte auch Angst.
Irgendetwas an außer Kontrolle geratener Natur rührt eine Urangst in uns Menschen an. Wir sind daran gewöhnt zu glauben, dass wir unsere Umwelt beherrschen und dass Gott uns die Erde geschenkt hat, damit wir darüber schalten und walten können. Wir brauchen diese Illusion so dringend wie eine Nachttischlampe. Die Wahrheit ist beängstigend: Wir sind so zerbrechlich wie junge Bäume in der Gewalt eines Tornados, und unsere geliebten Häuser trennt nur ein Hochwasser davon, Strandgut zu werden. Wir versenken unsere Wurzeln in zitternder Erde. Wir leben, wo Berge emporgehoben wurden und zerfielen, wo prähistorische Meere zu Nebel verbrannten. Wir und die Städte, die wir gebaut haben, sind nicht von Beständigkeit; selbst die Erde ist ein vorbeifahrender Zug. Wenn du in schlammigem Wasser stehst, das auf deine Taille zusteigt, und Leute gegen die Dunkelheit anschreien hörst und siehst, wie sie darum kämpfen eine Strömung einzudämmen, die sich nicht zurückweisen lässt, erkennst du die Wahrheit: Gewinnen werden wir nicht, aber aufgeben können wir auch nicht. Im prasselnden Regen an dem versinkenden Flussufer glaubte niemand, dass der Tecumseh sich umlenken ließe. Das hatte er noch nie. Und trotzdem ging die Arbeit weiter. Der Pick-up kam mit den Werkzeugen vom Baumarkt und Mr. Vandercamp Junior hielt ein Klemmbrett in der Hand, auf dessen Papier jeder unterschrieb, der sich eine Schaufel geben ließ. Aus Erde und Sandsäcken wurden Wälle errichtet und der Fluss strömte durch die Barrikaden wie braune Suppe durch einen Mund voller schlechter Zähne. Das Wasser stieg weiter. Meine Gürtelschnalle ging unter.
Blitze zickzackten vom Himmel, gefolgt von einem so lauten Donnerschlag, dass man die Frauen nicht schreien hören konnte. »Das ist irgendwo in der Nähe eingeschlagen!«, sagte Reverend Lovoy, der eine Schaufel hielt und aussah wie aus Schlamm gemacht. »Das Licht geht aus!«, rief eine schwarze Frau Sekunden später. Und tatsächlich, in ganz Bruton und Zephyr brach das Stromnetz zusammen. Ich sah, wie die Lampen flackerten und hinter den Fenstern erloschen. Dann lag meine Heimatstadt in Dunkelheit getaucht und man konnte den Himmel nicht mehr vom Wasser unterscheiden. In der Ferne sah ich im Fenster eines Hauses, das so weit von Bruton entfernt war, wie man nur sein konnte, ohne Zephyrs Stadtgrenzen zu verlassen, etwas wie eine Kerze glimmen. Noch während ich hinsah, bewegte sich das Licht von Fenster zu Fenster. Mir wurde bewusst, dass ich zu Mr. Moorwood Thaxters Villa auf dem höchsten Punkt der Temple Street hinstarrte.
Ich spürte es, bevor ich es erkennen konnte.
Links von mir stand eine Gestalt. Sie beobachtete mich. Wer es auch sein mochte, er hatte einen langen Regenmantel an und die Hände in den Taschen versenkt. Der Wind peitschte aus dem Gewitter heran und bewegte die nassen Falten des Mantels und ich erstickte fast an meinem in der Kehle schlagenden Herz. Denn ich erinnerte mich an die Gestalt am Waldrand von Saxon’s Lake.
Wer es auch war, er ging jetzt langsam an meiner Mutter und mir vorbei auf die arbeitenden Männer zu. Es war eine hochgewachsene Gestalt – ein Mann, nahm ich an –, und er bewegte sich mit zielstrebiger Stärke. Sekundenlang sah es aus, als würden die Lichtbündel von zwei Taschenlampen in der Luft miteinander fechten. Der Mann im Regenmantel trat in die Mitte ihres Lichtgefechts. Die miteinander kämpfenden Lichtstrahlen erhellten das Gesicht des Mannes nicht, machten aber etwas anderes sichtbar.
Der Mann trug einen durchweichten, tropfenden Filzhut. Am Hutband war ein rundes Silberstück in der Größe einer 50-Cent-Münze befestigt, aus dem eine kleine dekorative Feder hervorstach.
Eine Feder, die von Nässe ganz dunkel war, aber eindeutig grünlich schimmerte.
Wie die grüne Feder, die ich an jenem Morgen unter der Sohle meines Turnschuhs gefunden hatte.
Meine Gedanken jagten sich. Konnten es ursprünglich zwei grüne Federn in dem Hutband gewesen sein, bevor der Wind eine davon ausgerupft hatte?
Eins der Lichtbündel wich geschlagen zurück. Das andere tanzte davon. Der Mann ging im Dunkeln weiter.
»Mom«, sagte ich. »Mom?«
Die Gestalt watete von uns fort, war keine zweieinhalb Meter entfernt an mir vorbeigegangen. Der Mann streckte eine weiße Hand aus, um seinen Hut auf dem Kopf festzuhalten.
»Mom«, sagte ich wieder, und sie hörte mich endlich über den Lärm hinweg und fragte: »Was denn?«
»Ich glaube … ich glaube …« Aber ich wusste nicht, was ich glaubte. Ich konnte nicht beurteilen, ob dies die Person war, die ich auf der anderen Straßenseite gesehen hatte oder nicht.
Schritt um Schritt entfernte sich die Gestalt durch die braunen Fluten.
Ich entzog meiner Mutter meine Hand und folgte dem Schatten im Mantel.
»Cory!«, rief sie. »Cory, gib mir deine Hand!«
Ich hörte sie, gehorchte aber nicht. Das Wasser strudelte um mich herum. Ich stapfte weiter.
»Cory!«, schrie Mom.
Ich musste sein Gesicht sehen.
»Mister!«, rief ich. Es war zu laut – der Regen und der Fluss und die ackernden Menschen; er konnte mich nicht hören. Und wenn doch, dann drehte er sich jedenfalls nicht um. Ich spürte, wie die Strömung des Tecumseh River an meinen Schuhen sog. Ich war bis zur Taille im kalten, trüben Wasser versunken. Der Mann ging aufs Ufer zu, dorthin, wo mein Dad war. Taschenlampenlicht zuckte auf und schwankte und ein schimmernder Widerschein tanzte in die Höhe und fiel auf die rechte Hand des Mannes, die er gerade aus der Tasche zog.
Etwas Metallisches glänzte im Licht auf.
Etwas mit einer scharfen Kante.
Mein Herz stotterte.
Der Mann mit dem grüngefiederten Hut war auf dem Weg zum Ufer und hatte ein Stelldichein mit meinem Vater. Ein Stelldichein, das er vielleicht geplant hatte, seit Dad dem versinkenden Auto hinterhergetaucht war. Würde der Mann mit dem grüngefiederten Hut in all diesem Chaos, Lärm, in dieser wässerigen Dunkelheit eine Gelegenheit finden, meinem Vater das Messer in den Rücken zu stoßen? Ich konnte meinen Dad nicht sehen. Mit absoluter Sicherheit konnte ich niemanden erkennen: Ich sah nur nassglänzende Gestalten, die gegen das Unvermeidliche kämpften.
Er kam gegen die Strömung schneller voran als ich. Sein Abstand zu mir vergrößerte sich. Ich warf mich nach vorn, kämpfte gegen den Fluss an. Plötzlich rutschten mir die Füße weg und das schlammige Wasser schlug über meinem Kopf zusammen. Ich streckte die Hand hoch, um nach irgendeinem Halt zu greifen. Aber es gab nichts Festes. Ich schaffte es nicht, meine Füße auf Grund zu stemmen. Meine innere Stimme schrie, ich würde nie wieder Atem schöpfen. Ich schlug um mich, taumelte, und dann packte mich jemand und zerrte mich hoch. Dreckiges Wasser strömte mir vom Gesicht und aus den Haaren.
»Ich hab dich«, sagte ein Mann. »Alles okay.«
»Cory! Was ist denn bloß los mit dir, Junge?« Die Stimme meiner Mutter, die sich auf neue Gipfel der Angst emporschraubte. »Bist du verrückt?«
»Ich glaube, er ist in ein Loch getreten, Rebecca.« Der Mann ließ mich wieder runter. Ich stand immer noch bis zur Taille im Wasser, aber wenigstens hatte ich Boden unter den Füßen. Ich wischte mir Schlamm aus den Augen und sah zu Dr. Curtis Parrish hoch, der einen grauen Regenmantel und Regenhut aufhatte. Kein Hutband war daran befestigt, und somit auch kein Silberstück und keine grüne Feder. Ich drehte mich um und suchte nach der Gestalt, die ich einzuholen versucht hatte, aber der Mann war mit den anderen Menschen in der Nähe des Flussufers verschmolzen. Er und das Messer, das er aus der Tasche gezogen hatte.
»Wo ist Dad?«, fragte ich noch panischer als meine Mutter. »Ich muss Dad finden!«
»Na, na, beruhig dich mal.« Dr. Parrish packte mich an den Schultern. In einer Hand hielt er eine Taschenlampe. »Tom ist da drüben.« Er richtete den Lampenstrahl auf eine Gruppe schlammverschmierter Männer. Die Richtung, in die er leuchtete, war nicht die, die der Mann mit dem grüngefiederten Hut eingeschlagen hatte. Aber ich konnte meinen Vater dort sehen. Er arbeitete zwischen einem schwarzen Mann und Mr. Yarbrough. »Siehst du ihn?«
»Ja, Sir.« Wieder hielt ich Ausschau nach der mysteriösen Gestalt. Sie war verschwunden.
»Cory, lauf nie wieder so von mir weg!«, schalt meine Mutter mich. »Du hast mich fast zu Tode erschreckt!« Sie nahm wieder meine Hand. Ihr Griff war wie aus Eisen.
Dr. Parrish war ein korpulenter Mann, achtundvierzig oder neunundvierzig Jahre alt, mit einem festen eckigen Kinn und einer platten Nase, die alle daran erinnerte, dass er als Sergeant in der Armee Boxchampion gewesen war. Die Hände, mit denen er mich aus dem Loch unter meinen Füßen gezogen hatte, waren dieselben, die mich auf die Welt gebracht hatten. Seine buschigen dunklen Augenbrauen wölbten sich über stahlgrauen Augen und die dunkelbraunen Haare unter dem Regenhut waren an den Schläfen grau. »Ich habe eben von Chief Marchette gehört, dass sie die Turnhalle von der Schule geöffnet haben«, sagte Dr. Parrish zu Mom. »Sie stellen Öllampen auf und bringen Pritschen und Decken hin. Die meisten Frauen und Kinder sind auf dem Weg dahin, jetzt, wo das Wasser so stark steigt.«
»Dann sollten wir auch dort hingehen?«
»Das wäre das Vernünftigste, denke ich. Es hilft ja nicht, wenn Sie mit Cory hier draußen in diesem Schlamassel stehen.« Er zeigte wieder mit der Taschenlampe in die Dunkelheit, diesmal vom Fluss weg auf den durchtränkten Basketballplatz, bei dem wir geparkt hatten. »Da drüben holen sie alle ab, die in die Turnhalle wollen. Das nächste Auto kommt wahrscheinlich in ein paar Minuten.«
»Aber Dad weiß dann nicht, wo wir sind!«, protestierte ich. Die grüne Feder und das Messer gingen mir noch immer nicht aus dem Sinn.
»Ich werd’s ihm sagen. Tom wird wollen, dass Sie beide in Sicherheit sind, Rebecca. Um ehrlich zu sein, werden wir noch vorm Morgengrauen in den Dachstuben Welse angeln können, so, wie das aussieht.«
Wir waren nicht schwer zu überzeugen. »Brightie ist schon da drüben«, sagte Dr. Parrish. »Sie sollten im nächsten Auto mitfahren. Hier, nehmen Sie.« Er gab Mom die Taschenlampe und wir drehten dem angeschwollenen Tecumseh den Rücken zu und gingen auf den Basketballplatz zu.
»Lass bloß nicht meine Hand los!«, warnte Mom mich, als das Hochwasser uns umspülte. Ich warf einen Blick zurück und konnte nur sehen, wie sich die Lampenstrahlen im Dunkeln bewegten und auf dem dahinströmenden Wasser glitzerten. »Pass auf, wo du hintrittst!«, sagte Mom.
Weiter hinten am Ufer, an der Stelle vorbei, an der mein Vater arbeitete, fingen die Leute plötzlich an zu schreien. In dem Moment wusste ich nicht, weshalb, aber eine schaumgekrönte Welle hatte den höchsten Punkt des Erdwalls überspült. Das Wasser strudelte und schäumte, und als der Fluss durch die Barrikaden brach, erkannten die Männer, dass sie bis zu den Ellbogen in Schwierigkeiten steckten. Der Lichtschein einer Taschenlampe fiel auf braungefleckte Schuppenhaut im schmutzigen Schaum. »Schlangen!«, brüllte jemand. In der nächsten Sekunde wurden die Männer von der reißenden Strömung von den Füßen gehoben. Mr. Stellko, der Leiter des Lyric, alterte um zehn Jahre, als er haltsuchend die Hand ausstreckte und im wirbelnden Wasser ein baumgroßes, schuppenhautiges Wesen an sich vorbeitreiben spürte. Mr. Stellko verlor die Stimme und machte sich gleichzeitig in die Hose, und als er wieder schreien konnte, war das monströse Reptil fort, dem Hochwasser in die Straßen von Bruton folgend.
»Hilfe! So hilf mir doch jemand!«
Wir hörten in der Nähe die Stimme einer Frau, und Mom sagte: »Warte.«
Jemand kam mit einer Öllampe platschend auf uns zu. Regen zischte auf dem heißen Glaszylinder der Lampe und verdampfte. »Bitte helfen Sie mir doch!«, rief die Frau.
»Was ist denn?« Mom lenkte den Strahl ihrer Taschenlampe auf das angstverzerrte Gesicht einer jungen schwarzen Frau. Ich kannte sie nicht, aber Mom sagte: »Nila Castile? Sind Sie das?«
»Ja, Ma’am, ich bin’s, Nila! Wer sind Sie?«
»Rebecca Mackenson. Ich hab Ihrer Mutter früher Bücher vorgelesen.«
Das musste gewesen sein, bevor ich geboren war, nahm ich an.
»Mein Daddy, Miz Rebecca!«, sagte Nila Castile. »Ich glaub, sein Herz will nicht mehr!«
»Wo ist er?«
»Im Haus! Da drüben!« Sie zeigte in die Dunkelheit. Das Wasser strömte ihr um die Taille. Mir reichte es jetzt bis an die Brust. »Er kann nicht aufstehen!«
»Ist gut, Nila. Beruhigen Sie sich.« Meine Mutter, die eine einzige Sammlung von Ängsten mit einer Abdeckung aus Haut war, wurde überraschend ruhig, wenn jemand anderes um Fassung rang. So wie ich das verstand, gehörte das zum Erwachsensein. Wenn es dringend gebraucht wurde, konnte meine Mutter etwas an den Tag legen, das meinem Granddaddy Jaybird aufs Bitterste fehlte: Mut. »Führen Sie uns hin«, sagte sie. Das Hochwasser drang in die Häuser von Bruton ein. Nila Castiles Haus war, wie so viele andere, eine schmale graue Hütte. Sie führte uns durch das uns umspülende Wasser darauf zu und rief im Haus: »Gavin! Ich bin wieder da!«
Ihr Lampenlicht und das von Mom fiel auf einen alten schwarzen Mann, der bis zu den Knien im Wasser auf einem Stuhl saß. Zeitungen und Magazine trieben in der Strömung. Seine Hand war über seinem Herzen in sein nasses Hemd gekrallt. Sein dunkles Gesicht war von Schmerzen verzerrt. Er hatte die Augen zugekniffen. Neben ihm stand ein kleiner Junge, vielleicht sieben oder acht Jahre alt, und hielt seine andere Hand.
»Grandpa weint, Momma«, sagte der kleine Junge.
»Ich weiß, Gavin. Daddy, ich habe Hilfe geholt.« Nila Castile stellte ihre Lampe auf einen Tisch. »Kannst du mich hören, Daddy?«
»Ohhhhh«, stöhnte der alte Mann. »Tut diesmal furchtbar weh.«
»Wir helfen dir aufzustehen. Wir müssen dich hier rausholen.«
»Nein, Schatz.« Er schüttelte den Kopf. »Alte Beine … weg.«
»Was sollen wir nur machen?« Nila sah meine Mutter an, und ich sah helle Tränen in ihren Augen glitzern.
Der Fluss zwängte sich ins Haus. Draußen sprach der Donner und Blitze zuckten. Wäre es eine Fernsehsendung gewesen, käme nun die Werbung.
Aber das wahre Leben macht keine Pause. »Eine Schubkarre«, sagte meine Mutter. »Haben Sie eine?«
Nila verneinte, aber dass sie sich eine von einem Nachbarn geliehen hatten, die vielleicht noch hinten auf der Veranda stand. »Du bleibst hier«, sagte Mom zu mir und gab mir die Öllampe. Jetzt musste ich mutig sein, ob ich wollte oder nicht. Mom und Nila verließen mit der Taschenlampe das Zimmer und ich stand mit dem kleinen Jungen und dem alten Mann im überflutenden Wohnzimmer.
»Ich bin Gavin Castile«, sagte der kleine Junge.
»Ich bin Cory Mackenson«, antwortete ich.
Es ist schwer, höflichen Smalltalk zu halten, wenn man bis zur Hüfte in braunem Wasser steht und das flackernde Licht nicht bis zu den Wänden reicht.
»Das hier ist mein Grandpa, Mr. Booker Thornberry«, fuhr Gavin fort, der den alten Mann immer noch bei der Hand hielt. »Er ist krank.«
»Wieso seid ihr hier nicht raus, als alle anderen aus ihren Häusern weg sind?«
»Weil das hier mein Haus ist, Junge«, sagte Mr. Thornberry, der sich zu berappeln schien. »Mein Zuhause. Ich hab keine Angst vorm verdammten Fluss.«
»Alle andern schon«, sagte ich. Alle, die bei Verstand sind, meinte ich.
»Dann soll’n die andern halt alle weglaufen.« Mr. Thornberry verzog das Gesicht, als ihn ein neuer Schmerz durchfuhr. Ich begann zu ahnen, dass er so starrköpfig wie Granddaddy Jaybird war. Er blinzelte langsam. Seine dunklen Augen starrten mich aus seinem knochigen Gesicht an. »Meine Rubynelle ist hier in diesem Haus gestorben. Hier. Ich werd‘ nich‘ in ‘nem Krankenhaus voll mit weißen Leuten sterben.«
»Wollen Sie denn sterben?«, fragte ich ihn.
Er schien darüber nachzudenken. »Ich werd‘ in meinem eigenen Haus sterben«, antwortete er.
»Das Wasser steigt immer höher«, sagte ich. »Vielleicht werden alle ertrinken.«
Der alte Mann blickte finster drein. Dann drehte er den Kopf und sah auf die kleine schwarze Hand hinunter, an der er sich festhielt.
»Mein Grandpap ist mit mir ins Kino gegangen!«, sagte Gavin, während das Wasser auf seinen Hals zustieg. »Wir haben einen Zeichentrickfilm gesehen!«
»Bugs Bunny«, sagte der alte Mann. »Wir haben uns Bugs Bunny und den Stotterer angeguckt, der wie ’n Schwein aussieht. Stimmt’s, mein Junge?«
»Ja, Sir!«, sagte Gavin und grinste. »Bald gehen wir wieder einen gucken, oder, Grandpap?«
Mr. Thornberry antwortete nicht. Gavin ließ seine Hand nicht los.
Ich begriff, was Mut war; jemanden mehr zu lieben, als man sich selbst liebt.
Meine Mutter und Nila Castile kamen mit einer Schubkarre zurück. »Wir setzen dich hier rein, Daddy«, sagte Nila zu ihm. »Wir können dich da hinschieben, wo Miz Rebecca sagt, dass sie Leute mit Autos abholen.«
Mr. Thornberry atmete lange und tief ein, hielt ein paar Sekunden die Luft an und stieß sie dann wieder aus. »Verdammt«, flüsterte er. »Verdammtes altes Herz in einem verdammten alten Idioten.« Bei dem letzten Wort brach seine Stimme ein wenig.
»Lassen Sie uns Ihnen auf die Beine helfen«, sagte Mom.
Er nickte. »Na gut«, meinte er. »Ist wohl Zeit zu gehen, was?«
Sie bugsierten ihn in die Schubkarre, aber Mom und Nila merkten sehr schnell, dass sie es trotz Mr. Thornberrys Magerkeit schwer haben würden ihn zu schieben und seinen Kopf über Wasser zu halten. Ich erkannte die missliche Lage: Auf der überfluteten Straße würde Gavin untergehen. Die Strömung konnte ihn wie einen Maiskolben davonreißen. Wer würde ihn über Wasser halten?
»Wir werden noch mal zurückkommen müssen, um die Jungs zu holen«, beschloss Mom. »Cory, du nimmst die Lampe. Du stellst dich mit Gavin auf den Tisch hier.« Die Tischplatte war von Wasser überspült, aber wir würden außer Reichweite der Flut sein. Ich tat wie befohlen, und Gavin kletterte ebenfalls auf den Tisch. Wir standen mit der kleinen Kiefernholzinsel unter unseren Füßen da, ich mit der Lampe in der Hand.
»Also gut«, sagte Mom. »Cory, du bewegst dich nicht vom Fleck. Wenn du dich bewegst, versohle ich dich dermaßen, dass du dich für den Rest deines Lebens daran erinnern wirst. Hast du das verstanden?«
»Ja, Ma’am.«
»Gavin, wir sind sofort wieder da«, sagte Nila Castile. »Wir müssen Grandpap rausbringen, damit ihm jemand helfen kann. Hörst du?«
»Ja, Ma’am«, gab Gavin zurück.
»Ihr Jungs hört auf eure Mütter«, meldete sich Mr. Thornberry zu Wort. Seine Stimme war rau von Schmerzen. »Ich geb euch beiden den Gürtel zu schmecken, wenn ihr nicht hört.«
»Ja, Sir«, sagten wir im Chor. Ich nahm an, dass Mr. Thornberry sich gegen das Sterben entschieden hatte.
Mom und Nila Castile begannen das Unterfangen, Mr. Thornberry in der Schubkarre durch das braune Wasser zu schieben. Jede von ihnen hatte einen Schubkarrengriff gepackt und Mom hielt die Taschenlampe in der anderen Hand. Sie hielten die Schubkarre in so steilem Winkel wie möglich, und Mr. Thornberry reckte den dürren Hals, an dem die Venen hervorstanden. Ich hörte meine Mutter vor Anstrengung ächzen. Aber die Schubkarre bewegte sich und sie schoben sie durch das im Türrahmen wirbelnde Wasser auf die überflutete Veranda hinaus. Am Fuße der aus zwei Betonblöcken bestehenden Treppe reichte das Wasser Mr. Thornberry bis an den Hals und spritzte ihm ins Gesicht. Sie gingen weiter. Die Strömung erfasste sie von hinten und half ihnen, die Schubkarre zu schieben. Ich hatte meine Mutter noch nie für eine körperlich starke Frau gehalten, doch ich nehme an, man weiß nie, was ein Mensch leisten kann, bis eine Situation kommt, in der er es leisten muss.
»Cory?«, fragte Gavin nach einer Minute oder so.
»Ja, Gavin.«
»Ich kann nicht schwimmen«, sagte er.
Er rückte näher an mich heran. Er hatte zu zittern begonnen, jetzt, wo er nicht mehr für seinen Grandpap mutig sein musste.
»Das ist okay«, sagte ich. »Du wirst ja auch nicht schwimmen müssen.« Hoffte ich.
Wir warteten. Mit Sicherheit würden sie bald wiederkommen. Das Wasser leckte an unseren durchnässten Schuhen. Ich fragte Gavin, ob er irgendwelche Lieder singen konnte, und er sagte, dass er On Top of Old Smoky kannte. Er begann es in einer hohen und zittrigen, aber nicht unangenehmen Stimme zu singen.
Sein Singen – eigentlich eher ein Jodeln – erregte die Aufmerksamkeit von etwas, das plötzlich durch die offene Tür hereingepaddelt kam. Bei dem Geräusch stockte mir der Atem. Ich hielt die Lampe so, dass das Licht in die Richtung des Geräuschs fiel.
Es war ein brauner Hund mit schlammverklebtem Fell. Seine Augen glänzten wild im Licht. Sein Atem ging keuchend, als er durch das Zimmer und Treibgut von Papier und anderen Sachen auf uns zuschwamm. »Na komm schon, Dicker!«, sagte ich. Ob er dick oder dünn war, spielte keine Rolle; der Hund sah aus, als bräuchte er Grund unter den Pfoten. »Na komm!« Ich gab Gavin die Lampe und der Hund wimmerte und jaulte, als eine langsame Welle durch den Türrahmen glitt und ihn auf und nieder schaukelte. Wasser klatschte gegen die Wände.
»Na komm, Dicker!« Ich bückte mich, um den strampelnden Hund hochzuziehen. Ich packte seine Vorderpfoten. Er sah mir ins Gesicht wie ein wiedergeborener Christ, der an Jesus appelliert. Seine rosafarbene Zunge hing ihm im trüben gelben Licht aus dem Maul.
Ich zog den Hund an seinen Pfoten heran und fühlte, wie er zitterte.
Irgendetwas machte Krrrps.
So schnell.
Und dann kamen der Kopf und die Schultern aus dem dunklen Wasser und plötzlich war nach der Mitte des Rückens kein Hund mehr da, keine Hinterbeine, kein Schwanz, keine Hinterpfoten, nichts außer einem klaffenden Loch, aus dem ein Strom von schwarzem Blut und dampfenden Eingeweiden fiel.
Der Hund gab ein leises Wimmern von sich. Mehr nicht. Aber die Pfoten zuckten und sein Blick war auf mich gerichtet, und die Qual, die ich in seinen Augen sah, werde ich nie vergessen können.
Ich schrie auf – was ich schrie, werde ich nie wissen – und ließ das Ding fallen, das einst ein Hund gewesen war. Es klatschte ins Wasser, ging unter, trieb wieder hoch, und die Pfoten versuchten immer noch zu paddeln. Ich hörte Gavin kreischen; etwas, das wie WillstewasserMars? klang. Und dann spritzte das Wasser um den halbierten Kadaver auf, der seine Eingeweide wie einen grausigen Schweif hinter sich herzog, und ich sah die Haut irgendeiner Kreatur aus der Wasseroberfläche brechen.
Die Haut war mit rautenförmigen Schuppen in Herbstfarben bedeckt: hellbraun, glänzendes Lila, tiefes Gold und gelbbraunes Rostrot. Auch alle Farbschattierungen des Flusses waren zu sehen, von Spiralen in Schlamm-Ocker bis hin zu Mondscheinrosa. Ich sah einen Wald von Muscheln an der Haut kleben, graue Narbentäler und Angelhaken, die rot von Rost waren. Ich sah einen Körper, stämmig wie eine uralte Eiche, der sich langsam im Wasser drehte, als hätte er alle Zeit der Welt. Der Anblick hypnotisierte mich trotz Gavins Angstschreien. Ich wusste, was ich hier vor mir hatte, und obwohl mein Herz hämmerte und ich kaum atmen konnte, dachte ich, dass diese Kreatur so schön wie jeder Teil von Gottes Schöpfung war.
Und dann erinnerte ich mich an den gezackten Reißzahn bei Mr. Sculley, der wie ein Messer in dem Stück Holz steckte. Schön oder nicht – Old Moses hatte soeben einen Hund durchgebissen.
Er hatte immer noch Hunger. Es geschah so schnell, dass mein Verstand kaum Zeit hatte, es wahrzunehmen: Der Kiefer öffnete sich und Zähne glänzten. Auf einem Zahn steckte außer einem zappelnden silbernen Fisch ein alter Stiefel fest. Das Maul saugte die verbleibende Hälfte des Hundekadavers mit einem wilden Aufwirbeln von Wasser ein und schloss sich dann so zart und gefühlvoll, wie unsereins einen sauren Lutschbonbon im Lyric genoss. Ich erhaschte einen kurzen Blick auf ein schmales hellgrünes Katzenauge in Baseballgröße, das von einer gelatineartigen Haut geschützt war.
Und dann fiel Gavin vom Tisch ins Wasser, und die Lampe, die er in der Hand gehalten hatte, erlosch mit einem Zischen.
Ich dachte nicht daran, dass ich mutig sein musste. Ich dachte nicht daran, dass ich Angst hatte.
Ich kann nicht schwimmen.
Das war es, woran ich dachte.
Ich sprang an der Stelle vom Tisch, an der Gavin hinuntergefallen war. Das Wasser war so voller Schlamm, dass es sich schwer anfühlte. Es reichte mir bis an die Schulter, was bedeutete, dass Gavin bis zu den Nasenlöchern drinstecken musste. Er schlug und trat um sich, und als ich ihn an der Taille packte, musste er gedacht haben, dass ich Old Moses war, denn er riss mir fast den Arm aus.
»Gavin! Hör auf zu treten!«, schrie ich und zerrte sein Gesicht aus dem Wasser.
»Homma hobba homma«, brabbelte er wie ein regennasser Motor, der zu zünden versuchte.
In dem finsteren überfluteten Zimmer höre ich hinter mir ein Geräusch.
Das Geräusch von etwas, das aus dem Wasser steigt.
Ich drehte mich um. Gavin schrie auf und klammerte sich mit beiden Armen um meinen Hals, wobei er mich fast erwürgte.
Ich sah Old Moses – riesengroß, schrecklich und atemberaubend – wie einen lebendig gewordenen, vollgesogenen Baumstamm aus dem Wasser kommen. Sein Kopf war flach und dreieckig wie der einer Schlange, aber ich glaube, es war nicht wirklich eine Schlange, weil er unterhalb der Stelle, die der Hals sein sollte, zwei kleine Arme mit dürren Klauen zu haben schien. Ich hörte etwas, das wohl sein Schwanz war, so heftig gegen eine Wand schlagen, dass das ganze Haus erzitterte. Sein Kopf stieß gegen die Zimmerdecke. Gavins Klammergriff staute mir das Blut im Kopf wie in einem Ballon.
Auch ohne es sehen zu können, wusste ich, dass Old Moses uns anstarrte; mit Augen, die um Mitternacht in trübem Wasser einen Wels erspähen konnten. Als würde mir jemand ein kaltes Messer an die Stirn pressen spürte ich, wie er uns taxierte. Ich hoffte, dass wir nicht allzu sehr wie Hunde aussahen.
Old Moses roch wie der Fluss zur Mittagszeit: sumpfig, dampfend und scharf, von Leben erfüllt. Zu sagen, dass ich vor diesem beeindruckenden Geschöpf Respekt hatte, wäre eine monumentale Untertreibung gewesen. Aber in jenem Moment wünschte ich mir nichts sehnlicher, als irgendwo anders auf der Welt zu sein, meinetwegen sogar in der Schule. Viel Zeit zum Denken hatte ich allerdings nicht, denn Old Moses‘ Schlangenkopf kam auf uns zu wie eine Baggerschaufel, und ich hörte ihn zischend das Maul aufreißen. Ich wich nach hinten zurück, schrie Gavin an, er sollte loslassen, aber er klammerte sich weiter an meinen Hals. Ich an seiner Stelle hätte auch nicht losgelassen. Der Kopf kam auf uns zu, aber im nächsten Augenblick taumelte ich nach hinten in einen schmalen Korridor – von dessen Existenz ich nichts gewusst hatte –, und Old Moses‘ Maul knallte zu beiden Seiten von uns gegen den Türrahmen. Das schien ihn wütend zu machen. Er zog sich ein Stück zurück und stieß dann wieder vor, mit demselben Ergebnis, nur dass diesmal der Türrahmen zersplitterte. Gavin weinte, gab ein Huhuhu-Geräusch von sich, und eine von Old Moses‘ Bewegungen ausgelöste schaumige Welle spritzte mir ins Gesicht und über den Kopf. Irgendetwas stach mich in die rechte Schulter. Ein Schauder jagte mir über den Rücken. Ich griff nach dem Ding und stellte fest, dass es ein mit den anderen Gegenständen umhertreibender Besen war.
Old Moses gab ein Geräusch wie eine Lokomotive von sich, die jeden Moment explodiert. Ich sah den furchtbaren Umriss seines Kopfes auf den Eingang des Korridors zukommen und dachte daran, wie Gordon Scott als Tarzan mit einem Speer gegen eine Riesenschlange kämpfte. Ich nahm den Besen in die Hand. Als Old Moses wieder gegen den Türrahmen stieß, rammte ich ihm den Besen in seine offene, hundeverschlingende Kehle.
Ihr wisst ja, was passiert, wenn man sich den Finger in den Hals steckt, oder? Anscheinend haben Monster die gleiche Reaktion. Old Moses gab einen Würgelaut wie ein in einem Fass gefangenes Donnerkrachen von sich. Der Kopf zog sich zurück und nahm den Besen mit sich, die Borsten aus Maisblättern immer noch im Hals. Und dann erbrach sich Old Moses. Anders kann ich es nicht beschreiben. Es war so. Ich hörte Flüssigkeit und widerwärtige Dinge in sein Maul emporschießen. Fische, von denen manche noch zappelten und andere schon lange tot waren, flogen mit stinkenden Flusskrebsen, Schildkrötenpanzern, Muscheln, schleimigen Steinen, Matsch und Knochen um uns herum. Der Gestank war … na ja, ihr könnt es euch vorstellen. Es war hundertmal schlimmer, als wenn dein Sitznachbar in der Schule sein Frühstück auf den Tisch kotzt. Verzweifelt die Flucht suchend, steckte ich meinen Kopf unter Wasser – und Gavins damit auch, ob es ihm nun gefiel oder nicht. Dort unten fuhr mir der Gedanke durch den Kopf, dass Old Moses etwas wählerischer mit dem sein sollte, was er vom Grund des Tecumseh River auflas.
Wasserwirbel strudelten um uns herum. Ich richtete mich wieder auf. Gavin schnappte nach Luft und fing an, aus vollem Hals zu schreien. Das war der Moment, in dem ich auch zu schreien anfing. »Hilfe!«, brüllte ich. »Helft uns!«
Ein Lichtstrahl fiel wie ein Speer durch die offene Haustür über die Wellen und traf mich im Gesicht.
»Cory!«, kam die vernichtende Stimme. »Hab ich dir nicht gesagt, dass du dich nicht bewegen sollst?«
»Gavin? Gavin?«
»Heiliger Himmel!«, sagte meine Mutter. »Was ist das für ein Gestank?«
Das Wasser beruhigte sich. Ich erkannte, dass Old Moses sich nicht mehr zwischen den beiden Müttern und ihren Söhnen befand. Tote Fische trieben in braunem Schleim an die Wasseroberfläche, aber alle Aufmerksamkeit meiner Mutter war auf mich gerichtet. »Dir zieh ich dein Fell ab, Cory Mackenson!«, schrie sie, als sie mit Nila Castile im Gefolge ins Haus watete.
Dann traten sie mitten in das im Wasser treibende Erbrochene des Monsters. Das Geräusch, das meine Mutter von sich gab, überzeugte mich, dass sie an anderes dachte, als mich zu verprügeln.
Was für ein Glückspilz ich doch war.