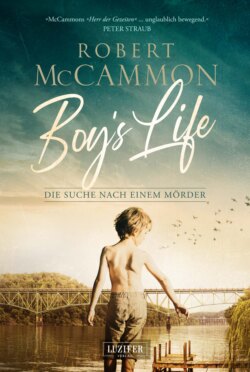Читать книгу BOY'S LIFE - Die Suche nach einem Mörder - Robert Mccammon - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Tod eines Fahrrads
ОглавлениеDer Regen hörte nicht auf.
Graue Wolken hingen über Zephyr und aus ihren geschwollenen Bäuchen strömte die Sintflut. Wenn ich schlafen ging, klatschte der Regen aufs Dach, und wenn ich aufwachte, donnerte es. Rebel zitterte und wimmerte in seiner Hundehütte. Ich wusste, wie er sich fühlte. Aus meinen Wespenstichen waren inzwischen rote Schwellungen geworden, aber Tag um Tag fiel weiterhin kein einziger Sonnenstrahl auf meine Heimatstadt. Nur der unaufhörliche Regen kam vom Himmel, und wenn ich nicht gerade Hausaufgaben machte, saß ich in meinem Zimmer und las zum wiederholten Male alte Ausgaben von Berühmte Monster und meine Comic-Hefte.
Im Haus begann es nach Regen zu riechen, ein Geruch von feuchten Brettern und nassem Dreck, der aus dem Keller nach oben trieb. Der Platzregen verursachte die Streichung der Samstagsfilme im Lyric, denn das Kinodach hatte Löcher bekommen. Selbst die Luft fühlte sich schlüpfrig an wie grüner Schimmel, der auf feuchten Steinen entsteht. Eine Woche nach Ostern legte Dad beim Abendessen sein Messer und seine Gabel hin und starrte aus den nass beschlagenen Fenstern. »Wenn das nicht aufhört, werden wir uns Kiemen wachsen lassen müssen«, sagte er.
Es hörte nicht auf. Wasser hing in der Luft. Die Wolken erstickten sämtliches Licht zu einem schummrigen, sumpfigen Nebel. Aus Gärten wurden Teiche und aus Straßen Bäche. Wir wurden früher aus der Schule entlassen, damit alle heil nach Hause kamen, und am Mittwochnachmittag um siebzehn Minuten vor drei gab mein altes Fahrrad den Geist auf.
Eine Sekunde kämpfte ich mich noch damit ab, den Sturzbach der Deerman Street hochzufahren, in der nächsten sackte mein Vorderrad in einen Krater ein, wo der Asphalt gebrochen war. Der Aufschlag vibrierte durch den gesamten rostzerfressenen Rahmen. Mehrere Dinge passierten gleichzeitig: Der Lenker brach zusammen, die Speichen des Vorderrads knickten ein, der Rahmen gab an seinen alten müden Rissen nach und ich lag plötzlich auf dem Bauch im Wasser, das mir in die gelbe Regenjacke strömte. Wie betäubt lag ich da und versuchte zu begreifen, was mich vom Rad geworfen hatte. Dann setzte ich mich auf, wischte mir das Wasser aus den Augen und betrachtete mein Fahrrad. Und wusste, dass es tot war.
Mein Rad, das schon ein langes Jungenleben hinter sich gehabt hatte, bevor es mir auf einem Flohmarkt in die Hände fiel, hatte kein Leben mehr in sich. Ich spürte es, als ich dort im Regen saß. Was es auch ist, das einem mit Menschenwerkzeug hergestellten Gerät eine Seele einhaucht, war zerbrochen und in den nassen Himmel entflohen. Der Rahmen war verbogen und gebrochen, der Lenker hing nur noch an einer Schraube, der Sitz war verdreht wie ein Kopf auf einem gebrochenen Hals. Die Kette war abgesprungen, die Vorderradfelge verbogen und die gebrochenen Speichen stachen in die Luft. Dieser Anblick der Verwüstung brachte mich fast zum Weinen, aber obwohl mir das Herz wehtat, wusste ich, dass weinen nicht helfen würde. Mein Fahrrad war verschlissen, es war ganz einfach am Ende seiner Tage angekommen. Ich war nicht der erste Besitzer, und vielleicht machte das auch etwas aus. Vielleicht verzehrt ein Fahrrad sich Jahr um Jahr nach den Händen, die es zuerst gelenkt haben, wenn es abgeschafft wird, und träumt auf seine Räderart von jungen Straßen, wenn es alt wird. In dem Fall hat es nie wirklich mir gehört; es ist mit mir gefahren, aber die Pedale und der Lenker erinnerten sich an einen anderen Besitzer. Vielleicht hatte es sich an dem verregneten Mittwoch umgebracht, weil es wusste, dass ich mich nach einem Rad sehnte, das nur für mich und keinen anderen gemacht worden war. Vielleicht. Das Einzige, was ich mit Sicherheit wusste, war, dass ich den Rest der Strecke zu Fuß nach Hause gehen musste und den Radkadaver nicht mitschleifen konnte.
Ich zerrte mein Rad in einen Vorgarten von einem Haus, stellte es dort unter eine triefende Eiche und ging mit meinem durchweichten Rucksack auf dem Rücken und unter Wasser stehenden Schuhen weiter.
Als mein Vater, der von der Molkerei schon zu Hause war, hörte, was mit dem Rad passiert war, nahm er mich im Pick-up mit, um den Kadaver in der Deerman Street abzuholen. »Das lässt sich reparieren«, sagte er. Die Scheibenwischer flitzten über die Windschutzscheibe. »Wir werden jemanden finden, der es wieder zusammenschweißen kann oder so. Das wird auf jeden Fall billiger als ein neues Fahrrad sein.«
»Okay«, sagte ich, aber ich wusste, dass das Rad tot war. Egal, wie viel jemand daran schweißte – es würde sich nicht wiederbeleben lassen. »Das Vorderrad ist auch kaputt«, fügte ich hinzu, aber Dad konzentrierte sich aufs Fahren.
Wir erreichten die Stelle, an der ich den Kadaver unter die Eiche gezerrt hatte. »Wo ist es?«, fragte Dad. »War das hier?«
Das war es, obwohl der Kadaver nicht mehr da war. Dad hielt an, stieg aus und klopfte an die Tür des Hauses, vor dem wir geparkt waren. Ich sah, wie die Tür geöffnet wurde. Eine weißhaarige Frau spähte heraus. Sie redete vielleicht eine Minute lang mit Dad, und ich sah, wie sie die Straße hochzeigte. Dann kam mein Dad mit triefender Baseballkappe zurück, die Schultern in seiner Milchmannjacke hochgezogen. Er rutschte hinters Lenkrad, machte die Tür zu und sagte: »Also, sie war rausgegangen, um ihre Post zu holen, und als sie das Fahrrad unter ihrem Baum liegen sah, hat sie Mr. Sculley angerufen.« Mr. Emmett Sculley war der Schrotthändler von Zephyr, der einen hellgrünen Lastwagen mit der roten Aufschrift SCULLEYS ANTIQUITÄTEN sowie einer Telefonnummer auf den Seiten fuhr. Mein Dad startete den Motor und sah mich an. Ich kannte diesen Blick; er war hart und wütend und ich konnte eine bittere Zukunft darin lesen. »Warum bist du nicht an ihre Tür gegangen und hast gesagt, dass du dein Fahrrad holen kommst? Ist dir das nicht in den Sinn gekommen?«
»Nein, Sir«, musste ich zugeben. »Ist es nicht.«
Mein Dad fuhr vom Kantstein weg und wir waren wieder unterwegs. Nicht auf dem Weg nach Hause, sondern in Richtung Westen. Ich wusste, wohin wir fuhren. Mr. Sculleys Schrottplatz befand sich im Westen hinter dem bewaldeten Stadtrand. Unterwegs musste ich mir den Vortrag meines Vaters anhören, den, der so begann: »Als ich so alt war wie du, musste ich zu Fuß gehen, wenn ich irgendwo hinwollte. Ich wünschte, ich hätte damals ein Rad gehabt, selbst wenn es gebraucht gewesen wäre. Mensch, wenn meine Freunde und ich mal zwei oder drei Meilen weit laufen mussten, haben wir da gar nicht weiter drüber nachgedacht. Und das hat uns auch gesund gehalten. Ob die Sonne schien, Sturm war oder es regnete – egal. Wir sind da, wo wir hinwollten, auf unseren eigenen zwei Beinen …« Und so weiter. Ihr kennt den Vortrag, den ich meine – den Lobgesang einer anderen Generation auf ihre Kindheit.
Wir ließen die Stadtgrenze hinter uns zurück und die regenglänzende Straße wand sich durch den nassen Wald. Es regnete immer noch. Nebelfetzen hingen an den Baumspitzen fest und trieben über die Straße. Dad musste langsam fahren, denn die Straße war hier selbst bei trockenem Wetter gefährlich. Mein Dad ließ sich immer noch über die zweifelhafte Freude aus, kein Fahrrad zu haben, und ich begann zu erkennen, dass es seine Art war mir zu sagen, ich sollte mich besser daran gewöhnen, falls mein Rad sich nicht reparieren ließ. Donner hallte von den diesigen Hügeln wider. Die vereinsamte Straße krümmte sich unter unseren Reifen wie ein Wildpferd, das gegen einen Sattel ankämpft. Ich weiß nicht, warum ich mich in diesem Moment umdrehte und einen Blick nach hinten warf, aber ich tat es.
Und ich sah das Auto, das mit hoher Geschwindigkeit hinter uns herfuhr.
Mir stellten sich die Nackenhaare auf und die Haut darunter prickelte, als würden Ameisen darüber laufen. Das Auto war ein schwarzer, tiefer gelegter, gemein aussehender Panther mit glänzenden Chromezähnen, und es raste durch die lange Kurve, die mein Vater gerade mit einer nervösen Zusammenarbeit von Bremse und Gaspedal bewältigt hatte. Unser Motor stotterte, aber ich konnte kein Geräusch von dem Auto hören, das uns immer näher kam. Hinter dem Lenkrad konnte ich eine Gestalt mit bleichem Gesicht erkennen. Ich sah rote und orangefarbene Flammen, die auf die schwarze Kühlerhaube lackiert waren. Und dann saß uns das Auto praktisch auf der Stoßstange und machte weder Anstalten, langsamer zu werden, noch uns zu überholen. Ich warf einen Blick auf meinen Vater und schrie: »Dad!«
Er zuckte zusammen und riss am Lenkrad. Die Reifen unseres Pick-ups schlitterten nach links über den verblassten Mittelstreifen und mein Vater kämpfte darum, dass wir nicht im Wald landeten. Dann fanden die Reifen wieder Halt, unser Auto richtete sich geradeaus, und Dad loderten Flammen in den Augen, als er mir das Gesicht zudrehte. »Bist du verrückt?«, fuhr er mich an. »Willst du uns umbringen?«
Ich sah nach hinten.
Das schwarze Auto war nicht mehr da.
Es hatte uns nicht überholt. Es war nirgendwo abgebogen. Es war einfach weg.
»Ich hab … ich hab …«
»Was hast du? Wo?«, verlangte er.
»Ich … dachte, ich hätte … ein Auto gesehen«, sagte ich. »Es hätte uns fast … erwischt, dachte ich.«
Er spähte in den Rückspiegel. Natürlich sah er nur denselben Regen und dieselbe leere Straße wie ich. Er streckte die Hand aus und berührte meine Stirn. »Du bist doch nicht krank?«
»Nein, Sir.« Ich hatte kein Fieber. Dessen war ich mir sicher. Mein Vater nahm seine Hand von meiner Stirn und legte sie wieder aufs Lenkrad, nachdem er überzeugt war, dass ich keine erhöhte Temperatur hatte. »Sitz einfach still«, sagte er, und ich gehorchte. Er konzentrierte sich wieder auf die schwierige Straße, aber sein Kiefermuskel zog sich ein paar Sekunden lang zusammen, und ich nahm an, dass er zu entscheiden versuchte, ob ich zu Dr. Parrish musste oder Stubenarrest verdiente.
Ich sagte nichts mehr über das schwarze Auto, da ich wusste, dass Dad mir nicht glauben würde. Aber ich hatte das Auto schon mal gesehen. In Zephyr. Es hatte sich immer mit einem Grollen und Knurren angekündigt, wenn es herumfuhr, und wenn es einen überholte, konnte man die Hitze riechen und den Asphalt schimmern sehen. »Das schnellste Auto der Stadt«, hatte Davy Ray mir gesagt, als er und ich mit den anderen Jungs an einem schwülen Augusttag vor dem Eishaus in der Merchants Street herumhingen und die kühle Brise genossen, die von den Eisblöcken ausging. »Mein Dad«, hatte Davy Ray mir anvertraut, »sagt, dass niemand schneller als Midnight Mona ist.«
Midnight Mona. So hieß das Auto. Der Typ, dem es gehörte, hieß Stevie Cauley. »Little Stevie« wurde er genannt, weil er keine eins-sechzig groß war, obwohl er schon zwanzig war. Er war ein Kettenraucher von Chesterfield-Zigaretten; vielleicht hatten die sein Wachstum gehemmt.
Aber der Grund, aus dem ich meinem Dad nicht sagte, dass Midnight Mona hinter uns auf der regenglitschigen Straße herraste, waren meine Erinnerungen an das, was in einer Nacht im letzten Oktober passiert war. Mein Dad, der zur Freiwilligen Feuerwehr gehört hatte, bekam einen Anruf. Es war Hauptbrandmeister Marchette, sagte er Mom. Ein Auto war auf der Route Sixteen von der Straße abgekommen und hatte im Wald Feuer gefangen. Mein Dad war schnell zur Hilfe hingefahren und ein paar Stunden später mit Asche im Haar und dem Geruch von verbranntem Holz in der Kleidung heimgekommen. Nach jener Nacht und dem, was er gesehen hatte, wollte er nicht mehr bei der Feuerwehr sein.
Wir waren jetzt auf der Route Sixteen unterwegs. Und bei dem Auto, das von der Straße abgekommen und ausgebrannt war, hatte es sich um Midnight Mona mit Little Stevie Cauley am Steuer gehandelt.
Little Stevie Cauleys Leiche – das, was davon übrig war, meine ich – lag auf dem Poulter Hill Friedhof im Sarg. Midnight Mona war ebenfalls nicht mehr da, sondern dort, wo ausgebrannte Autos hinkommen.
Aber ich hatte Midnight Mona gesehen, wie sie aus dem Nebel heraus auf uns zuraste. Ich hatte jemanden am Steuer gesehen.
Ich hielt den Mund. Ich hatte mir schon genug Ärger eingehandelt.
Dad bog von der Route Sixteen ab und fuhr vorsichtig auf einer schlammigen kurvigen Seitenstraße in den Wald hinein. Wir kamen an einer Stelle vorbei, an der alle möglichen alten rostigen Metallschilder an die Bäume genagelt waren; es mussten mindestens hundert sein, Werbung für alles von Green Spot Orange Soda über B.C. Headache Powders bis zum Grand Ole Opry. Von dem Schilderwald führte die Straße auf ein graues Holzhaus mit einer schiefen Veranda zu, in dessen Vorgarten – womit ich ein Meer von Unkraut meine und nicht einen Rasen und Blumen, wie die meisten Leute es kennen – auf ungeordneten Haufen eine wilde Kollektion von verrosteten Wäschemangeln, Küchenherden, Lampen, Bettgestellen, elektrischen Ventilatoren, Kühlschränken und kleineren Geräten lag. Es gab Drahtrollen groß wie mein Vater und riesige Körbe voller Flaschen, und inmitten des Schrotts stand ein Metallschild von einem lächelnden Polizisten, auf dessen Brust die rote Aufschrift HALT NICHT STEHLEN stand. In seinem Kopf befanden sich drei Schusslöcher.
Ich bezweifle, dass Diebstahl ein Problem für Mr. Sculley war, denn kaum, dass Dad hielt und die Tür aufmachte, sprangen zwei rote Jagdhunde von der Veranda und begannen ohrenbetäubend zu bellen. Ein paar Sekunden später klappte die Haustür auf und eine zerbrechlich aussehende kleine Frau mit langem weißem Zopf und einem Gewehr kam heraus.
»Wer’s da?«, brüllte sie mit einer Stimme wie ein Holzfäller. »Was woll’n Sie?«
Mein Vater hob die Hände. »Tom Mackenson, Mrs. Sculley. Aus Zephyr.«
»Tom wer?«
»Mackenson!« Er musste schreien, um die Jagdhunde zu übertönen. »Aus Zephyr!«
»Ruhe!«, grölte Mrs. Sculley und nahm eine Fliegenklatsche von einem Haken auf der Veranda, mit der sie den Hunden ein paar Schläge überzog, was das Gebell um ein paar Dezibel dämpfte.
Ich stieg aus dem Auto und stellte mich dicht neben meinen Dad. Unsere Schuhe versanken in versumpftem Unkraut. »Ich muss mit Ihrem Mann sprechen, Mrs. Sculley«, erklärte Dad. »Er hat aus Versehen das Fahrrad von meinem Sohn mitgenommen.«
»Nee«, gab sie zurück. »Emmet, der nimmt nichts aus Versehen mit.«
»Ist er da, bitte?«
»Hinterm Haus«, sagte sie und schwenkte das Gewehr in die Richtung. »In einem von den Schuppen da.«
»Danke.« Er setzte sich in Bewegung und ich folgte. Wir waren vielleicht ein halbes Dutzend Schritte weit gekommen, als Mrs. Sculley sagte: »He! Wenn ihr über was stolpert und euch die Knochen brecht, sind wir aber nicht verantwortlich, habt ihr gehört?«
Wenn das, was sich vor dem Haus stapelte, unordentlich war, dann war das dahinter ein absoluter Albtraum. Die beiden Schuppen waren Gebilde aus Wellblech, so groß wie Tabakscheunen. Um dorthin zu gelangen, musste man einem holprigen Pfad folgen, der sich zwischen Bergen von Abfall hindurchwand; Schallplattenspieler, zerbrochene Statuen, Gartenschläuche, Stühle, Rasenmäher, Türen, Kaminsimse, Töpfe und Pfannen, alte Ziegelsteine, Dachschindeln, Schürhaken, Autokühler und Waschschüsseln, um nur ein paar aufzuzählen. »Erbarme dich«, sagte Dad mehr zu sich selbst, als wir das Tal zwischen diesen hohen Bergen durchschritten. Der Regen rann und spritzte auf all die Gegenstände, lief an manchen Stellen gurgelnd wie ein kleiner Bach von den Metallbergspitzen herunter. Und dann kamen wir zu einem großen Stapel verdrehter und verhakter Gegenstände, der mich abrupt stehenbleiben ließ. Denn ich wusste, dass ich einen geradezu mystischen Ort gefunden hatte.
Vor mir waren Hunderte von Fahrradrahmen aufgetürmt, von Rost zusammengehalten, ohne Schläuche und mit gebrochenem Rücken.
Man sagt, dass die Elefanten in Afrika einen geheimen Friedhof haben, wo sie hingehen, um sich hinzulegen und sich von ihrem faltigen grauen Körper zu befreien; wo sie wegschweben und schließlich federleichte Geister werden. In jenem Moment glaubte ich, dass ich den Fahrradfriedhof gefunden hatte, wo die Kadaver Jahr um Jahr unter Regen und der heißen Sonne zerbröseln, lange, nachdem die Seele ihres Wanderlebens sie verlassen hat. An manchen Stellen in dem gewaltigen Haufen waren die Räder so verwest, dass sie eher wie rote und kupferne Blätter aussahen, die darauf warteten, an einem Herbsttag verbrannt zu werden. Anderswo stachen zerbrochene Scheinwerfer heraus, blind, aber auf tote Weise trotzig. Krumme Lenkstangen besaßen noch ihre Gummigriffe und von manchen Griffen baumelten bunte Vinylstreifen wie ausgebleichte Flammen. Ich stellte mir all diese Räder lebendig mit neuer Farbe vor, mit neuen Schläuchen und neuen Pedalen und Ketten, die sich in einem Bett aus sauberem neuem Fett an ihre Zahnräder schmiegten. Es machte mich auf eine Art traurig, die ich nicht begriff. Ich sah, wie alles ein Ende hat, egal, wie sehr wir etwas behalten wollen.
»Hallo aber auch!«, sagte jemand. »Mir war doch so, als wär der Alarm losgegangen.«
Mein Dad und ich sahen einen Mann, der eine große Handkarre durch den Matsch schob. Er hatte einen Overall und schlammbespritzte Stiefel an, einen dicken Bauch und einen Kopf voller Leberflecke, auf dem ein weißes Sträußchen Haare zu Berge stand. Mr. Sculleys Gesicht war faltig und seine Knollennase war an der Spitze durch kleine geplatzte Äderchen lila gefärbt. Seine grauen Augen lagen hinter runden Brillengläsern. Er grinste ein quadratisches Grinsen, das seine dunkelbraunen Zähne entblößte. Aus einem Leberfleck an seinem stoppeligen Kinn sprossen drei weiße Haare. »Was kann ich für Sie tun?«
»Ich bin Tom Mackenson«, sagte mein Dad und streckte die Hand aus. »Jays Sohn.«
»Ach ja! Tut mir leid, dass ich Sie nicht gleich erkannt hab!« Mr. Sculley trug dreckige Leinenhandschuhe. Er zog sich den rechten aus, um meinem Vater die Hand zu schütteln. »Und das ist Jays Enkel?«
»Ja. Cory heißt er.«
»Dich hab ich schon mal gesehen, glaube ich«, sagte Mr. Sculley zu mir. »Ich weiß noch, wie dein Daddy in deinem Alter war. Dein Grandpa und ich kennen uns schon lange.«
»Mr. Sculley, ich glaube, dass Sie heute Nachmittag ein Fahrrad eingesammelt haben«, sagte Dad. »Vor einem Haus in der Deerman Street?«
»Hab ich. War aber nicht mehr viel davon übrig. Es war völlig kaputt.«
»Tja, jedenfalls war das Corys Rad. Ich glaube, dass ich es reparieren lassen kann, wenn wir es wiederhaben könnten.«
»Oh«, machte Mr. Sculley. Sein quadratisches Grinsen verlor sich. »Ich glaube, da kann ich nicht helfen, Tom.«
»Wieso? Es ist doch hier, oder nicht?«
»Ja, es ist hier. War hier, meine ich.« Mr. Sculley zeigte auf einen der Schuppen. »Ich hab’s da grade vor ein paar Minuten reingebracht.«
»Dann können wir es doch rausholen und mitnehmen, oder nicht?«
Mr. Sculley lutschte an seiner Unterlippe, warf mir einen Blick zu und sah dann Dad an. »Das glaube ich nicht, Tom.« Er schob den Handkarren neben den Haufen tote Fahrräder. »Kommt mit und guckt selber.« Wir folgten ihm. Er humpelte beim Gehen, als wären seine Beine mit einem Scharnier statt einem Kugelgelenk an der Hüfte befestigt.
»Tja, das ist nämlich so«, sagte er. »Ich will diese alten Fahrräder schon seit über einem Jahr loswerden. Ich versuch nämlich, hier aufzuräumen. Ich brauche Platz für das, was neu reinkommt. Drum hab ich zu Belle gesagt – meiner Frau –, ich sag, Belle, wenn ich noch ein einziges Fahrrad mehr einsammele, mach ich’s. Nur ein einziges mehr.« Er führte uns durch eine offene Tür in das kühle Gebäude hinein. An Kabeln hängende Glühbirnen warfen Schatten zwischen noch mehr Müllberge. Hier und da stachen größere Dinge wie Maschinen vom Mars aus dem Halbdunkel und boten Sicht auf mysteriöse Kurven und Kanten. Irgendetwas quiekte und huschte davon, ob es Mäuse oder Fledermäuse waren, wusste ich nicht. Es war, als befänden wir uns in einer Höhle, in der Injun Joe sich heimisch fühlen würde.
»Passt auf, wo ihr hintretet«, warnte Mr. Sculley, als wir einen weiteren Türrahmen durchquerten. Dann blieb er neben einer großen rechteckigen Maschine mit Zahnrädern und Hebeln stehen. »Die Presse hier hat dein Fahrrad vor ungefähr fünfzehn Minuten verschlungen«, sagte er. »Es war als Erstes dran.« Er stieß gegen ein Fass, das mit verdrehten und zerknautschten Metallteilen gefüllt war. Andere Fässer warteten auf ihre Ladungen. »Ich kann das Metall nämlich verkaufen. Ich hatte bloß noch auf ein Fahrrad mehr gewartet, um anzufangen, sie zu pressen, und deins war dieses eine Rad.« Er sah mich an. Die Glühbirne über ihm schien ihm auf die regennasse Glatze. Seine Augen waren nicht unfreundlich. »Tut mir leid, Cory. Hätte ich gewusst, dass es von jemandem abgeholt wird, hätte ich’s beiseitegelegt. Aber es war tot.«
»Tot?«, fragte mein Vater.
»Klar. Alles stirbt. Es verschleißt und kann weder mit Liebe noch Geld wieder repariert werden. Das war der Zustand, in dem das Fahrrad gewesen war. In dem Zustand ist alles, das hier abgeliefert wird oder das ich einsammeln soll. Du weißt aber, dass dein Fahrrad schon lange tot war, bevor ich’s in die Presse gesteckt habe, oder, Cory?«
»Ja, Sir«, sagte ich. »Ich wusste es.«
»Es hat nicht gelitten«, versicherte Mr. Sculley mir, und ich nickte.
Mir schien, dass Mr. Sculley den Kernpunkt allen Lebens verstand, dass er seine Augen und sein Herz jung gehalten hatte, obwohl sein Körper alt geworden war. Er durchschaute die kosmische Ordnung der Welt und wusste, dass Leben nicht nur Fleisch und Knochen innewohnt, sondern auch Dingen – einem guten, treuen Paar Schuhe, einem verlässlichen Auto, einem stets funktionierenden Kugelschreiber, einem Fahrrad, das einen viele Meilen weit getragen hat –, denen wir vertrauen und die uns die Geborgenheit und Freude von Erinnerungen schenken.
An dieser Stelle werden alte Herzen aus Stein vielleicht lachen und sagen: »Das ist absurd!« Aber lasst mich diese Frage stellen: Wünscht ihr euch nicht – selbst nur einen Sekundenbruchteil lang –, dass ihr euer allererstes Fahrrad wiederhaben könntet? Ihr wisst noch, wie es aussah. Ihr erinnert euch. Habt ihr es Trigger oder Buttermilk, Flicka oder Lightning genannt? Wer hat das Fahrrad weggenommen und wo ist es hingekommen? Fragt ihr euch das nie?
»Ich will dir was zeigen, Cory«, sagte Mr. Sculley und berührte meine Schulter. »Komm mal mit.«
Mein Dad und ich folgten ihm von der Fahrradpresse weg in einen anderen Raum. Ein Fenster mit schmutzigen Scheiben ließ etwas grünliches Licht herein, das sich zum grellen Schein der Glühbirne gesellte. In diesem Zimmer befanden sich Mr. Sculleys Schreibtisch und Aktenschrank. Er machte den Schrank auf und fasste auf eine hohe Ablage. »Ich zeige das nicht jedem«, sagte er, »aber ich glaube, ihr zwei wollt das vielleicht gern sehen.« Er wühlte zwischen Kartons herum und sagte dann: »Ich hab’s.« Seine Hand kehrte aus dem Dunklen ins Licht zurück.
Er hielt ein Stück Holz. Die Rinde war ausgebleicht und kleine vertrocknete Muscheln klebten daran. Etwas, das wie ein dünner Dolch aus Elfenbein aussah, ungefähr fünfzehn Zentimeter lang, war in das Holz getrieben worden. Mr. Sculley hielt es ins Licht. Seine Augen glitzerten hinter den Brillengläsern. »Seht ihr? Was glaubt ihr, was das ist?«
»Keine Ahnung«, sagte Dad. Ich schüttelte ebenfalls den Kopf.
»Schaut es euch genau an.« Er hielt mir das Holzstück mit dem darin feststeckenden Elfenbeindolch vors Gesicht. Ich konnte kleine Dellen und Kratzer auf der Oberfläche des Elfenbeins sehen, dessen Kanten gezackt wie ein Fischmesser waren.
»Das ist ein Zahn«, sagte Mr. Sculley. »Höchstwahrscheinlich ein Reißzahn.«
»Ein Reißzahn?« Dad runzelte die Stirn. Sein Blick sprang zwischen Mr. Sculley und dem Holzstück hin und her. »Das muss eine gigantische Schlange gewesen sein!«
»Keine Schlange, Tom. Ich hab das Holzstück aus einem Stamm rausgesägt, den ich am Flussufer gefunden hab, als ich vor drei Sommern nach Flaschen gesucht hab. Der war angespült worden. Seht ihr die Muscheln? Muss ein alter Baum gewesen sein. Wahrscheinlich lag er lange auf dem Grund. Ich nehme an, dass die letzte Flut, die wir hatten, ihn aus dem Schlamm gelöst hat.« Vorsichtig fuhr er mit seinem behandschuhten Finger über die gezackte Kante. »Ich glaube, ich habe das einzige Beweisstück.«
»Sie meinen doch nicht …«, begann Dad, aber ich wusste bereits, worauf Mr. Sculley anspielte.
»Ja. Das hier ist ein Reißzahn aus dem Maul von Old Moses.« Er hielt ihn wieder vor mich hin, aber ich wich zurück. »Vielleicht kann er nicht mehr so gut sehen«, überlegte Mr. Sculley. »Vielleicht ist er auf den Baumstamm losgegangen, weil er ihn für ‘ne große Schildkröte hielt. Vielleicht war er an dem Tag einfach schlechtgelaunt und hat nach allem geschnappt, das ihm gegen die Schnauze gestoßen ist.« Er klopfte gegen den abgebrochenen Rand des Zahns. »Mag nicht dran denken, was das hier mit einem Menschen anstellen könnte. Wäre ziemlich unschön, was?«
»Kann ich mal sehen?«, fragte Dad, und Mr. Sculley ließ ihn den Zahn halten. Mr. Sculley ging ans Fenster und spähte hinaus, während Dad den Gegenstand in seiner Hand untersuchte. Nach einer Weile sagte Dad: »Ich würde schwören, dass Sie recht haben! Es ist ein Zahn!«
»Sag ich doch«, erinnerte Mr. Sculley ihn. »Ich lüge nicht.«
»Sie müssen das jemandem zeigen! Sheriff Amory oder Bürgermeister Swope! Herrje, der Gouverneur muss das zu sehen bekommen!«
»Swope hat’s schon gesehen«, erklärte Mr. Sculley. »Es war sein Rat, dass ich’s in meinen Schrank tun und die Tür abgeschlossen halten soll.«
»Warum denn? So was wie das hier macht Schlagzeilen!«
»Nicht laut Bürgermeister Swope.« Er wandte sich vom Fenster ab und ich sah, dass seine Augen sich verdunkelt hatten. »Swope hielt es zuerst für eine Fälschung. Er hat es Doc Parrish gezeigt, und Doc Parrish hat Doc Lezander zurate gezogen. Beide sind zu dem Schluss gekommen, dass es der Reißzahn von irgendeinem Reptil ist. Dann haben wir uns alle hinter verschlossenen Türen im Büro des Bürgermeisters beratschlagt. Swope meinte, er sei zu dem Schluss gekommen, dass er das nicht an die Öffentlichkeit gelangen lassen will. Er meinte, es könnte ein Reißzahn sein oder es könnte eine Fälschung sein, aber es sei’s nicht wert, dass die Leute deswegen in Aufregung geraten.« Er nahm das durchbohrte Holzstück von meinem Vater wieder entgegen. »Ich sagte: Luther Swope, denken Sie nicht, dass die Leute ein echtes Beweisstück sehen wollen, dass es im Tecumseh River ein Monster gibt? Und er guckt mich mit seiner verdammten Pfeife im Mund an und sagt: Die Leute wissen das schon. Beweise würden ihnen bloß Angst einjagen. Und wenn es im Fluss ein Monster gibt, ist es unser Monster, und das wollen wir mit niemandem teilen. Und das war das Ende vom Lied.« Mr. Sculley hielt es mir hin. »Willst du’s mal anfassen, Cory? Bloß damit du sagen kannst, du hast es angefasst?«
Zögernd tat ich es mit dem Zeigefinger. Der Reißzahn war kühl, so, wie ich mir den schlammigen Grund des Flusses vorstellte.
Mr. Sculley stellte das Holzstück mit dem Zahn wieder nach oben auf die Ablage und schloss die Schranktür. Draußen prasselte der Regen härter, hämmerte auf das Metalldach. »Dass all das Wasser runterkommt«, meinte Mr. Sculley, »muss Old Moses äußerst glücklich machen.«
»Ich finde trotzdem, dass Sie das jemand anderes zeigen sollten«, sagte Dad. »Zum Beispiel jemandem von der Zeitung in Birmingham.«
»Würde ich ja, Tom, aber vielleicht hat Swope recht. Vielleicht ist Old Moses unser Monster. Vielleicht würden die Leute versuchen, ihn von uns wegzuholen, wenn alle Welt davon weiß – ihn mit einem Netz fangen und irgendwo wie einen zu groß geratenen Wels in ein großes Wasserbecken stecken.« Mr. Sculley runzelte die Stirn und schüttelte den Kopf. »Nee, das würde ich nicht wollen. Und die Lady auch nicht, nehme ich an. Die füttert ihn jeden Karfreitag, solange ich zurückdenken kann. Dieses Jahr war das erste, wo ihm sein Futter nicht gefallen hat.«
»Es hat ihm nicht gefallen?«, fragte Dad. »Was soll das heißen?«
»Haben Sie die Parade dieses Jahr nicht gesehen?« Mr. Sculley wartete auf Dads Verneinung und sprach dann weiter. »Das war das erste Jahr, in dem Old Moses der Brücke nicht einen mit seinem Schwanz versetzt hat, um Danke für das Futter zu sagen. Das geht immer ganz schnell und ist sofort wieder vorbei, aber wenn man das jedes Jahr hört, kennt man das Geräusch. Dieses Jahr ist’s nicht passiert.«
Ich erinnerte mich, wie besorgt die Lady an dem Tag ausgesehen hatte, als sie die Brücke verließ, und wie ernst die gesamte Prozession gewesen war, als sie nach Bruton zurückmarschierte. Das musste gewesen sein, weil die Lady Old Moses nicht mit dem Schwanz gegen die Brückenpfeiler klatschen gehört hatte. Aber was bedeutete dieser Mangel an Tischmanieren?
»Schwer zu sagen, was es bedeutet«, sagte Mr. Sculley, als hätte er meine Gedanken gelesen. »Jedenfalls hat’s der Lady nicht gefallen.«
Draußen begann es dunkel zu werden. Dad sagte, dass wir uns jetzt besser auf den Weg nach Hause machen sollten, und bedankte sich bei Mr. Sculley dafür, dass er sich die Zeit genommen hatte, uns zu zeigen, wo das Fahrrad gelandet war. »Es ist nicht Ihre Schuld«, sagte Dad, als Mr. Sculley vor uns herhinkte, um uns nach draußen zu geleiten. »Sie haben nur Ihre Arbeit gemacht.«
»Ja. Ich hatte noch auf ein einziges Fahrrad gewartet. Wie gesagt, das Rad hätte man sowieso nicht mehr reparieren können.«
Das hätte ich meinem Vater auch sagen können. Ich hatte es ihm sogar gesagt, aber eine traurige Tatsache ist, dass Erwachsene einem Kind nur mit halbem Ohr zuhören.
»Ich hab von dem Auto im See gehört«, sagte Mr. Sculley, als wir uns der Tür näherten. In dem höhlenartigen Raum hallte seine Stimme wider. Ich spürte, wie mein Vater sich verspannte. »Eine schlimme Art für einen Mann zu sterben, ganz ohne ein christliches Begräbnis«, fuhr Mr. Sculley fort. »Sind bei Sheriff Amory irgendwelche Hinweise eingegangen?«
»Nicht, dass ich wüsste.« Die Stimme meines Vaters zitterte leicht. Ich war mir sicher, dass er jeden Abend, wenn er ins Bett ging und die Augen zumachte, das versinkende Auto und die ans Lenkrad gekettete Leiche vor sich sah.
»Ich hab meine eigene Theorie, wer das war und wer ihn umgebracht hat«, ließ Mr. Sculley verlauten. Wir waren an der Tür angelangt, aber der Regen trommelte weiterhin hart auf die Berge aus alten toten Dingen. Das letzte bisschen Sonnenlicht sah grün aus. Mr. Sculley sah meinen Vater an und lehnte sich gegen den Türrahmen. »Das war einer, der den Blaylock-Klan gegen sich aufgebracht hat. Der kann nicht von hier gewesen sein, weil alle anderen Leute, die bei Verstand sind, wissen, dass Wade, Bodean und Donny Blaylock mieser sind als ’n Nest von Klapperschlangen. Die haben hier doch überall im Wald ihre Destillierapparate versteckt. Und ihr Daddy Biggun, der könnte selbst dem Teufel neue Tricks beibringen. Ja, Sir, die Blaylocks sind schuld, dass der Typ da unten im See liegt. Darauf können Sie wetten.«
»Ich nehme an, dass der Sheriff diese Vermutung bereits gehabt hat.«
»Wahrscheinlich. Das Problem ist nur, dass niemand weiß, wo die Blaylocks sich verstecken. Ab und zu tauchen sie auf, haben irgendwas Mieses vor, aber sie in ihrem Schlangennest zu finden, ist ’ne andere Sache.« Mr. Sculley sah nach draußen. »So stark regnet’s nicht mehr. Ich nehme an, dass ihr zwei nichts dagegen habt, nass zu werden.«
Wir trotteten durch den Matsch auf Dads Pick-up zu. Als wir an dem Haufen Fahrräder vorbeikamen, betrachtete ich ihn noch mal und entdeckte etwas, das mir vorher nicht aufgefallen war: Geißblatt rankte sich durch das wirre Metall. Die kleinen, süß duftenden weißen Blüten wuchsen mitten im Rost.
Die Aufmerksamkeit meines Vaters wurde von etwas anderem erregt, das hinter den Rädern lag, etwas, das wir beim Herkommen nicht gesehen hatten. Er blieb stehen und starrte, und ich blieb ebenfalls stehen. Mr. Sculley, der vor uns hergehinkt war, merkte, dass wir nicht mehr folgten, und drehte sich um.
»Ich hatte mir Gedanken gemacht, wo sie’s wohl hingebracht hatten«, sagte Dad.
»Ja, das muss ich jetzt irgendwann mal wegbringen. Ich muss ja Platz für Neues machen, nicht?«
Es war eigentlich nicht viel zu sehen. Es war nur ein rostiger Klumpen zerdrückten Metalls, aber an manchen Stellen war noch die schwarze Farbe zu sehen. Die Windschutzscheibe fehlte, das Dach war plattgedrückt. Ein Teil der Kühlerhaube war aber noch erkennbar und darauf züngelten sich auflackierte Flammen.
Das hier hatte gelitten.
Dad wandte sich ab und ich folgte ihm zum Pick-up. Dicht auf seinen Fersen.
»Kommen Sie gern mal wieder vorbei!«, sagte Mr. Sculley. Die Jagdhunde bellten und Mrs. Sculley kam auf die Veranda heraus, diesmal ohne ihr Gewehr. Dad und ich fuhren auf der von Gespenstern heimgesuchten Straße nach Hause.