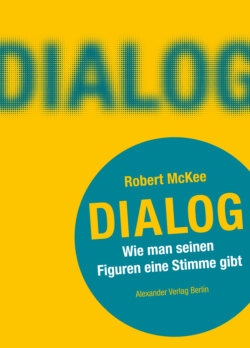Читать книгу Dialog - Robert McKee - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
NARRATIVER DIALOG
ОглавлениеNarrativ bedeutet außerhalb der Szene gesprochen. In solchen Fällen verschwindet die sogenannte vierte Wand des Realismus, und die Figur tritt aus dem dramatischen Ablauf der Story heraus. Auch hier sind narrative Reden streng genommen keine Monologe, sondern Dialoge, in denen die Figur die verbale Aktion vornimmt, sich direkt an die Leser, Zuschauer oder an sich selbst zu wenden.
Was den zugrundeliegenden Wunsch betrifft, so möchte ein Ich-Erzähler in einem Prosatext oder eine Figur, die von der Bühne oder Leinwand herunter erzählt, ihre Leser/Zuschauer vielleicht einfach nur auf den aktuellen Stand der Ereignisse bringen und ihre Neugier auf Künftiges wecken. Womöglich nutzt sie den narrativen Dialog also nur dafür, dieses schlichte Vorhaben umzusetzen.
In einer komplexeren Situation könnte die Figur ihre Worte beispielsweise nutzen, um die Leser/Zuschauer dazu zu bewegen, ihre früheren Missetaten zu verzeihen, und sie gleichzeitig dahingehend zu beeinflussen, dass sie die Feinde der Figur ebenfalls aus ihrem voreingenommenen Blickwinkel, ihrem Point of View (POV), sehen. Den möglichen Wünschen, die eine Figur von Story zu Story zur Aktion anregen, und der Taktik, die sie jeweils einsetzt, wenn sie zu den Lesern/Zuschauern spricht, scheinen keine Grenzen gesetzt.
Das Gleiche gilt für eine Figur, die sich nach innen wendet, um ein Gespräch mit sich selbst zu führen. Damit kann sie jeden beliebigen Zweck verfolgen: eine Erinnerung aus reiner Freude noch einmal durchleben, sich den Kopf zerbrechen, ob sie auf die Zuneigung eines geliebten Menschen wirklich bauen kann, die eigene Hoffnung schüren, indem sie sich ein künftiges Leben ausmalt etc. – während ihre Gedanken Vergangenheit, Gegenwart und jede mögliche Zukunft, erdacht oder real, durchstreifen.
Um zu zeigen, wie derselbe Inhalt in drei verschiedenen Dialogformen ausgedrückt werden kann, möchte ich mit einer Passage aus dem Roman Doktor Glas arbeiten, der 1905 von dem schwedischen Schriftsteller Hjalmar Söderberg verfasst wurde.
Das Buch hat die Form eines Tagebuchs, das vom Titelhelden selbst geführt wird. Ein reales Tagebuch zeichnet die heimlichen Gespräche auf, die Tagebuchschreibende mit sich selbst führen; folglich muss auch ein fiktives Tagebuch so geschrieben sein, dass die Leser das Gefühl bekommen, sie könnten den heimlichen inneren Dialog irgendwie mithören.
In Söderbergs Roman will Doktor Glas eine seiner Patientinnen, die er insgeheim liebt, vor ihrem sexuell gewalttätigen Ehemann retten. Tag für Tag wägt er im Geiste die moralischen Argumente ab, die für oder gegen einen Mord an dem Mann sprechen; in endlosen Albträumen setzt er seine Mordabsicht um. (Und im weiteren Verlauf des Buches vergiftet er den Ehemann tatsächlich.) In einem Eintrag, der vom 7. August datiert ist, erwacht er schweißgebadet aus einem solchen Albtraum. Hören wir einmal in den weitschweifigen narrativen Dialog hinein, mit dem Glas sich selbst einzureden versucht, sein grässlicher Traum sei keine Prophezeiung:
»Träume sind Schäume.« … Ich kenne dich, alte Spruchweisheit. Und das meiste, was man träumt, ist tatsächlich keinen Gedanken wert – Fragmente von dem, was man erlebt hat, oft das Belangloseste und Dümmste, was das Bewusstsein nicht für wert befunden hat, in sich aufzunehmen, was aber trotzdem in irgendeiner Rumpelkammer des Gehirns sein eigenes Schattendasein führt. Es gibt aber auch andere Träume. Ich weiß noch, wie ich einmal als Junge einen ganzen Nachmittag lang über einem geometrischen Problem gebrütet habe und zu Bett gehen musste, ohne es gelöst zu haben: Im Schlaf arbeitete das Gehirn selbstständig weiter und gab mir im Traum die Lösung. Und sie war richtig. Es gibt auch Träume, die sind wie Blasen aus der Tiefe, wenn ich es recht bedenke: Manches Mal hat mich ein Traum etwas über mich selbst gelehrt. Manches Mal hat der Traum mir Wünsche offenbart, die ich nicht wünschen wollte, Begierden, die ich bei Tageslicht verleugnete.
Diese Wünsche und Begierden habe ich dann im helllichten Sonnenschein gewogen und geprüft. Aber selten vertrugen sie das Licht, und meistens habe ich sie in die finstere Tiefe zurückgestoßen, wo sie hingehörten. In den Träumen der Nacht kehrten sie dann zuweilen wieder, doch ich habe sie erkannt und sie auch im Traum höhnisch belächelt, bis sie jeden Anspruch aufgaben, emporzusteigen und im Licht der Wirklichkeit zu leben.5
Gleich in der ersten Zeile erwähnt Glas ein Sprichwort, das ihm durch den Kopf geht, als hätte dieser Gedanke seinen ganz eigenen Kopf. Dann wendet er sich der Auseinandersetzung mit seiner schweigenden, dunklen, unmoralischen Seite zu, einem Ich, in dem die Mordlust brodelt. Im letzten Satz schließlich glaubt er, sein besseres Ich habe die Auseinandersetzung gewonnen – zumindest für den Augenblick. Beachten Sie auch, wie die Sätze die ausufernde, sich stetig steigernde Form von Grübeleien annehmen.
Jetzt nehmen wir einmal an, Söderberg hätte diese Passage als narrativen Dialog geschrieben, mit dem sich Doktor Glas direkt an die Leser wendet. Um beim Schreiben die Stimme zu finden, mit der Doktor Glas zu anderen Menschen spricht, könnte Söderberg ihm den herrischen Ton gegeben haben, den Ärzte oft einsetzen, wenn sie ihren Patienten etwas verordnen. Die Sätze könnten kürzer sein und mehr Imperative verwenden. Anweisungen, Verbote und Einschränkungen könnten dazu dienen, den Überlegungen einen schärferen Drall zu verleihen:
»Träume sind Schäume.« Das Sprichwort haben Sie sicher schon gehört. Glauben Sie es bloß nicht. Das meiste, was man träumt, ist tatsächlich keinen Gedanken wert. Diese Fragmente von dem, was man erlebt hat, sind die dummen, belanglosen Dinge, die das Bewusstsein nicht für wert befindet. Trotzdem, in irgendeiner Rumpelkammer des Gehirns führen sie noch ihr eigenes Schattendasein. Das ist ungesund. Aber manche Träume sind auch ganz nützlich. Als Junge habe ich einmal einen ganzen Nachmittag lang über einem geometrischen Problem gebrütet. Ich musste zu Bett gehen, ohne es gelöst zu haben. Aber im Schlaf arbeitete das Gehirn weiter, und ein Traum gab mir die Lösung. Es gibt auch gefährliche Träume, die wie Blasen aus der Tiefe aufsteigen. Wenn man es wagt, über sie nachzudenken, ist das, als würde man etwas über sich selbst aus ihnen lernen – einen Wunsch, den man sich gar nicht wünschen wollte, Begierden, die man niemals laut äußern würde. Aber glauben Sie denen bloß nicht. Wenn Sie sie erst einmal wiegen und prüfen, halten diese Träume dem helllichten Sonnenschein nicht stand. Also tun Sie einfach, was jeder gesunde Mensch tun würde. Stoßen Sie sie in die finstere Tiefe zurück, wo sie hingehören. Und wenn sie Sie nachts doch wieder quälen, lachen Sie sie aus, bis sie jeden Anspruch aufgeben, Teil Ihrer Wirklichkeit zu werden.
Als dritte Option könnte sich Söderberg, der auch Theaterstücke schrieb, vielleicht entschlossen haben, seine Ideen für die Bühne dramatisch zu gestalten. Er könnte seinen Doktor auf zwei Figuren verteilt haben: Glas und Markel. Der Journalist Markel ist im Roman Glas’ bester Freund. In einem Theaterstück könnte er die moralisch aufrechte Seite des Arztes verkörpern, während Glas selbst die gequälte Seite spielt, die in Versuchung ist, den Mord zu begehen.
Im Subtext der nachstehenden Szene sucht Glas Hilfe bei Markel, um sich von seinen beängstigenden Träumen zu befreien. Markel spürt das und beantwortet die Fragen des Doktors daher mit moralisch positiven Aussagen. Der Text behält die Bildsprache des Romans bei (tatsächlich unterstützt das Theater bildhafte Sprache sogar enorm), verändert das Zeilen-Design aber von geschlossen zu offen, um den Schauspielern den Einsatz zu erleichtern. (Zur Analyse des Zeilen-Desgins vgl. Sie auch Kapitel 5.)
Glas und Markel sitzen im Café. Während es draußen langsam dunkel wird, trinken sie nach dem Abendessen ihren Brandy.
GLAS: Kennen Sie eigentlich das Sprichwort »Träume sind Schäume«?
MARKEL: Ja, das hat meine Großmutter immer gesagt, aber in Wirklichkeit sind doch die meisten Träume nur Fragmente des Tages, die es nicht wert sind, dass man sie behält.
GLAS: So wertlos sie auch sind, in irgendeiner Rumpelkammer des Gehirns führen sie doch ihr Schattendasein weiter.
MARKEL: In Ihrem Gehirn vielleicht, Doktor, nicht in meinem.
GLAS: Aber glauben Sie denn nicht, dass Träume uns auch Einsichten bringen können?
MARKEL: Manchmal vielleicht. Als Junge habe ich einmal einen ganzen Nachmittag lang über einem geometrischen Problem gebrütet. Als ich zu Bett gehen musste, war es noch nicht gelöst. Aber im Schlaf arbeitete mein Gehirn weiter, und ein Traum gab mir die Lösung. Am nächsten Morgen habe ich sie nachgeprüft, und ob Sie’s glauben oder nicht, sie war richtig.
GLAS: Nein, ich meinte eher etwas Verborgenes, Einsichten in sich selbst, Blasen, die aus der Tiefe aufsteigen, dunkle Begierden, die man beim Frühstück niemals zu äußern wagen würde.
MARKEL: Wenn ich solche Träume hätte, und ich will nicht behaupten, dass ich sie jemals hatte, dann würde ich sie in die finstere Tiefe zurückstoßen, wo sie hingehören.
GLAS: Und was, wenn die Begierden Nacht für Nacht zurückkehrten?
MARKEL: Dann würde ich davon träumen, wie ich sie verspotte und sie mir aus den Gedanken lache.
Alle drei Versionen enthalten im Wesentlichen denselben Inhalt, doch wenn das Gesagte die Richtung wechselt, von »zu sich selbst gesagt« über »zum Leser gesagt« bis hin »zu einer anderen Figur gesagt«, verändert auch die Sprache auf radikale Weise ihre Form, ihren Stil, ihre Tonalität und ihre »Textur«. Die drei grundlegenden Dialogformen erfordern drei scharf voneinander abgesetzte Schreibstile.