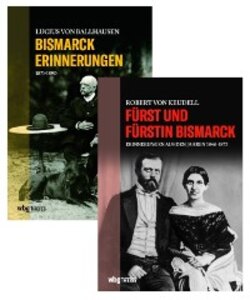Читать книгу Begegnungen mit Bismarck - Robert von Keudell - Страница 19
VII.
Allmähliche Lockerung des österreich. Bündnisses.
Gasteiner Vertrag.
August 1864 bis August 1865.
ОглавлениеAm 1. August abends fuhr der Minister mit Abeken und mir nach Salzburg, am 2. im offenen Postwagen nach Gastein.
Er hatte sich in Berlin eine Menge österreichischer Silbergulden einwechseln lassen, um sie als Trinkgelder zu verwenden und, wie er scherzweise sagte, auch den Postillonen, die vermutlich seit Jahren nichts als Papiergeld gesehen hätten, eine Vorstellung von der Ueberlegenheit der preußischen Finanzen zu geben. Es amüsierte ihn, die erstaunten Gesichter der Leute zu beobachten, wenn ich ihnen die blanken Silberlinge einhändigte.
Den Aufenthalt im engen Hochgebirgsthal von Gastein liebte Bismarck nicht, obwohl die dortigen Bäder ihm zusagten. Er sprach öfters aus, daß der Mangel eines weiten Horizonts ihm unerfreulich wäre und daß er die der Jahreszeit gemäßen Getreidefelder ungern vermißte. Man hatte für ihn keine andere Wohnung gefunden, als zwei Zimmer in dem großen Straubingerschen Gasthofe, der unmittelbar an dem berühmten Wasserfalle liegt. Das unaufhörliche Brausen der hoch herabstürzenden Wassermassen quälte seine empfindlichen Nerven. Jetzte erst meinte er, „den tiefen Sinn des alten Liedes ‚Büchlein laß dein Rauschen sein‘ ganz zu erfassen“.
Berge zu ersteigen, sagte er, hätte ihm nie rechte Freude gemacht. Als Student wäre er einmal trotz starken Nebels auf den Rigi gestiegen und, als nach dem Herabsteigen das Wetter sich klärte, sogleich zum zweiten Mal. An so etwas auch nur zu denken, wäre ihm jetzt unbehaglich. In der Ebene gehe und reite er gern und ausdauernd; starke Steigungen aber wären ihm unerwünscht.
Als die Kur des Königs beendet war, gab der Minister sich und uns drei Ferientage. Ohne Telegrammadressen zu hinterlassen, fuhren wir bergab und seitwärts nach Radstadt, am zweiten Tage nach Hallstadt und trafen am dritten in Ischl wieder mit dem königlichen Gefolge zusammen.
Dann waren wir alle während dreier Tage Gäste Seiner Majestät des Kaisers Franz Joseph in Schönbrunn. Zwei große Treibjagden, im Walde auf Hirsche und im Felde auf niederes Wild, machten dem Minister viel Vergnügen.
In diesen sonnigen Festtagen kam aber die Frage der Zukunft Schleswig-Holsteins ihrer Lösung nicht näher. Der König wünschte eine baldige Entscheidung nicht, weil die verschiedenen Erbansprüche noch nicht gründlich geprüft waren. Bei Berührung der Möglichkeit einer preußischen Annexion trat hervor, daß Oesterreich eine solche nur gegen Abtretung deutschen Gebietes oder Garantie für seinen außerdeutschen Besitz genehmigen würde, daß aber der König beide Bedingungen unannehmbar fand. Er hätte eher auf Schleswig-Holstein verzichtet als ein Stück von Schlesien abgetreten oder eine Garantie in Betreff Venetiens übernommen.
Auch bei den handelspolitischen Besprechungen kam es zu keinem klaren Ergebnis.
Die durch den preußisch-französischen Handelsvertrag von 1862 verursachte Zollvereinskrise war damals noch nicht ganz beendigt, wenn auch der endliche Beitritt der noch zögernden Staaten (Bayern, Württemberg, Hessen-Darmstadt und Nassau) als wahrscheinlich galt. Mit diesen zusammen hatte Rechberg in den Jahren 1862 und 63 gegen Ausdehnung des preußisch-französischen Handelsvertrages gewirkt. Man bezog sich dabei auf einen in dem preußisch-österreichischen Handelsvertrage von 1853 enthaltenen Artikel (25.), welcher zusagte, daß nach zwölf Jahren (also 1865) über eine vollständige Zolleinigung zwischen Preußen und Oesterreich verhandelt werden sollte. Aus dieser Zusage wollte man folgern, daß Preußens Tarifpolitik keine Richtung einschlagen dürfe, welche die Zolleinigung mit Oesterreich erschweren würde. Zu Ende des Jahres 1863 hatte nun zwar Graf Rechberg aus politischen Rücksichten diesen Kampf eingestellt; im Juli 1864 aber war er mit den genannten früheren Kampfgenossen übereingekommen, die jetzt offenbar nicht zu erreichende Zolleinigung wenigstens für die Zukunft als ein zu erstrebendes Ziel festzuhalten. Er legte daher hohen Wert darauf, daß die erwähnte Zusage des alten Vertrages (Art. 25) in den neuen Handelsvertrag ausgenommen würde, welcher im Jahre 1865 wieder auf 12 Jahre mit Preußen abzuschließen war. Er deutete an, daß entgegengesetzten Falles seine Ministerstellung unhaltbar werden würde.
Bismarck war verwundert, daß sein Kollege einer offenbar inhaltleeren Phrase so große Wichtigkeit beimaß; denn da für eine vollständige Zolleinigung zwischen dem Deutschen Zollverein und Oesterreich gewisse unerläßliche Vorbedingungen fehlten, war mit Sicherheit vorauszusehen, daß dieses Ziel 1877 ebenso unerreichbar sein würde wie 1865. Er fand aber das Versprechen, nach 12 Jahren über eine unlösbare Aufgabe zu verhandeln, völlig ungefährlich und sagte zu, in Berlin bei den Fachministern für Erfüllung dieses Wunsches zu thun, was er vermöchte. So trennte man sich in Freundschaft24.
Auf der Durchreise nach Baden besuchte Bismarck in München den Minister von Schrenck. Eine Nacht blieben wir in Augsburg in dem berühmten Gasthof „Zu den drei Mohren“. Dort wurde das Frühstück vor demselben Kamine serviert, in welchem Anton Fugger vor den Augen Kaiser Karls V. dessen Schuldschein verbrannt hat.
Am 29. August abends kamen wir nach Baden, wo der preußische Gesandte, Graf Flemming, eine zwischen bewaldeten Hügeln schön gelegene Villa, in welcher auch er mit seiner Familie wohnte, für Bismarck und dessen Begleiter gemietet hatte. Die nun folgenden sonnigen Herbsttage in Waldesstille wären für Bismarck erquicklich gewesen, wenn nicht ein Uebermaß von Geschäften und Besuchen ihn täglich ermüdet hätte. Doch schaffte er sich mitunter eine freie Stunde, um dem schönen Violoncellspiel des Grafen Flemming mit Behagen zuzuhören.
Nach kurzem Aufenthalt in Frankfurt kehrten wir am 12. September nach Berlin zurück. Der Minister fuhr bald darauf zu seiner nicht unbedenklich erkrankten Gemahlin nach Reinfeld und verweilte dort bis zum 27. Dann reiste er am 1. Oktober mit Abeken und mir wieder nach Baden und am 5. allein nach Biarrits.
Die dienstlichen Sommerreisen hatten für mich die Folge, daß ich angewiesen wurde, wie unterwegs so auch in Berlin, alle Eingänge und Ausgänge der politischen Abteilung täglich zu lesen. Von da ab mußte also jede Bewegung unserer auswärtigen Politik zu meiner Kenntnis kommen.
* * *
Während der auf die Abreise von Schönbrunn folgenden sechs Wochen hatte Bismarck vielfach über Rechbergs erwähnten Wunsch in Betreff des Handelsvertrags sowohl mit unsern Fachministern als mit dem österreichischen Kollegen korrespondiert. Einigung war aber in Berlin auch durch mündliche Besprechungen nicht zu erreichen. Der damalige Leiter der Zollvereinspolitik, Ministerialdirektor Delbrück, erklärte, ins Privatleben zurücktreten zu wollen, wenn durch Wiederaufnahme des Versprechens, nach 12 Jahren über Zolleinigung mit Oesterreich zu verhandeln, die Quelle der zollpolitischen Intrigen der letzten Jahre offengehalten würde. Sein Chef, der Handelsminister, trat für Delbrücks Auffassung ein, ebenso der Finanzminister.
Bismarck drang mit Entschiedenheit darauf, daß zur Erhaltung des einzigen Wiener Vertreters der preußischen Allianz in seiner leitenden Stellung eine Phrase in den Vertrag gesetzt würde, welche, wenn wir unserer Festigkeit vertrauten, praktische Bedeutung nie erhalten könnte. Die Nichtgewährung dieser rein formellen Konzession müsse in Wien den Eindruck machen, als ob uns das Stehen oder Fallen des Grafen Rechberg gleichgültig sei.
Der König entschied für die Fachminister. Dem Vernehmen nach war Sr. Majestät die innere Unwahrheit unannehmbar, welche in dem Versprechen gelegen hätte, über etwas zu verhandeln, was man unter keinen Umständen zu konzedieren fest entschlossen war. Wenn die Stellung des Grafen Rechberg von einer solchen Phrase abhing, so mußte sie schon tief erschüttert sein; und, um ihn vielleicht noch kurze Zeit am Ruder zu halten, wäre der Verlust des unersetzlichen Delbrück ein zu großes Opfer. Der preußische Bevollmächtigte zu den in Prag beabsichtigten Konferenzen über den Handelsvertrag erhielt demnach entsprechende Instruktion.
Rechberg fühlte sich tief gekränkt.
Bismarck erhob noch von Biarrits aus telegraphisch und schriftlich dringende Vorstellungen, um nachträgliche Gewährung der verlangten Konzession zu erreichen, aber vergeblich. Die Preisgebung des Grafen Rechberg gerade in diesem Augenblick hielt er für einen schweren politischen Fehler; an Roon schrieb er aus Biarrits, er müsse sich von aller Verantwortung für die Rückwirkungen dieses Fehlers auf unsere auswärtige Politik lossagen.
Sein nachhaltiger Kummer über den harten Eingriff der Fachminister in die schonungsbedürftigen Beziehungen zu Oesterreich beweist unwiderleglich, wie ernst sein Bestreben war, die obwaltenden Schwierigkeiten friedlich auszugleichen, und wie fern ihm der Gedanke lag, durch einen großen Krieg Gelegenheit zur Lösung des preußischen Verfassungskonflikts suchen zu wollen. Diesen hoffte er durch vieljährige Konsequenz endlich zu annehmbarem Austrage zu bringen. Der unaufhörlich wiederholte Vorwurf des Verfassungsbruches würde, meinte er, sich nach und nach abstumpfen und auf die öffentliche Meinung geringere Wirkung ausüben als zu Anfang des Konflikts.
Rechberg trat Ende Oktober, kurz vor dem endgültigen Abschluß des „Wiener Friedens“ mit Dänemark, in das Privatleben zurück.
Wenn Bismarck von dessen geheimen Eröffnungen an den Erbprinzen von Augustenburg Kenntnis gehabt hätte, würde er den Sturz desselben wohl nicht so schmerzlich bedauert haben. Denn danach mußte ausgeschlossen erscheinen, daß dieser Vertreter der preußischen Allianz unsere für die Einsetzung eines Herzogs in Schleswig-Holstein notwendigerweise zu stellenden Bedingungen hätte befürworten oder gar bei dem Widerstreben der ganzen politischen Welt Wiens zur Annahme bringen können. In Schönbrunn war nun bereits hervorgetreten, daß Oesterreichs Zustimmung zur Annexion nur unter einer für den König unannehmbaren Bedingung erreichbar schien. Kriegerische Lösung der Frage war daher, auch wenn Rechberg im Amte blieb, wahrscheinlich. Wäre es jedoch dessen vermittelnder Thätigkeit gelungen, den Krieg hinauszuschieben, so würde die europäische Lage sich ungünstiger für uns gestaltet haben. Denn vom Herbst 1867 ab waren alle in Mexiko verwendet gewesenen französischen Truppen wieder in Frankreich verfügbar, und dann hätte der Kaiser Napoleon vermutlich ganz anders eingegriffen, als es 1866 geschah.
Ich bin deshalb der Meinung, daß die vom Könige wegen des Handelsvertrages getroffene Entscheidung das Vaterland keinesfalls irgendwie geschädigt, sondern vielleicht vor großem Schaden bewahrt hat.
Der unter der Bezeichnung „Wiener Friede“ bekannte Friedensvertrag mit Dänemark wurde auf der erwähnten Grundlage des Präliminarfriedens vom 1. August in Wien am 30. Oktober abgeschlossen.
* * *
Nach Rückkehr des Ministers von Biarrits (29. Oktober) kam ich in die Lage, bei ihm die Einberufung des Gerichtsassessors a. D. Bucher in das Auswärtige Amt anzuregen.
In den Jahren 1864 bis 1866 erhielt ich fast täglich schriftliche Mitteilungen und politische Ratschläge von Herrn Rudolf Schramm, einem unabhängigen Rheinländer, welcher früher der demokratischen Partei angehört hatte, seit 1862 aber sich öffentlich als Anhänger Bismarcks bekannte und später zum Generalkonsul in Mailand ernannt wurde. Der Minister beauftragte mich, alle Briefe Schramms zu lesen, aber nur ganz ausnahmsweise, nach meinem Ermessen, darüber Vortrag zu halten. Dazu schien mir die im November 1864 eingehende Meldung geeignet, daß Lothar Bucher, mit seinen früheren Parteigenossen gänzlich zerfallen, im Wolffschen Depeschenbureau seinen Lebensunterhalt erwerbe und vielleicht für den auswärtigen Dienst zu gewinnen sein würde.
Ich hatte im Jahre 1848 in Cöslin einen Bruder und den Vater Buchers als sehr gebildete und achtbare Männer kennengelernt. Lothar, der damals in der Nachbarstadt Stolp als Kreisrichter angestellt war, aber viele Jahre bei den Cösliner Gerichten gearbeitet hatte, lernte ich nicht persönlich kennen. Es wurde indes gelegentlich seiner Wahl zur preußischen Nationalversammlung in Cöslin viel von ihm gesprochen. Einstimmig war die Anerkennung seiner ausgezeichneten Fähigkeiten und Kenntnisse wie seines ehrenhaften Charakters; allgemein in Beamtenkreisen das Bedauern, daß er durch seine radikale politische Richtung dem Staatsdienst voraussichtlich entzogen werden würde. Wirklich eines politischen Vergehens angeklagt, ging er 1850 nach England, wo er bis zur allgemeinen Amnestie des Jahres 1860 als Schriftsteller lebte. Seine Korrespondenzen für die Nationalzeitung, namentlich die Aufsehen erregenden Berichte über die ersten beiden Weltausstellungen (1851 in London, 1855 in Paris), erwiesen ungewöhnliches Talent, sich in fremden Regionen zurechtzufinden; seine Schrift über den Parlamentarismus in England aber zeigte einen vorurteilsfreien Geist, der mit dem damals in Deutschland landläufigen Glauben an die Notwendigkeit streng parlamentarischer Regierung gründlich gebrochen hatte.
Das alles trug ich dem Minister vor. Er hörte ruhig zu und rief dann lebhaft: „Bucher ist eine ganz ungewöhnliche Kraft. Ich würde mich freuen, wenn wir ihn gewinnen könnten. Im Abgeordnetenhause habe ich manchmal seinen hohen schmalen Schädel betrachtet und mir gesagt: der Mann gehört ja gar nicht in die Gesellschaft von Dickköpfen, bei denen er jetzt sitzt; der wird wohl einmal zu uns kommen. Seine literarische Thätigkeit habe ich mit Interesse verfolgt. Nun kann man allerdings nicht wissen, wie weit seine Entwickelung jetzt gediehen ist; aber ich halte nicht für gefährlich, ihn in unsre Karten sehen zu lassen. Wir kochen alle mit Wasser und das meiste, was geschieht oder geschehen soll, wird gedruckt. Gesetzt den Fall, er käme als fanatischer Demokrat zu uns, um sich wie ein Wurm in das Staatsgebäude einzubohren und das Ganze in die Luft zu sprengen, so würde er bald einsehen, daß nur er selbst bei dem Versuche zu Grunde gehen müßte. Bliebe die Möglichkeit. Daß Bucher kleine Geheimnisse um kleiner Vorteile willen verriete; solcher Gemeinheit aber halte ich ihn für unfähig. Sprechen Sie mit ihm, ohne nach seinem Glaubensbekenntnis zu fragen; mich interessiert nur, ob er kommen will oder nicht.“
Er kam gern, wurde vereidigt und in die politische Abteilung eingeführt.
Die Herren von Thile und Abeken waren keineswegs erbaut von der Wahl des neuen Kollegen und ich hatte einige Mühe, ihnen die Auffassung des Chefs verständlich zu machen. Nach und nach aber kam Bucher durch sein einfaches, bescheidenes Wesen und durch die unanfechtbare Beschaffenheit seiner Arbeiten in eine leidliche Stellung.
Nach einiger Zeit wurde dem Minister berichtet, daß Lassalle, der im letzten Sommer in einem Duell gefallen war, Bucher zum Exekutor seines Testaments ernannt hätte, daß daher die Beziehungen beider intime gewesen sein müßten und Bucher vermutlich Sozialdemokrat sei. Ich riet ihm, über sein früheres Verhältnis zu dem bekannten Agitator möglichst vollständige Aufklärung zu geben. Er händigte mir alle Briefe ein, die Lassalle ihm jemals geschrieben hatte. Es ging daraus hervor, daß Lassalle ihn gerngehabt und öfters zum Essen eingeladen hatte, daß aber dessen wiederholte Versuche, ihn zu seinen sozialistischen Ansichten zu bekehren, erfolglos geblieben waren. Der Minister, dem ich die Briefe vorlegte, sagte mir bei Rückgabe derselben, der Verkehr mit Lassalle habe ihm selbst so viel Vergnügen gemacht, daß er aus diesem Umgang Bucher keinen Vorwurf machen könne.
Schon 1863 sprach Bismarck gelegentlich davon, daß Lassalle ihn mehrere Mal besucht und sehr gut unterhalten hätte. Derselbe sei zwar ein Phantast und seine Weltanschauung eine Utopie, aber er spreche so geistvoll darüber, daß man ihm gern zuhöre. Er sei der beste aller jemals gehörten Redner. Sein Sport sei, vor einigen Tausend Arbeitern zu sprechen und sich an deren Beifall zu berauschen. Politisch willkommen wäre seine Gegnerschaft gegen die Fortschrittspartei; man könne deshalb seine Agitation eine Weile fortgehen lassen mit dem Vorbehalt, im geeigneten Moment einzugreifen.
Einige Wochen nach Ausbruch des dänischen Krieges gab mir der Minister ein Schreiben Lassalles, mit welchem dieser zwei Exemplare eines eben erschienenen Werkes eingeschickt hatte. Das kleine Buch war betitelt: „Herr Bastiat-Schulze von Delitzsch, der ökonomische Julian, oder Kapital und Arbeit.“ In dem Schreiben hieß es, „der Minister würde aus diesem Holze Kernbolzen schneiden können zu tödlichem Gebrauche, sowohl im Ministerrat wie den Fortschrittlern gegenüber … auch wäre es sehr nützlich, wenn der König einige Abschnitte des Buches läse, dann würde er erkennen, welches Königtum noch eine Zukunft hat, und klar ersehen, wo seine Freunde, wo seine wirklichen Feinde sind.“
Der Minister gab mir das sonderbare Schreiben und trug mir auf, da er sehr beschäftigt sei, mündlich oder schriftlich in seinem Namen den Empfang dankend zu bestätigen.
In jenen Jahren (1863‒1865) war die Zahl der Personen groß, die den Minister zu sprechen wünschten, um Rezepte zur Heilung des Verfassungskonfliktes anzubieten, und deren Gesuche er regelmäßig mir zuschickte mit dem Auftrage, die Leute zu hören. Dadurch war ich mit unfruchtbaren Geschäften stark belastet und hatte kein Verlangen, die persönliche Bekanntschaft des notorisch übermäßig eitlen Briefstellers zu machen. Wagener hörte gelegentlich von ihm die Worte: „Ich, Bismarck und Sie sind die drei klügsten Leute in Preußen.“25
Einige Tage später erwähnte der Minister lächelnd, Lassalle habe sich schriftlich beschwert, daß er für seine große auf das Buch verwendete Mühe nur durch ein trockenes Billet eines Rats belohnt worden sei; er verlange sachliches Eingehen auf sein Werk und müsse den Minister bald sprechen.
Diese Tonart fand keinen Anklang bei Bismarck. Meines Wissens hat er den geistreichen Redner nach dem Februar 1864 nicht mehr gesehen. Die Nachricht von Lassalles Tode, die wir Anfang September in Baden erhielten, schien auf ihn keinen Eindruck zu machen. Das Wohlwollen des Ministers hatte Lassalle durch Hervorkehren seines krankhaft überspannten Selbstgefühls verscherzt. Dieselbe Eigenschaft sollte seinen Tod herbeiführen; denn er konnte nicht ertragen, daß eine junge Dame, deren Anerbieten, mit ihm zu fliehen, er abgelehnt hatte, ihm ihre Neigung entzog, seine förmliche Bewerbung zurückwies und sich mit einem andern Manne verlobte. Diesem gab er Anlaß, ihn im Duell zu erschießen.
* * *
Nachfolger des Grafen Rechberg wurde General Graf Mensdorff-Pouilly, der ein Anhänger des preußischen Bündnisses zu sein glaubte, aber in den auswärtigen Geschäften wenig erfahren war und dadurch von vornherein in Abhängigkeit von den Räten des Ministeriums kam. Bismarck bezeichnete wiederholt als die eigentlichen Leiter der Wiener Politik die aus Rheinhessen gebürtigen Freiherren von Biegeleben, von Meysenbug und von Gagern. Unter diesen galt als der hervorragendste Biegeleben, ein gelehrter, schriftstellerisch begabter Mann, der von dem Berufe der alten Kaisermacht, Deutschland zu beherrschen, überzeugt war und daher im Sinne des Fürsten Schwarzenberg gegen Preußen zu wirken für seine Pflicht hielt. Seit 1852 bearbeitete er in dieser Richtung die deutschen Angelegenheiten und hatte sich der im November 1863 eingetretenen Wendung nur widerwillig gefügt. Seinem Drucke folgend, machte selbst Graf Rechberg in den letzten Monaten seiner Amtsführung den Mittelstaaten einige hier nicht einzeln zu erwähnende Konzessionen; nach dem Ministerwechsel aber wurde Biegelebens Einfluß völlig maßgebend. Alsbald versuchte man, eine gründliche Lösung der schleswig-holsteinschen Frage im Sinne der Mittelstaaten durch direkte Verhandlungen mit Preußen anzubahnen.
Am 12. November gingen drei lange und lehrhafte Depeschen nach Berlin ab. Darin wurde empfohlen, der König möge dieselbe Entsagung üben, zu welcher der Kaiser bereit wäre, nämlich seinen Anteil an der Souveränität über Schleswig-Holstein dem Erbprinzen von Augustenburg als dem bestberechtigten der Prätendenten cedieren. Nur die Einsetzung desselben als eines selbständigen, mit allen Hoheitsrechten bekleideten Bundesfürsten würde den Frieden in Deutschland herstellen.
Uebrigens war Graf Karolyi ermächtigt, bei Uebergabe dieser Depeschen mündlich mitzuteilen, daß man bei geeigneter Entschädigung durch deutsches Gebiet auch in die preußische Annexion von Schleswig-Holstein willigen würde.
Bismarck hatte einige Wochen früher angeregt, daß die Bundestruppen Holstein verlassen müßten, und beschloß, jene Depeschen nicht vor Erledigung dieser Forderung zu beantworten.
Die Bundesexekution war 1863 beschlossen worden gegen König Christian IX. als Landesherrn von Holstein zum Schutze der dortigen Deutschen gegen dänische Uebergriffe; sie hatte offenbar keinen Zweck mehr, nachdem zwei deutsche Fürsten Landesherren geworden waren. Wir erwarteten daher Oesterreichs Zustimmung zu unserm Wunsche, die Bundestruppen das Land räumen zu sehen.
Graf Rechberg aber antwortete im Oktober, daß allerdings eine Berechtigung des Bundes, die Exekution fortbestehen zu lassen, nicht existiere, empfehlenswert jedoch scheine, „in bundesfreundlicher Gesinnung“ etwa 2000 Mann Bundestruppen in Holstein zu belassen.
Der Grund dieses überraschenden Vorschlages konnte nur in dem Bestreben gesucht werden, die Einsetzung des Erbprinzen zu erleichtern, dessen Interessen durch die Anwesenheit der Bundestruppen fortwährend gefördert worden waren.
Bismarck setzte nun in einem ausführlichen Erlaß, welcher sich mit den erwähnten Wiener Depeschen vom 12. November kreuzte, auseinander, daß dieser Vorschlag durch das Bundesrecht in keiner Weise motiviert werden könne, daß es daher angezeigt sei, Sachsen und Hannover zur Zurückziehung ihrer Truppen aus Holstein einzuladen.
Auch dieser wiederholte Antrag wurde in Wien abgelehnt, was nicht gerade politische Voraussicht bekundete.
Der König war sofort entschlossen, sein Hausrecht in Holstein unter allen Umständen zu wahren. Der Rückmarsch unserer Regimenter aus Holstein wurde sistiert und durch Zusammenziehung einiger Truppenkörper an den Grenzen von Hannover und Sachsen der Ernst der Lage angedeutet.
Unsere Gesandten an den dortigen Höfen wurden angewiesen, zur Rückberufung der Exekutionstruppen einzuladen. In Hannover war man dazu bereit, vorbehaltlich der Zustimmung Oesterreichs; in Dresden aber erklärte der thatendurstige Minister Freiherr von Beust, die sächsischen Truppen würden bis zur Einsetzung des rechtmäßigen Landesherrn in Holstein verbleiben, außer wenn ein Bundesbeschluß ihre Zurückziehung anordnete. Die beurlaubten Mannschaften des sächsischen Heeres wurden zur Fahne einberufen.
Inzwischen war man in Wien zu der Einsicht gelangt, daß einzulenken geraten sei. Graf Mensdorff erklärte sich bereit, bei Mitteilung des dänischen Friedensvertrages an den Bund einen Antrag auf Zurückberufung der Bundestruppen aus Holstein mit Preußen gemeinschaftlich zu stellen. Bismarck genehmigte diese Form, da in der Sache das Richtige geschehen sollte. Unser Gesandter in Frankfurt, Herr von Savigny, erhielt einen bezüglichen Auftrag und zugleich die vertrauliche Mitteilung, daß Preußen drei Tage auf den beantragten Bundesbeschluß warten, aber, wenn er verspäte, Selbsthilfe eintreten lassen werde; eine interessante Neuigkeit, die der Gesandte einigen seiner Kollegen nicht vorenthalten zu sollen glaubte. Der beantragte Beschluß kam rechtzeitig zustande, aber nur mit 9 gegen 6 Stimmen.
Bismarck nahm aus dieser Thatsache Veranlassung, den dissentierenden mittel- und süddeutschen Regierungen eine Verwarnung zugehen zu lassen. In einem zur Mitteilung bestimmten Rundschreiben (vom 13. Dezember) an unsere Gesandten legte er dar, daß die bei dieser Abstimmung hervorgetretene Tendenz, Holstein bis zur Einsetzung eines Herzogs teilweise besetzt zu halten, durch das bestehende Bundesrecht nicht zu begründen sei. Der letzte Bundesbeschluß würde, wenn nur 2 Stimmen der Majorität zur Minorität übergingen, für das Bestehen des Bundes selbst gefährlich gewesen sein; derartige für Preußen unannehmbare Ueberschreitungen der streng begrenzten Kompetenz des Bundes könnten in Zukunft zu dessen Auflösung führen.
Der in dieser Weise angedrohte Fall sollte am 14. Juni 1866 thatsächlich eintreten.
Nachdem gegen Oesterreichs Wunsch die Entfernung der Bundestruppen aus Holstein durchgesetzt worden war, nahm Bismarck die Korrespondenz mit Wien über die Zukunft der Herzogtümer wieder auf. Vorher schon hatte Baron Werther dem Grafen Mensdorff gegenüber vertraulich zur Sprache gebracht, daß der Ton seiner letzten Depeschen ein unter befreundeten Mächten ungewöhnlicher gewesen sei. Der Minister erwiderte, Se. Majestät der Kaiser habe schon gelegentlich ein Bedauern darüber ausgesprochen, daß Biegeleben mitunter eine so scharfe Feder führe. Ob er selbst, der Minister, in der Lage gewesen wäre, den scharfen Ton zu mildern, schien ihm nicht in den Sinn zu kommen.
Genau umgekehrt war die Geschäftsbehandlung in Berlin. Hier beherrschten die überlegene Einsicht und der starke Wille des Chefs Inhalt und Form der ausgehenden amtlichen Schriftstücke bis in alle Einzelheiten. Die Korrespondenz mit unseren Agenten bei den Großmächten hatte Abeken zu bearbeiten. Der Minister eröffnete ihm mündlich für jede Depesche den Gedankengang. Abeken verfügte über eine durch reiche Bildung entwickelte, fast dichterische Produktionsfähigkeit und war ein vielgewandter Sprachkünstler. Zu ebener Erde in einem schmalen Kämmerchen, welches den Durchgang zwischen dem Empfangszimmer des Unterstaatssekretärs und andern Arbeitsräumen bildete, und während lauter Gespräche, welche jeden andern gestört haben würden, zauberte Abeken mit fliegender Feder Entwürfe auf das Papier, welche die vom Minister angegebenen Gedanken in vielseitiger Ausführung darstellten. Nach wenigen halben oder ganzen Stunden trug dann der Kanzleidiener die Mappe mit den fertigen Schriftstücken die Treppe hinauf in das Arbeitszimmer des Ministers. Dieser pflegte abends die im Laufe des Tages vorgelegten Entwürfe so gründlich durchzuarbeiten, daß jede Redewendung den Stempel seines Geistes erhielt. In den an diplomatischen Korrespondenzen überreichen Jahren 1862 bis 1870 wurden fast allen bedeutenderen Schriftstücken Abekens Entwürfe zu Grunde gelegt, die Bismarck besonders gern bearbeitete, weil sie nicht nur seine Gedanken treu widerspiegelten, sondern ihm auch mitunter neue Anregungen brachten.
Die oben erwähnten drei Wiener Depeschen vom 12. November wurden am 13. Dezember ausführlich beantwortet26. Bismarck erklärte, „nicht zu verstehen“, weshalb Oesterreich von seiner früheren Auffassung, die Mittelstaaten als gemeinsame Gegner zu betrachten, zurückgekommen sei. Die Führer derselben am Bundestage hätten versucht, außerhalb ihrer Befugnisse 1863 in die europäische Politik einzugreifen, die beiden Großmächte zum Bruch des Londoner Vertrages zu drängen, die schwebende Erbfolgefrage ohne einen Schatten von Kompetenz zu lösen und die verfälschte Exekution in Holstein als Okkupation widerrechtlich fortdauern zu lassen. Preußen könne und werde seine Politik nicht von Beschlüssen kleinstaatlicher und von kleinstaatlichen Landtagen abhängiger Regierungen bestimmen lassen und lege Wert darauf, schon jetzt zu erklären, daß etwaigen rechtswidrigen Beschlüssen des Bundes gewaltsamer Widerstand entgegentreten würde. In Bezug auf Schleswig-Holstein wolle man keinen der Prätendenten ausschließen; doch würde Augustenburg uns Oldenburg, Hannover und Rußland entfremden. Jedenfalls sei gründliche Prüfung aller Erbansprüche, auch der jetzt anzumeldenden brandenburgischen, erforderlich. Daß Preußen die Annexion der Herzogtümer nicht ohne die Zustimmung Oesterreichs ausführen könne, werde wiederholt anerkannt. Die Einsetzung eines Herzogs aber könne nur genehmigt werden unter gewissen, im Sicherheitsinteresse Deutschlands notwendigen Bedingungen, mit deren Formulierung zurzeit die Fachminister beschäftigt seien.
Die österreichische Regierung erklärte sich hierauf unter dem 21. Dezember bereit, die Frage durch Verständigung mit Preußen abzuschließen, betonte aber wiederholt die Zuständigkeit des Deutschen Bundes, darüber zu wachen, daß in den Verein der Souveräne Deutschlands kein unselbständiges Mitglied eingeführt werde27.
In Wien wünschte man die leidige schleswig-holsteinische Sache möglichst schnell aus der Welt zu schaffen. Wiederholte Mahnungen zu schleuniger Kundgebung unseres Programms lehnte jedoch Bismarck als unberechtigt ab, da Ueberstürzung nur Schaden bringen könne.
Von der französischen Regierung wurde die wachsende Spannung zwischen den beiden Verbündeten aufmerksam beobachtet. In Paris wie in Berlin fehlte es nicht an vertraulichen Mitteilungen darüber, daß der Kaiser Napoleon unsere Schritte mit besonderem Wohlwollen würdigte. Im Februar 1865 lehnte jedoch Bismarck bestimmt ab, auf die von unserm Botschafter in Frage gestellten Verhandlungen zur Vorbereitung eines französischen Bündnisses einzugehen. Er betonte, es würde auch schon eine vorläufige Besprechung darüber, solange das Bündnis mit Oesterreich vom 16. Januar 1864 bestehe, dem Vorwurfe der Perfidie ausgesetzt sein und überall in Deutschland gemißbilligt werden; auch an sich sei zu empfehlen, in den obwaltenden unsichern Verhältnissen sich nach keiner Seite hin zu binden.
In diesen Tagen (am 20. Februar) äußerte er bei Tische in meiner Gegenwart: „Wenn es einmal Sturm gibt, wird sich zeigen, daß wir auf hohen Wellen besser schwimmen können als andere Leute.“
Inzwischen hatten die Fachminister die Bedingungen formuliert, unter welchen unsererseits die Einsetzung eines Herzogs in Schleswig-Holstein zugegeben werden könnte. Man ging davon aus, daß unsere militärische Lage nach dem dänischen Kriege nicht schlechter werden dürfe, als sie vorher gewesen war. Während früher ein Angriff des befreundeten Dänemark auf Deutschlands Nordwestgrenze ausgeschlossen schien, mußte jetzt als wahrscheinlich gelten, daß in der nächsten europäischen Krise das Königreich versuchen würde, die Herzogtümer zurückzuerobern, und daß diese aus eigener Kraft so wenig wie 1850 erfolgreichen Widerstand leisten könnten. Vor allem schien daher notwendig: Verschmelzung der Wehrkraft des Landes mit der preußischen Land- und Seemacht. Die Forderungen der Aushebung der Rekruten durch preußische Beamte und der Leistung des Fahneneides für unsern König gehörten nach meinem Eindruck zu den Formen, die man im Laufe der Verhandlungen wahrscheinlich fallen gelassen hätte; in der Sache aber nachzugeben, war durch die Sorge für Verteidigung der Nordwestgrenze ausgeschlossen. Außerdem wurden verlangt: der Kieler Hafen, die Festungen Rendsburg und Sonderburg-Düppel, Befugnis zum Bau eines Nord-Ostsee-Kanals, Anschluß an das preußische Zollsystem, Verfügung über Post und Telegraphie.
Diese am 22. Februar 1865 nach Wien mitgeteilten, unter dem Namen der „Februarbedingungen“ bald bekannt gewordenen Forderungen bezeichnete Bismarck als „Konzessionen“ gegenüber dem natürlichen Verlangen der Einverleibung des Landes, welches bei uns in immer weiteren Kreisen laut geworden sei.
In Wien aber erklärte man, daß die geforderte Abtretung der Militärhoheit eine geeignete Grundlage zur Verständigung nicht darbiete und daher diese Phase der Verhandlungen für abgeschlossen gehalten werde. Die Antwort erfolgte mündlich schon am 27. Februar; an demselben Tage erging an Moltke die Aufforderung zu genauen Angaben darüber, welche Truppenmacht Oesterreich uns in Böhmen gegenüberzustellen vermöchte.
Inzwischen hatte der bayerische Ministerpräsident Freiherr von der Pfordten einen Antrag für den Bundestag in Wien zur Prüfung vorgelegt, wonach der Bund die „vertrauungsvolle Erwartung“ aussprechen sollte, die beiden Großmächte würden „nunmehr“ den Erbprinzen von Augustenburg als Herzog einsetzen. Graf Mensdorff machte von dieser seit dem Januar schwebenden Angelegenheit die erste Mitteilung nach Berlin am 19. März mit dem Hinzufügen, er wünsche, daß dieser Antrag nicht in einem Ausschuß begraben, sondern binnen 8 Tagen zur Abstimmung gebracht werde. In dem Aussprechen einer von der preußischen abweichenden Ansicht am Bundestage ohne irgendwelche thatsächliche Vorkehrungen würde eine Verletzung des Allianzvertrages vom 16. Januar 1864 nicht zu finden sein.
In Berlin aber meinte man, daß die wochenlangen geheimen Verhandlungen mit den gegnerischen Mittelstaaten und die angekündigte Zustimmung zu deren Antrage am Bunde mit den jedem der beiden Verbündeten vertragsmäßig obliegenden Pflichten nicht vereinbar schiene. Bismarck sagte dem Grafen Karolyi mündlich:
„Wir sind leider an einen Scheideweg gelangt. Unsre Fahrbillets lauten auf divergierende Linien; und ich wünsche nur, daß wir nicht zu weit auseinanderkommen.“
Dieser unfreundliche Schachzug des Verbündeten sollte nicht nur mit Worten in Frankfurt bekämpft werden, sondern eine That sollte aller Welt zu erkennen geben, daß wir uns aus Holstein verdrängen zu lassen nicht gesonnen seien. Der König befahl am 24. März die Verlegung der Marinestation von Danzig nach Kiel.
* * *
Die Zustände in den Herzogtümern hatten auch nach dem Abzuge der Bundestruppen und nach der Ersetzung der Bundeskommissare durch Vertreter Preußens und Oesterreichs (Zedlitz und Halbhuber) sich in entschieden partikularistischer Richtung fortentwickelt. Der Erbprinz behielt seinen Aufenthalt in einem Vororte Kiels, umgeben von den als seine Minister geltenden Vertrauenspersonen. Diese hatten Anfang 1864 dafür gesorgt, daß zu Mitgliedern der sogenannten Landesregierung fast nur augustenburgisch gesinnte Beamte ernannt wurden, und vermochten auch zu erreichen, daß die bei Uebernahme der Verwaltung von Schleswig erforderliche Verstärkung dieser Behörde in gleichartiger Weise erfolgte. In der Bevölkerung wurde mündlich die Mahnung verbreitet, gegen Verfügungen der Landesregierung niemals Beschwerde zu erheben, damit die Kommissare der Großmächte keine Gelegenheit erhielten, einzugreifen. Ein Netz von Vereinen, welche den Erbprinzen als Landesherren anerkannten, hatte das Land überzogen und die Presse nannte ihn täglich Herzog Friedrich VIII. Dagegen einzuschreiten, war Zedlitz machtlos, weil Baron Halbhuber seinen Instruktionen gemäß jedem bezüglichen Versuche entgegentrat. General Herwarth hatte zwar den Oberbefehl über 16.000 Preußen und die österreichische Brigade Kalik (4800 Mann), war aber nicht imstande, Demonstrationen für den Erbprinzen zu verhindern, weil Graf Mensdorff Eingriffe der bewaffneten Macht in die Civilverwaltung nicht wünschte.
Die ehrenfeste Bevölkerung fühlte sich gefesselt an den Fürsten, dem sie vor Jahr und Tag als der Verkörperung des Gedankens „Los von Dänemark“ gehuldigt hatte. Diese Gesinnung wurde durch starke Gründe unterstützt in den Städten, welche fast steuerfrei waren und den Druck einer Militärlast, bei der Leichtigkeit Stellvertreter zu mieten, kaum kennengelernt hatten. Den Städtern graute vor dem preußischen Steuersystem und der allgemeinen Wehrpflicht. Das platte Land hatte von der Annexion in materieller Beziehung wenig zu befürchten; der Großgrundbesitz aber wünschte sie, denn er war mit hohen Grundsteuern eingeschätzt und mußte, wenn dem Lande die Uebernahme der Kriegskosten und anderer Schulden mit rund 80 Millionen Thalern zugemutet würde, auf Heranziehung zu fast unerschwinglichen Leistungen gefaßt sein. Baron Scheel-Plessen konnte daher seine Standesgenossen leicht, außer ihnen aber kaum 200 Personen für eine Adresse zu Gunsten der Annexion gewinnen, während für Adressen zu Gunsten Augustenburgs rund 50.000 Unterschriften zusammengebracht wurden.
Trotz dieser durch Oesterreichs Haltung genährten feindseligen Stimmungen in den Herzogtümern wurde Bismarck nicht einen Augenblick schwankend in dem Vorsatze, zu erringen, was er dort für unsre Sicherheit notwendig hielt, sei es durch Erfüllung der Februarbedingungen, „wenn die Leute sich durchaus einen Herzog für 80 Millionen Thaler kaufen wollten“, oder durch die Annexion.
Die Bearbeitung der schleswig-holsteinischen Verwaltungssachen war mir übertragen. Es wäre auf diesem Arbeitsfelde in Berlin wenig zu thun gewesen, wenn nicht vier landeskundige Personen sich als Agenten zur Verfügung gestellt und fortlaufend an mich berichtet hätten. Gleich nach der Einnahme von Düppel kam zu mir der in Schleswig wohnende Graf Adalbert Baudissin, ein Mann von sehr einnehmendem Wesen. Er bekannte die Ueberzeugung, daß sein Vaterland des engsten Anschlusses an Preußen bedürfe, und erbot sich, dafür zu wirken. Der Minister hat ihn nur einmal gesehen und mir den weiteren mündlichen und schriftlichen Verkehr mit ihm überlassen. Nach einiger Zeit erhielt er von Zedlitz eine Anstellung beim Deichbau auf den Nordseeinseln, welche ihm erlaubte, öfters umherzureisen und in politischer Berichterstattung fortzufahren.
Sodann meldete sich ein junger Balte, Baron Ungern-Sternberg, welcher sich in Flensburg niedergelassen hatte, um in gleichem Sinn zu wirken. Seine Berichte enthielten brauchbare sachliche Mitteilungen. Anscheinend war seinen Anregungen zu danken, daß in Flensburg Ende Februar 1865 etwa zwanzig unabhängige Männer sich als „Nationalpartei“ konstituierten, mit dem Programm des engsten Anschlusses an Preußen. Diese kleine Partei verfügte über drei Lokalblätter, doch waren die Zeitumstände für ihre Ausbreitung nicht günstig.
Zwei andere Männer mit unbekannten Namen lieferten mehr mündliche als schriftliche Berichte. Dem Minister waren alle solche Quellen vielseitiger, wenn auch mit Vorsicht aufzunehmender Nachrichten willkommen und mein Verkehr mit jenen freiwilligen Staatsdienern wurde daher ein ziemlich reger.
* * *
Am 16. November 1864 reiste Bismarck nach Stettin, um seine aus Reinfeld ankommende Gemahlin nach Berlin zu begleiten. Sie hatte eine schwere Krankheit überstanden und durfte in den beiden folgenden Monaten noch nicht abends ausgehen, sah aber in ihrem Empfangssaal gern die Hausfreunde. Außer den bereits genannten erschienen jetzt häufig: Postrat von Obernitz, ein feinsinniger Literaturkenner, und Gustav von Loeper, der schon einmal erwähnte Goethe-Herausgeber, dessen gelegentliche literarische Mitteilungen der sehr belesenen Hausfrau stets willkommen waren. Der Minister aber ließ sich mitunter gern von seinen Studien über den Faust erzählen.
Der schon erwähnte Herr von Dewitz-Milzow kam einige Mal in Begleitung seiner beiden anmutigen Töchter. Nicht selten wurden auch zufällig anwesende befreundete Familien aus Pommern, Ostpreußen, Kurland oder Schlesien für einen Abend eingeladen, was jedoch weder die äußeren Einrichtungen noch den Ton des Gesellschaftssaales im Mindesten zu beeinflussen pflegte.
Der Minister schien weniger von Geschäften überlastet als in dem Winter des dänischen Krieges, in welchem er nur zweimal an Hofjagden teilgenommen hatte. Jetzt konnte er nicht weniger als dreizehn Tage der Jagd widmen, meistens im Gefolge des Königs. Diners außer dem Hause suchte er möglichst zu vermeiden, abends aber ging er nicht selten auf eine Stunde in Gesellschaft. Als ich Anfang Januar in dem nahe dem Auswärtigen Amt gelegenen Hotel Royal für zufällig anwesende Verwandte und den Freundeskreis des Hauses Bismarck einen kleinen Ball gab, erschien zu aller Ueberraschung um Mitternacht der Minister. Am 1. Februar besuchte er mit Gemahlin und Tochter einen Hofball im „weißen Saale“.
Zwischen solchen Wochen, in denen er rüstige Vollkraft zu besitzen schien, gab es auch Tage, an denen er sich recht unwohl fühlte und über Schmerzen im Gehirn, im Gesicht oder im linken Bein klagte. Wegen seiner Gesundheit war ich nie ohne Sorge. An meinen Bruder schrieb ich im Februar: „Wenn Bismarck nur noch zwei Jahre lebt, bekommen wir hoffentlich Schleswig-Holstein.“ Daß Bismarck schlechthin unersetzlich war, daß niemand außer ihm in den dunkeln Labyrinthen der damaligen auswärtigen und innern Politik die gangbaren Pfade zu finden vermocht hätte, davon waren alle überzeugt, die ihm näherstanden.
Zu diesen Personen gehörte schon damals Herr Gerson Bleichröder, Chef des Bankhauses S. Bleichröder, ein Mann von ungewöhnlichen Fähigkeiten. Sein Verstand war so lebendig wie durchdringend, sein Gedächtnis zuverlässig, sein Herz fest und treu. Das bei ihm deponierte Kapitalvermögen des Ministers gab ihm fast nichts zu thun, weil Spekulationen irgendwelcher Art mit dessen Werten verboten waren; aber seine Stellung zu dem Pariser Hause Rothschild führte ihm mitunter einen politischen Auftrag zu. Die Frankfurter Familie Rothschild ist bekanntlich in Wien, Paris und London verzweigt; ihr Vertreter in Berlin aber war Bleichröder. Nun hatte der damalige Chef des Pariser Hauses, Baron James Rothschild, jederzeit freien Zutritt zum Kaiser Napoleon, der ihm nicht nur über Finanzfragen, sondern auch über Politik ein freies Wort zu gestatten pflegte. Dies bot die Möglichkeit, durch Bleichröder und Rothschild an den Kaiser Mitteilungen gelangen zu lassen, für welche der amtliche Weg nicht geeignet schien. In jenen Jahren hielt Bismarck für geboten, die Beziehungen zu dem mächtigen Monarchen mit allen verfügbaren Mitteln sorgfältig zu pflegen, und legte daher Wert darauf, auch diesen Weg vertraulicher Mitteilungen mitunter benutzen zu können. Durch mich sind derartige Aufträge nie vermittelt worden; doch erhielt ich die Anweisung, Herrn Bleichröder über die Lage der auswärtigen Politik, soweit sie nicht geheim zu halten war, auf Befragen fortlaufend zu unterrichten, damit er Eröffnungen der bezeichneten Art, die der Minister sich selbst vorbehielt, schnell und richtig auffassen könnte. Herr Bleichröder pflegte daher mehrmals in der Woche am frühen Morgen zu mir zu kommen und einige Minuten zu verweilen, an warmen Tagen im Garten, sonst in meinem Wohnzimmer. Ich lernte ihn auf diese Weise genau kennen und aufrichtig schätzen.
Die gelegentlichen Aufträge des Ministers an Bleichröder hatten zur Folge, daß dieser sich als Hilfsarbeiter des Auswärtigen Amtes fühlte und demnach, wenn er von Bismarck sprach, ihn „unsern hochverehrten Chef“ zu nennen pflegte. Weiteren Kreisen durfte der politische Grund seiner öfteren Besuche im Auswärtigen Amte natürlich nicht bekannt werden. Es erhob sich daher manchmal das Gerücht, daß Bismarck durch Bleichröder für sich Börsengeschäfte machen ließe, was thatsächlich niemals geschehen ist. Er hat oft genug ausgesprochen, es sei völlig unerlaubt, seine Kenntnis der politischen Lage zu Spekulationen zu benutzen; ein Minister, der sich damit befasse, müsse in Versuchung kommen, seine politischen Entschlüsse durch Rücksichten auf persönliche Vorteile oder Nachteile beeinflussen zu lassen, und könne daher keine gute Politik machen.
* * *
Als im Frühjahr 1865 die Möglichkeit eines Waffenganges gegen Oesterreich ins Auge gefaßt werden mußte, hielt Bismarck für dringend wünschenswert, mit dem Landtage Frieden zu schließen auf der Grundlage einer Konzession im Militäretat. Roon war mit ihm darüber einig, daß bei der Infanterie das dritte Dienstjahr ohne erhebliche Nachteile entbehrt werden könnte, we n n bei jedem Bataillon ein starker Stamm von altgedienten Leuten, sogenannten Kapitulanten, geschaffen würde. Diese wären natürlich höher zu besolden; und um die dazu nötigen Mittel zu gewinnen, müßte man zu dem System der Stellvertretungsgelder nach dem Muster der damals in Frankreich bestehenden Einrichtungen übergehen. Dort pflegten die Wohlhabenden sich vom persönlichen Dienst loszukaufen. So wenig dieses Beispiel anmutete, so trat doch das ganze Staatsministerium diesen Vorschlägen bei, welche dann von Bismarck und Roon an maßgebender Stelle vorgetragen wurden.
Der König wollte zwar eine Ausgleichung des Verlustes des dritten Dienstjahres durch bedeutende Vermehrung der Kapitulanten als möglich, wenn auch ungewiß gelten lassen, entschied aber, daß Einführung der Stellvertretungsgelder mit dem Grundsatze der allgemeinen Wehrpflicht unvereinbar sei.
Eine andere Finanzquelle stand nicht zu Gebote; der beabsichtigte Aussöhnungsversuch mußte daher aufgegeben werden.
Diesen Vorgang, von dem ich im Jahre 1865 nichts erfuhr, hat mir vier Jahre später der Minister des Innern, Graf Eulenburg, auf einem Spaziergange in Varzin ausführlich erzählt. Er knüpfte daran die Bemerkung, daß die vom Könige gegen die Wünsche des Ministeriums getroffene Entscheidung für das Land segensreich gewesen sei. Im Jahre 1866 habe man den unschätzbaren praktischen Wert der allgemeinen Dienstpflicht erkannt; nicht nur im Felde, wo die höher gebildeten Gemeinen durch ihre Begeisterung die mitunter stumpfen Kameraden fortrissen, sondern auch in der Heimat. Der Kleinbauer, der einen Sohn verlor, habe einen gewissen Trost empfunden, wenn sein reich begüterter Nachbar von gleichem Unglück betroffen wurde.
Im Mai 1865 erhielt Bismarck von unserem früheren Gesandten in Konstantinopel, General von Wildenbruch, dem Vater des Dichters, einen vertraulichen Brief, welcher genau dieselben Vorschläge zur Verständigung mit dem Landtage enthielt. Er gab mir das Blatt mit den Worten: „Ich habe von Wildenbruch bisher nur wenig gewußt; jetzt sehe ich, daß er ein grundgescheiter Mann ist.“
Obwohl die erwähnte Erzählung Eulenburgs für mich keiner Beglaubigung bedarf, so gewährt es mir doch eine gewisse Befriedigung, von Bismarck selbst diese indirekte Bestätigung derselben erhalten zu haben28.
Der Versuch Bismarcks, eine Grundlage zur Verständigung mit dem Abgeordnetenhause zu finden, mißlang also; die Kluft erweiterte sich immer mehr, der Ton der Volksvertreter gegen die Minister, namentlich gegen den Kriegsminister, wurde immer feindlicher. Das verbitterte Haus ließ sich weder durch die glänzenden Thaten des Heeres noch durch die Befreiung der Elbherzogtümer vom dänischen Joch zu irgendeinem thatsächlichen Entgegenkommen bewegen. Der Militäretat wurde wieder um die Kosten der neuen Regimenter gekürzt, der ganze Etat wieder vom Herrenhause verworfen. Die ausführlich motivierten Forderungen für Erweiterung der Marine wie für Deckung der Kosten des dänischen Krieges wurden rund abgelehnt.
Bei den Verhandlungen über Vorlagen wegen der Marine und der Kriegskosten hielt Bismarck merkwürdige Reden, aus welchen ich hier einige Auszüge gebe.
Am 1. Juni führte er aus, die in den letzten zwanzig Jahren oft und lebhaft hervorgetretenen Sympathien für die Marine würden jetzt verleugnet; der maritime Ehrgeiz der preußischen liberalen Partei schiene einigermaßen reduziert zu sein. Man wolle so lange, bis es nicht gelungen wäre, andere deutsche Staaten in Mitleidenschaft zu ziehen, nicht nur deren Handel, sondern auch den preußischen Handel in der verhältnismäßigen Schutzlosigkeit belassen, in der er sich jetzt befinde. Der Heranziehung anderer Staaten zu schweren Lasten stehe aber entgegen, daß im Allgemeinen in Deutschland partikulare Interessen stärker sind als der Gemeinsinn. Die Existenz auf der Basis der Phäaken sei bequemer als auf der Basis der Spartaner. Man lasse sich gern schützen, aber man zahle nicht gern und am allerwenigsten gäbe man das geringfügigste Hoheitsrecht zum Besten der allgemeinen Interessen auf. Er (der Minister) sei nicht darauf gefaßt gewesen, in dem Kommissionsberichte eine indirekte Apologie Hannibal Fischers zu finden, der die deutsche Flotte unter den Hammer brachte. Auch jene deutsche Flotte sei daran gescheitert, daß in den deutschen Gebieten, ebenso in den höheren regierenden Kreisen wie in den niederen, die Parteileidenschaft mächtiger war wie der Gemeinsinn.
Dann fuhr er fort:
„Sie zweifeln, ob es mir gelingen wird, Kiel zu erwerben.
„Wir besitzen in den Herzogtümern mehr als Kiel; wir besitzen die volle Souveränetät in den Herzogtümern in Gemeinschaft mit Oesterreich … Unser Besitz ist ein gemeinsamer – das ist wahr – mit Oesterreich. Nichtsdestoweniger ist er ein Besitz, für dessen Aufgebung wir berechtigt sein würden, unsere Bedingungen zu stellen. Eine dieser Bedingungen, und zwar eine der ganz unerläßlichen … ist das künftige alleinige Eigentum des Kieler Hafens für Preußen …
„Wir fordern nichts als die Möglichkeit, Deutschland zur See wehrhaft zu machen in dem Umfange, in dem uns dies mit den Mitteln der Herzogtümer erlaubt sein wird, und gegen die Wahrscheinlichkeit, Düppel in nicht gar zu langer Zeit noch einmal belagern und stürmen zu müssen, diejenige Garantie zu gewinnen, die die Hilfsquellen der Herzogtümer geben können …
„Zweifeln Sie dennoch an der Möglichkeit, unsere Absichten zu verwirklichen, so habe ich schon in der Kommission ein Auskunftsmittel empfohlen: Limitieren Sie die Anleihe dahin, daß die erforderlichen Beträge nur dann zahlbar sind, wenn wir wirklich Kiel besitzen, und sagen Sie: kein Kiel, kein Geld … Die Fälle, wo Sie glauben, diplomatische Erfolge gewonnen zu haben, und auf welche Sie sich an einer anderen Stelle des Berichtes berufen, passen nicht.
„Sie schreiben es der liberalen Strömung, dem Einfluß dieses Hauses zu, daß der Zollverein rechtzeitig wiederhergestellt sei. Ich erinnere Sie an die Thatsache, daß der erste Staat, der aus der Koalition unserer Gegner ausschied, der die Bresche legte, vermöge deren die Stellung der übrigen unhaltbar wurde, der beide Landesteile Preußens verbindet, so daß er eine Barriere zwischen den Nordseestaaten und den Binnenstaaten schafft, daß dies Kurhessen war. Nun glaube ich wohl, meine Herren, daß Sie einen großen Einfluß auf manche Regierungen Deutschlands ausüben mögen, aber auf Kurhessen nicht.
„Ich komme dabei zurück darauf, daß der Herr Vorredner29 uns empfahl, wir hätten die Zollvereinskrisis stärker ausnützen sollen, um politische Vorteile zu Gunsten einer bundesstaatlichen Vereinigung daraus zu gewinnen, wenn auch nur die Anfänge davon. Ich habe dieselbe Idee gehabt bei der vorigen Zollvereinskrisis vor zwölf Jahren. Ich war damals noch neu in den Geschäften. Wenn man längere Zeit darin gewesen ist, dann überzeugt man sich, daß das Bedürfnis der Rekonstituierung des Zollvereins nicht stark genug ist, um dafür eine Souveränitätsverminderung den Fürsten annehmbar zu machen …
„Ein anderer politischer Erfolg dieses Hauses, den der Kommissionsbericht demselben zuspricht, hat mich noch mehr überrascht. Sie sind der Meinung, ‚auch in der schleswigschen Frage habe die Regierung, was sie erreicht, nur der Richtung des öffentlichen Geistes und der Zustimmung des Landtages für die Loslösung der Herzogtümer zu danken‘. Ich konstatiere, daß Sie uns damit die Tendenz, die Herzogtümer loszulösen, zuerkennen; von Ihrer Zustimmung zu etwas, was die Regierung gethan hätte, ist mir nichts erinnerlich. Haben Sie mit der Verweigerung der Anleihe, die wir damals von Ihnen verlangten, Düppel erobert und Alsen? Dann, meine Herren, habe ich auch die Hoffnung, daß aus Ihrer Verweigerung der jetzigen Anleihe auch eine preußische Flotte hervorgehen werde …
„Das, was früher Ihr Ideal war, ist jetzt für die preußische Regierung das Minimum des Erreichbaren. Wir können das, was Sie vor 1 ½ Jahren als Höchstes erstrebten, in jeder Viertelstunde ins Werk setzen: einen unabhängigen schleswig-holsteinschen Staat, sogar mit einigen mäßigen, uns aber nicht genügenden Vorteilen für Preußen – es bedarf nur einer in einer Viertelstunde aufzusetzenden Erklärung der königlichen Regierung, und der Staat wäre geschaffen.“ …
Nach einer Darlegung der Verfassungsänderungen, welche erforderlich sein würden, um die Ansprüche des Hauses zu befriedigen, sagte der Minister:
„Sie versuchen, diese Aenderungen dadurch zu erzwingen, daß Sie zu Zwecken, deren Nützlichkeit Sie an und für sich nicht bestreiten können, Ihre Mitwirkung versagen, die Staatsmaschine, so viel an Ihnen liegt, zum Stillstand bringen, ja in Sachen der auswärtigen Politik – ich kann nicht umhin, es zu sagen – das Gemeinwesen schädigen, soweit Sie es innerhalb Ihrer Befugnisse vermögen, durch Verweigerung Ihrer Mitwirkung.
„Das alles, um eine Pression auf die Krone auszuüben, daß sie ihre Minister entlasse, daß sie Ihre Auffassung des Budgetrechts annehme. Meine Herren, Sie kommen dadurch genau in die Lage der falschen Mutter im Urteil Salomonis, die lieber will, daß das Kind zu Grunde gehe, als daß damit anders als nach ihrem Willen geschehe …
„Ich kann nicht leugnen, daß es mir einen peinlichen Eindruck macht, wenn ich sehe, daß angesichts einer großen nationalen Frage, die seit zwanzig Jahren die öffentliche Meinung beschäftigt hat, diejenige Versammlung, die in Europa für die Konzentration der Intelligenz und des Patriotismus in Preußen gilt, zu keiner anderen Haltung als zu der einer impotenten Negation sich erheben kann.
„Es ist dies, meine Herren, nicht die Waffe, mit der Sie dem Königtum das Scepter aus der Hand winden werden. Es ist auch nicht das Mittel, durch das es Ihnen gelingen wird, unseren konstitutionellen Einrichtungen diejenige Festigkeit und weitere Ausbildung zu geben, deren sie bedürfen.“
Am folgenden Tage sagte Virchow als Berichterstatter, daß, wenn es dem Ministerpräsidenten gelungen sei, durch eine große Krisis hindurch, trotz mancher Sprünge seiner Politik ein gewiß großes und anerkennenswertes Resultat zu erreichen, dies nicht als sein Verdienst anzuerkennen, sondern für einen Zufall zu halten sei …
Man habe nicht bloß allgemeines Mißtrauen gegen dieses budgetlose Ministerium, sondern man halte diese Personen nach ihren Leistungen nicht für berechtigt, Vertrauen in Anspruch zu nehmen.
Hierauf erwiderte Bismarck u. a. Folgendes:
„Ich bin der Anerkennung in sehr geringem Maße bedürftig und gegen Kritik ziemlich unempfindlich. Nehmen Sie immerhin an, daß alles, was geschehen ist, rein zufällig geschah, daß die preußische Regierung daran vollständig unschuldig ist, daß wir der Spielball fremder Intrigen und äußerer Einflüsse gewesen sind, deren Wellenschlag uns zu unserer eigenen Ueberraschung an der Küste von Kiel ans Land geworfen hat. Nehmen Sie das immerhin an, mir genügt es, daß wir da sind.“
An diese Verhandlung knüpfte sich eine Duellforderung, welche damals Sensation erregte und noch kürzlich in ungenauer Weise öffentlich besprochen worden ist.
Virchow hatte mit Bezug auf die oben mitgeteilte Aeußerung Bismarcks, daß in dem Kommissionsberichte eine indirekte Apologie Hannibal Fischers zu finden sei, geäußert, wenn der Ministerpräsident den Bericht wirklich gelesen, so wisse er, Virchow, nicht, „was er von der Wahrhaftigkeit desselben denken solle“.
Mit Bezug hierauf sagte Bismarck:
„Der Herr Referent hat lange genug in der Welt gelebt, um zu wissen, daß er sich damit der technischen und spezialen Wendung gegen mich bedient hat, vermöge deren man einen Streit auf das rein persönliche Gebiet zu werfen pflegt, um denjenigen, gegen den man den Zweifel an seiner Wahrheitsliebe gerichtet hat, zu zwingen, daß er sich persönlich Genugthuung fordert. Ich frage Sie, meine Herren, wohin soll man mit diesem Tone kommen? Wollen Sie den politischen Streit zwischen uns auf dem Wege der Horatier und Kuratier erledigen?
„Es ließe sich davon reden, wenn es Ihnen erwünscht ist.
„Wenn das aber nicht, meine Herren, was bleibt mir dann anderes übrig, als gegen einen solchen starken Ausdruck meinerseits einen noch stärkeren wieder zu gebrauchen? Es ist dies, da wir Sie nicht verklagen können, der einzige Weg, auf dem wir uns Genugthuung verschaffen können, ich wünschte aber nicht, daß Sie uns in die Notwendigkeit versetzen, ihn zu betreten. Und wie weist der Herr Berichterstatter mir den Mangel an Wahrheit nach? Wenn ich mich noch der langen Rede recht erinnere, so warf er mir als nicht übereinstimmend mit dem Berichte diejenige meiner Aeußerungen vor, durch die ich die liberale Partei beschuldigte, ihre Sympathien für die Flotte hätten sich vermindert. Um zu beweisen, daß dies unrichtig war, liest er mir all die schönen Worte vor, die die Kommission in dem Berichte für die Flotte gemacht hat, während doch der Schluß lautet, Geld geben wir nicht. Ja, meine Herren, wenn Worte Geld wären, dann hätten wir der Freigebigkeit, mit der Sie die Regierung behandeln, nur unsere dankbare Bewunderung zu zollen.“
Diese Verhandlung fand am 2. Juni statt. Am 3. früh ließ der Minister durch einen Vetter seiner Gemahlin, Hauptmann von Puttkamer, Herrn Virchow auffordern, jene Beleidigung zurückzunehmen oder durch einen Zweikampf Genugthuung zu geben. Virchow mußte gerade an den Rhein verreisen und gab keine bestimmte Erklärung. An demselben Tage erzählte Bismarck auf Befragen eines Diplomaten, daß er Virchow gefordert habe. Am 6. erschien eine bezügliche Nachricht in der Kölnischen Zeitung; ob dieselbe von einem Freunde des Herrn Virchow oder aus diplomatischer Quelle kam, ist nicht festgestellt worden. Von da ab wurde jede Bewegung der Beteiligten polizeilich beobachtet. Zwischen dem Abgeordneten von Hennig und mir fand am 6. eine Verhandlung statt, welche ergebnislos blieb, weil Hennig an der für mich unannehmbaren Ansicht festhielt, der eigentlich Beleidigende sei der Ministerpräsident gewesen durch die Nebeneinanderstellung Virchows und Hannibal Fischers. Im Abgeordnetenhause erklärte am 8. Forckenbeck, Virchow würde seine Pflicht gegen das Land verletzen, wenn er wegen einer von ihm als Abgeordneten gethanen Aeußerung eine Duellforderung annehme. Der Präsident Grabow stimmte ihm lebhaft zu; ebenso die Abgeordneten Twesten, Waldeck und Gneist. Man betonte auch, daß die angeblich beleidigende Aeußerung Birchows vom Präsidenten nicht gerügt worden war. Dagegen aber wurde geltend gemacht, wenn jemand sich durch ein im Hause gefallenes Wort in seiner Ehre gekränkt fühle, so sei er allein Richter darüber, was zur Herstellung seiner Ehre geschehen müsse; und weder die Meinung einer Majorität des Hauses noch die des Präsidenten allein könne ihm die als notwendig empfundene Genugthuung gewähren. Dieser von drei Konservativen vertretenen Ansicht traten auch einzelne Mitglieder des linken Centrums bei wie Stavenhagen und Bockum-Dolffs. Es wurde nicht abgestimmt, aber man war darüber einverstanden, daß die Majorität aufseiten des Präsidenten stand, welcher am Schluß nochmals die „dringende Erwartung“ aussprach, daß Virchow – der nicht anwesend war – sich der Meinung des Hauses unterwerfen werde.
Am 8. abends teilte der Abgeordnete von Hennig schriftlich mit, daß Virchow die Duellforderung ablehnte.
Wenn dieser Abschluß der Sache mich auch nicht ganz befriedigte, so war ich doch froh über die Beseitigung eines Streitfalles, in dessen Behandlung vonseiten meines Chefs ich seine sonst immer von mir bewunderte überlegene Weisheit vermißt hatte.
Virchows unziemlicher Angriff schien mir durch die oben mitgeteilte öffentliche Belehrung siegreich abgewiesen, die Duellforderung daher ein anfechtbarer Luxus. Nachdem sie aber einmal erfolgt war, hätte es doch wohl der Geheimhaltung bedurft, um mit Sicherheit dem Gegner die Verantwortung eines etwaigen Bekanntwerdens zuschieben zu können, welches notwendigerweise augenfällige polizeiliche Vorkehrungen hervorrufen mußte, die den Ernst der Sache schädigten.
Natürlich war ich vom ersten Augenblick an entschlossen gewesen, das Duell mit erlaubten oder unerlaubten Mitteln zu verhindern. Es wäre nach meinem Gefühle Landesverrat gewesen, den unersetzlichen Mann einer Bleikugel oder dem Strafrichter entgegengehen zu lassen.
Bei der am 13. Juni stattfindenden Beratung der Kriegskostenvorlage erinnerte Bismarck daran, welche Befürchtungen das Haus im Dezember 1863 durch Annahme der Resolution Schulze-Delitzsch zu erkennen gegeben hatte. Darin sei gesagt worden, „daß dieser Gang in der preußisch-österreichischen Politik kein anderes Ergebnis haben kann, als das: die Herzogtümer zum zweiten Mal an Dänemark zu überliefern; daß die königliche Staatsregierung, indem sie diese rein deutsche Sache als europäische behandelt, die Einmischung des Auslandes herbeizieht; daß die angedrohte Vergewaltigung den berechtigten Widerstand der übrigen deutschen Staaten und damit den Bürgerkrieg in Deutschland herausfordert“.
Alle diese Befürchtungen seien nicht eingetroffen. Auch die von dem Hause damals positiv bezeichneten Wünsche seien erfüllt oder, soweit die Erfüllung in Betreff der Einsetzung des Herzogs rückständig, liege sie, wie früher erwähnt, ganz in unserer Hand und könne erfolgen, sobald wir die Sicherheit hätten, daß die im Interesse Preußens und des gesamten Deutschlands an die Herzogtümer zu stellenden Forderungen durch den Herzog erfüllt werden würden.
Man werfe der Regierung vor, daß der von ihr eingeschlagene Weg uns in Schleswig-Holstein einen Mitbesitzer gegeben habe; der von dem Hause empfohlene Weg aber würde uns 32 Mitbesitzer gegeben haben und an deren Spitze den jetzigen, und zwar nicht mit derselben Gleichberechtigung, sondern mit der Ueberlegenheit der Präsidialmacht und als Führer der Bundesmajorität gegen Preußen.
Ferner habe ein Redner getadelt, daß wir eine Gelegenheit versäumt hätten, uns an die Spitze der mittleren und kleineren Staaten Deutschlands zu stellen. Wenn der Herr eine Zeit lang Bundestagsgesandter in Frankfurt gewesen wäre, so würde er sich überzeugt haben, daß die Majorität der Mittel- und Kleinstaaten sich nicht freiwillig einer preußischen Aktion unterzuordnen bereit gewesen wäre, ohne Preußen in der Ziehung der Konsequenzen aus dieser Aktion zu hemmen.
Dann fuhr der Minister fort:
„Die Frage, über die ich hier einen Ausspruch des Hauses noch mehr als über die finanzielle erwartet hätte, ist die politische, die Frage der Gegenwart und Zukunft. Diese Frage nun, die seit 20 Jahren in dem Vordergrunde des deutschen politischen Interesses gestanden hat, diese Frage harrt gegenwärtig der Lösung. Sie, meine Herren, sind durch die Vorlage der Regierung in die Lage gesetzt, sich zu äußern. Sie haben die Gelegenheit zu sprechen – ich möchte sagen, Sie sind en demeure gesetzt, zu reden. Das Land hat ein Recht, zu erfahren, was die Meinung seiner Landesvertretung über die Sache sei …“
„Ich halte es für die Herzogtümer allerdings außerordentlich viel vorteilhafter, Mitglied der großen preußischen Genossenschaft zu werden, als einen neuen Kleinstaat mit fast unerschwinglichen Lasten zu errichten. Aber wenn dieses Programm verwirklicht werden sollte, so würden eben auch diese selben Lasten auf den preußischen Staat übernommen werden müssen. Wir würden nicht die Herzogtümer in den preußischen Staatsverband unter irgendeiner Form aufnehmen können und ihnen dennoch die preußischen Kriegskosten abverlangen oder sie die österreichischen Kriegskosten bezahlen lassen oder sie auch nur in der Ungleichheit der Schulden bestehen lassen, welche doppelt so viel auf einen Kopf in Schleswig-Holstein austragen wie in Preußen. Wir würden sie mit allen preußischen Staatsbürgern gleichstellen müssen.“
Dann führte der Minister aus, der Gedanke der Annexion habe, auch wenn er nicht zur Ausführung käme, jedenfalls Gutes gewirkt. Das Erbteil kleinstaatlicher Verhältnisse, die Abneigung gegen die Uebernahme von Pflichten der Bürger eines großen Staates, die Abneigung zur Bewilligung solcher Bedingungen, die der Bevölkerung Lasten, namentlich in der Heeresfolge, auferlegen, diese Abneigung habe sich vermindert in demselben Maße, in dem die Idee der Annexion Boden gewann. Unter dem Drucke dieser Idee habe man sich unseren Wünschen genähert, aber noch nicht so weit, daß wir darauf abschließen könnten.
Bei den nun folgenden Abstimmungen konnte das Haus sich über irgendeine Ansicht in der schleswig-holsteinschen Sache nicht einigen; sämtliche Anträge blieben in der Minorität.
Die Session wurde am 17. Juni auf Befehl des Königs durch eine Rede des Ministerpräsidenten geschlossen, welche die überwiegend negativen Resultate der Session aufzählte, dann aber folgende Worte brachte:
„Die Regierung Seiner Majestät … wird unbeirrt durch feindseligen und maßlosen Widerstand in Rede und Schrift, stark im Bewußtsein ihres guten Rechts und guten Willens, den geordneten Gang der öffentlichen Angelegenheiten aufrechterhalten und die Interessen des Landes nach außen wie nach innen kräftigst vertreten. Sie lebt der Zuversicht, daß der Weg, den sie bisher innegehalten, ein gerechter und heilsamer gewesen ist, und daß der Tag nicht mehr fern sein kann, an welchem die Nation, wie bereits durch Tausende aus freier Bewegung kundgewordener Stimmen geschehen, so auch durch den Mund ihrer geordneten Vertreter ihrem königlichen Herrn Dank und Anerkennung aussprechen werde.“
* * *
Im Bunde stimmte Oesterreich für den bereits erwähnten bayerischen Antrag wegen Einsetzung Augustenburgs, welcher mit 9 gegen 6 Stimmen zum Beschluß erhoben wurde. Preußen erklärte sofort, die „vertrauensvolle Erwartung“ des Bundes werde sich nicht erfüllen, und kündigte an, daß alte brandenburgische Ansprüche auf die Herzogtümer nachzuweisen seien.
Die Einrichtung der preußischen Marinestation im Kieler Hafen rief einen österreichischen Protest hervor, der von Preußen „mit Befremden“ zurückgewiesen wurde, da jedem der Miteigentümer die Benutzung der Häfen und Buchten des Landes freistehe und längst bekannt sei, daß Preußen keiner Entscheidung über die Zukunft der Herzogtümer zustimmen werde, welche den Kieler Hafen nicht in seinen Händen ließe.
So schärften sich die Gegensätze. Der König berief am 29. Mai einen Ministerrat. Nur Bodelschwingh wünschte, einen Bruch mit Oesterreich jedenfalls zu vermeiden; von den übrigen Ministern rieten einige sogleich, die Annexion zu fordern, also den Krieg herbeizuführen, andere bei den Februarbedingungen als erster Etappe zur Annexion stehen zu bleiben. Bismarck meinte, da in Wien die Tendenz der Niederhaltung Preußens wieder zur Herrschaft gelangt sei, werde es wohl früher oder später zum Kriege kommen; er könne aber den Rat dazu nicht geben. Ein solcher Entschluß dürfe nur aus freier Ueberzeugung Seiner Majestät hervorgehen. Der König behielt sich die Entscheidung vor; es blieb daher bei dem Programm der Februarbedingungen.
Im Juni lud Bismarck Herrn Paul Mendelssohn-Bartholdy zu einer Besprechung ein, um dessen Ansicht darüber zu hören, wie die kaufmännische Welt einen Krieg mit Oesterreich auffassen würde. Er überraschte Herrn Mendelssohn – wie dieser mir bald darauf erzählt hat – durch die Darlegung seiner Ueberzeugung, daß der Krieg, wenn er wirklich ausbräche, binnen vier Wochen beendigt sein würde, da unsere Armee der österreichischen durch Zahl und Ausbildung der Truppen sowie durch schnellere Mobilmachungsfähigkeit weit überlegen sei.
Trotz dieser Ueberzeugung, welche er sonst meines Wissens niemals in so bestimmter Weise ausgesprochen hat, blieb sein eifriges Bestreben, Wege zu friedlicher Verständigung mit dem Bundesgenossen zu finden; viele Depeschen wurden gewechselt wegen der Modalitäten einer Einberufung des schleswig-holsteinischen Landtages, welche Bismarck trotz der notorischen Stimmungen der dortigen Bevölkerung für zweckmäßig hielt. Es kam aber nicht dazu, weil Graf Mensdorff schließlich seine entschiedene Abneigung dagegen zu erkennen gab und mit versöhnlichen Vorschlägen hervortrat; vielleicht infolge innerer Schwierigkeiten des Donaureiches. Im Juni knüpfte man die im März abgebrochenen Verhandlungen über die Februarbedingungen wieder an. Graf Mensdorff meinte, der Kieler Hafen und Rendsburg könnten zugestanden werden, wegen der Militärhoheit jedoch sei die Entscheidung dem Bunde vorzubehalten; über andere Punkte wie die Marine, den Nord-Ostsee-Kanal, die Verkehrsverhältnisse möge Preußen sich mit dem künftigen Souverän direkt verständigen, dessen baldige Einsetzung daher dringend zu wünschen sei.
Bismarck acceptierte vollständig dieses ganze Programm in der Hoffnung, daß beim Bunde das sachliche Bedürfnis einer Militärkonvention Anerkennung finden würde, und fügte hinzu, Preußen wäre auch zu sofortiger Einsetzung eines Herzogs bereit, wenn Oesterreich statt des Erbprinzen den Großherzog von Oldenburg annehme. Erst neuerlich habe das kaiserliche Kabinett die früher von ihm abgelehnte Kandidatur Augustenburgs bevorzugt, welche jedoch wegen fortgesetzt ungehörigen Verhaltens desselben für Preußen nicht annehmbar sei.
Auch nach dem Einzuge der preußischen Truppen in Holstein hatte der Prinz nämlich nicht aufgehört, sich als dem Landesherrn huldigen zu lassen. Solche Thatsachen empfand der König als Verletzungen seines Hoheitsrechtes. Er gab in einem eigenhändigen Schreiben dem Wunsche Ausdruck, der Erbprinz möchte die Herzogtümer verlassen, um die Schwierigkeiten der Lage zu vermindern. Derselbe hatte früher einige Jahre in Potsdam beim ersten Garderegiment gestanden und war als Besitzer einer Herrschaft in Schlesien preußischer Unterthan. Der König war daher unangenehm überrascht, als eine bestimmt ablehnende Antwort einging.
Am 6. Juli wurde der Geburtstag des Erbprinzen in mehreren Städten der Herzogtümer, namentlich in Kiel, durch öffentliche Veranstaltungen gefeiert; auch empfing er verschiedene huldigende Deputationen. Fast gleichzeitig erhielt der König in Karlsbad ein Rechtsgutachten der Kronjuristen, welches den Anspruch des Hauses Augustenburg auf die Thronfolge in den Herzogtümern verneinte.
Das Kronsyndikat, welches im Dezember 1864 aufgefordert war, die augustenburgischen, oldenburgischen und brandenburgischen Ansprüche zu prüfen, bestand damals aus 18 Juristen, von denen sich 14 in absolut unabhängigen Stellungen befanden. Ihr Beruf30 war nicht etwa, Rechte der Krone zu vertreten, sondern, dem König auf Befragen über zweifelhafte Rechtsverhältnisse Auskunft zu geben. Diese Männer, unter welchen sich die ersten juristischen Autoritäten des Landes befanden, hatten nach gründlicher Prüfung des ganzen urkundlichen Materials durch Majoritätsbeschluß festgestellt, daß die augustenburgischen Ansprüche infolge des Verzichts des Herzogs Christian erloschen seien und daß kein anderes Hoheitsrecht in den Herzogtümern bestehe als das von Preußen und Oesterreich durch den Wiener Frieden erworbene.
Durch dieses Gutachten fühlte der König sich von den Gewissensbedenken erlöst, welche ihn 1864 in Schönbrunn und später verhindert hatten, für die Annexion einzutreten.
* * *
Am 26. Juni schlossen sich Bismarck und Abeken dem Gefolge des Königs in Karlsbad an, ich konnte mich erst einige Tage später dort melden. Wir wohnten diesmal in der hoch über dem Sprudel inmitten eines schattigen Gartens einsam gelegenen Villa „Helenenhof“.
Einige Wochen vorher hatte ein Hofbeamter mir diese Wohnung für den Minister telegraphisch angeboten, und in Abwesenheit desselben hatte ich sie gemietet, ohne zu bedenken, daß das täglich mehrmalige Ersteigen von vielleicht hundert Treppenstufen ihm lästig sein würde. Beim Ankommen sagte er zu Abeken: „Die Aussicht ist ja hier recht schön; aber die Wohnung paßt doch mehr für einen Dichter als für einen Geschäftsmann.“ Er soll in den ersten Tagen über das viele Steigen geklagt haben; empfänglich aber war er für die reine Luft auf der kleinen Höhe. Auch daß unmittelbar unter seinem Schlafzimmer ein Paar Kühe standen und sich mitunter hörbar machten, war ihm angenehm. Alles, was an das Landleben erinnerte, pflegte ihn anzuheimeln. Als ich ankam, verlor er kein Wort über die Wohnung.
Abeken, auf dessen Leistungsfähigkeit gerade in diesen Wochen viel ankam, wurde durch den Aufenthalt in diesen idyllischen Umgebungen sichtlich erfrischt und gestärkt. Unsere kameradschaftliche Freundschaft befestigte sich und ist niemals auch nur für einen Augenblick durch irgendeine Mißempfindung getrübt worden. Die Geschäftsverteilung zwischen uns war dieselbe wie im Jahre vorher; Abeken bearbeitete die ganze politische Korrespondenz, welche damals Wien gegenüber ernste Töne anzuschlagen hatte.
Man war über die Behandlung der Februarbedingungen einig geworden, aber die Anwesenheit des Erbprinzen in Holstein erwies sich als ein unübersteigliches Hindernis der Verständigung. Wir bezeichneten die fortgesetzten öffentlichen Demonstrationen für einen willkürlich aufgestellten Landesherrn als unverträglich mit dem unanfechtbaren Hoheitsrechte des Königs.
Man erwog alle für den Fall der Selbsthilfe erforderlichen Vorkehrungen und faßte die Möglichkeit des Krieges mit Oesterreich scharf ins Auge.
Zum 21. Juli berief der König alle Minister sowie Goltz und Werther nach Regensburg. Dort wurde die letzte nach Wien zu richtende Depesche festgestellt, welche darauf hinausging, daß, wenn Oesterreich der Herstellung der Ordnung in den Herzogtümern zuzustimmen beharrlich ablehne, Preußen einseitig das Erforderliche vorkehren werde.
Bezügliche Befehle sollten jedoch während der beabsichtigten Anwesenheit des Königs in Gastein noch nicht erlassen werden; man hatte schon in Karlsbad das Anerbieten des Grafen Mensdorff, einen Vertrauensmann zur Besprechung der Lage zu senden, bereitwillig angenommen.
Auf der Reise von Regensburg nach Gastein gab es einen Ruhetag in Salzburg. Dorthin kam Pfordten, welcher, obwohl ein Führer der Mittelstaaten, doch in manchen Beziehungen unseren Anschauungen weniger fernstand als Beust. Bismarck legte ihm mit rückhaltloser Offenheit die Schwierigkeiten der Lage dar, worauf Pfordten die relative Berechtigung unserer Auffassung anerkannte und sowohl auf Graf Mensdorff wie auf den Erbprinzen vermittelnd einwirken zu wollen erklärte.
Zwei Tage später wurde in Altona der Redakteur der Schleswig-Holsteinischen Zeitung, ein preußischer Unterthan Namens May, wegen der strafbaren Angriffe seiner Zeitung auf den König von einer preußischen Patrouille gefangen genommen und nach der Festung Rendsburg abgeführt. Gegen dieses Verfahren protestierten die Kieler Landesregierung und Baron Halbhuber. Briefe, welche den Letzteren kompromittierten, wurden unter Mays Papieren gefunden.
In Wien war inzwischen eine seit längerer Zeit vorbereitete vollständige Wandlung der inneren Politik durch einen Ministerwechsel zum Ausdruck gekommen. Nur Graf Mensdorff, der Kriegsminister und Graf Moritz Esterhazy blieben davon unberührt; aber Herr von Schmerling, der Leiter der liberalen inneren Politik, und seine gleichgesinnten Kollegen wurden entlassen. Schmerling hatte zwar einige Jahre hindurch das Parlament mit ungewöhnlichem Geschick geleitet, vermochte aber zuletzt weder das stetig wachsende Deficit im Staatshaushalt zu beseitigen noch wiederholte Abstriche unerläßlicher Forderungen im Militäretat zu verhindern. Auch sein Verhalten gegen die grollenden Ungarn führte nicht zu annehmbaren Ergebnissen; seine Stellung wurde unhaltbar.
Schmerling war in Uebereinstimmung mit Biegeleben und mit der großen Mehrzahl seiner Landsleute von dem Gedanken Schwarzenbergs erfüllt, daß zum Gedeihen des Reiches die Niederhaltung Preußens notwendig sei.
Diese Denkweise war ein natürliches Ergebnis der Vorgänge von 1849 und 1850. Das Frankfurter Parlament hatte die durch Jahrhunderte von den Beherrschern Oesterreichs getragene deutsche Kaiserkrone dem König von Preußen angeboten und dieser hatte daraus ein Anrecht auf die „Unionspolitik“ hergeleitet. Die Erhaltung der Präsidialstellung Oesterreichs im Deutschen Bunde, des letzten Restes des ehemaligen Kaisertums, lag jedem Deutsch-Oesterreicher am Herzen. Man hatte 1850 den Nebenbuhler gedemütigt und man durfte ihn doch nicht mächtig genug werden lassen, um wieder eine Unionspolitik einzuleiten.
Die Mittelstaaten hatten sich im Jahre 1850 als die natürlichen Bundesgenossen erwiesen, in Frankfurt die Präsidialmacht bis 1863 konsequent unterstützt und durch ihre Bestrebungen für Augustenburg die öffentliche Meinung in Oesterreich derselben Richtung zugeführt.
Es ist erstaunlich, daß inmitten dieser Strömungen der ihn umgebenden politischen Welt Graf Rechberg vermocht hat, eine Zeit lang die preußische Politik zu fördern. Von allen Seiten gedrängt, mußte er jedoch schon im Mai 1864 wieder in mittelstaatliche Bahnen einlenken. Nach seinem Sturze dominierte Schmerlings und Biegelebens Einfluß.
Als nun Schmerling fiel, wurde mit dessen innerer Politik von dem Ministerium des Grafen Belcredi vollständig gebrochen, nach kurzer Zeit sogar die Verfassung suspendiert. Rückwirkungen dieses Bruches traten auch in der Gestaltung des Verhältnisses zu Preußen hervor.
Der eigentliche Leiter des neuen Ministeriums, Graf Moritz Esterhazy, stand in enger Fühlung mit den ungarischen Magnaten, haßte die liberalen Deutsch-Oesterreicher wie die liberalen Regierungen und Landtage der Mittelstaaten und hielt für ratsam, mit dem konservativen Preußen eine Verständigung zu suchen. Die öffentliche Meinung verlangte zwar den Krieg, da der preußische Uebermut unerträglich wäre; Esterhazy aber erkannte klar, daß augenblicklich aus militärischen und finanziellen Gründen ein großer Krieg mit Aussicht auf Erfolg nicht unternommen werden konnte. Er begrüßte daher als willkommenes Auskunftsmittel den von dem Gesandten in München, Grafen Blome, ihm nahegelegten Gedanken, die gemeinschaftliche Verwaltung in Schleswig-Holstein zu teilen.
Graf Blome, ein geborener Holsteiner, war wie fast alle holsteinischen Edelleute ein Gegner Angustenburgs und der mittelstaatlichen Politik. Er wurde als der verheißene Vertrauensmann nach Gastein geschickt. Nach längeren, durch eine Reise nach Wien unterbrochenen und vor Biegeleben sorgfältig geheim gehaltenen Verhandlungen kam am 14. August der vielgeschmähte Gasteiner Vertrag zustande. „Unbeschadet der Fortdauer der durch den Artikel III des Wiener Friedenstraktats vom 30. Oktober 1864 gemeinsam erworbenen Rechte beider Mächte an der Gesamtheit der Herzogtümer“, sollte die Ausübung derselben in Schleswig Preußen, in Holstein Oesterreich zustehen, in Rendsburg alternierende Besatzung stattfinden, der Kieler Hafen an Preußen allein überlassen, die Anlegung eines Nord-Ostsee-Kanals durch Holstein gestattet und endlich das Herzogtum Lauenburg dem Könige von Preußen für 2 Millionen dänischer Thaler verkauft werden.
Bismarck hatte sich zu diesen Abmachungen nicht gerade gern entschlossen, wenn es ihm auch gelungen war, den Entwurf Blomes im Einzelnen günstiger für uns zu gestalten. Aber eine für den Kriegsfall erwartete Hilfe blieb aus und eine unerwartete Gefahr zeigte sich. Früher hatte Nigra, damals italienischer Gesandter in Paris, mehrfach ausgesprochen, ein preußisch-österreichischer Krieg würde unfehlbar von einem italienischen Angriff auf Venetien begleitet werden; dieselbe Ansicht hatte auch Usedom vertreten, jetzt aber wollte der mißtrauische Ministerpräsident La Marmora keinerlei Zusage geben. Und in Paris hatte Goltz trotz mancher früheren Sympathieäußerungen eine Zusicherung eventueller Neutralität nicht zu erlangen vermocht; man mußte daher auf eine französische Intervention gefaßt sein. Diese in Gastein ankommenden Nachrichten trugen dazu bei, daß Bismarck sich entschloß, dem Könige die Annahme des Vertrages anzuraten, welcher, wie der Minister sich ausdrückte, „die Risse im Bau noch einmal verkleben“ konnte und jedenfalls den Vorteil darbot, daß Oesterreich sich darin wieder auf die Grundlage des Wiener Friedens stellte. Die wiederholte Betonung der erworbenen Souveränitätsrechte beider Verbündeten schloß Anerkennung von Ansprüchen anderer Prätendenten aus und bedeutete demnach Aufgeben der im letzten Jahre in Gemeinschaft mit den Mittelstaaten befolgten Politik.
Erwünscht schien auch, daß der Verkauf des Anrechtes an Lauenburg hoffen ließ, Oesterreich würde in Zukunft dem Verkaufe seiner Rechte an Holstein sich weniger abgeneigt zeigen als bisher.
Zufällig kam am Tage der Unterzeichnung des Vertrages Beust nach Gastein, der leidenschaftlichste Führer mittelstaatlicher Politik. Am 17. August diktierte Bismarck in übermütiger Laune für das Auswärtige Amt folgende Mitteilung, welche einer zum Eingehen auf diesen Scherz bereiten Zeitung zugehen sollte:
„Herr von Beust ist am 14. August in Gastein angekommen, kurz vor der auf den 15. angesetzten Abreise des Grafen Blome. Dem Vernehmen nach war es wesentlich der versöhnlichen Einwirkung des sächsischen Ministers zu danken, daß die bereits gescheiterten Verhandlungen zwischen Bismarck und Blome in der letzten Stunde wieder ausgenommen und befriedigend abgeschlossen wurden. Man hat in Preußen Herrn von Beust doch wohl unterschätzt und für zu leidenschaftlich und einseitig angustenburgisch gehalten; bei dieser Gelegenheit hat er sich als ein weitblickender, vorurteilsfreier Politiker bewährt.“
Beim Bekanntwerden des Gasteiner Vertrages wurde fast überall, in Deutschland wie in Oesterreich, die Meinung laut, daß Preußen gesiegt und Oesterreich durch den augenscheinlichen Abfall von den Mittelstaaten wie auch durch den Verkauf von Lauenburg Demütigungen erlitten habe. Bayern und Sachsen hatten aus Rücksicht für Oesterreich gezögert, dem Zollvereinsvertrage mit Italien beizutreten und das junge Königreich anzuerkennen; beide Staaten aber trafen nun sofort die hierzu erforderlichen Einleitungen. Der Gasteiner Vertrag bewirkte, daß Italien vor dem Jahresschluß von allen deutschen Staaten anerkannt wurde mit Ausnahme von zweien, denen nur noch eine kurze Lebensdauer bestimmt war, nämlich Hannover und Nassau.
Als am 18. August Bismarck mit Abeken und mir im offenen Wagen auf dem Wege nach Salzburg durch das grüne Thal von Hofgastein fuhr, sagte er: „Wenn ich es noch erlebe, daß in Kiel ein preußischer Oberpräsident sitzt, will ich mich auch nie mehr über den Dienst ärgern.“
Ich sprach die Hoffnung aus, später einmal an diese Worte erinnern zu dürfen.
Nach einiger Zeit sagte er: „Faust klagt über die zwei Seelen in seiner Brust; ich beherberge aber eine ganze Menge, die sich zanken. Es geht da zu wie in einer Republik …
„Das meiste, was sie sagen, teile ich mit. Es sind da aber auch ganze Provinzen, in die ich nie einen andern Menschen werde hineinsehen lassen.“ …
In Salzburg begegneten sich die Monarchen. Dort wurde bestimmt, daß der dem Kaiser besonders sympathische General Manteuffel in Schleswig und der vom Könige hochgeschätzte General Gablenz in Holstein die Verwaltung leiten sollten.
Am 21. fuhr der König, von Bismarck gefolgt, nach Ischl, um der Kaiserin einen Besuch abzustatten; Abeken und ich blieben in Salzburg.
Dann reiste Bismarck mit mir über München, wo er mit Pfordten, und Stuttgart, wo er mit Varnbüler konferierte, nach Homburg. Dort hielt sich Frau von Bismarck einer Kur wegen auf, begleitet von ihrer Tochter und Gräfin Fanny Keyserling31. Nach kurzem Verweilen trafen wir dann in Baden wieder mit Abeken zusammen, der inzwischen eine kleine Erholungsreise gemacht hatte.
Wie im Jahre vorher war unser Quartier in dem auch von dem Gesandten Grafen Flemming bewohnten Landhause. Dort gaben wir nach Anweisung des Ministers einem französischen Schriftsteller das Material zu einer Broschüre über die Gasteiner Konvention, welche dann bei Dentu in Paris erschien. Die französischen Zeitungen hatten die Gasteiner Abmachungen für eine Definitive gehalten und giftige Angriffe dagegen gerichtet; eine Aufklärung der öffentlichen Meinung in Frankreich schien dem Minister erwünscht.
Graf Goltz hatte zwar amtlich erklärt, der ganze Lärm sei gegenstandslos, da es sich nur um ein vielleicht kurzes Provisorium handele; der Minister Drouyn de Lhuys that aber nichts, um die Schreier zu beruhigen. Im Gegenteil richtete er (am 29. August) an die französischen Agenten im Auslande ein Cirkular, welches unsere Politik in unhöflichster Form verdammte. Dasselbe kam erst später, als wir schon wieder in Berlin waren, durch die belgische Presse zu unserer Kenntnis.
In Baden hatte Bismarck eines Abends große Freude an Joachims Geige, welche in Flemmings Wohnzimmer ein treffliches Streichquartett anführte.
24Am Tage der Abreise des Königs (25. August) gab Graf Rechberg dem Kollegen ein diplomatisches Diner, nach welchem der französische Botschafter Herzog von Gramont (Mémor: l’Allemagne nouvelle. Paris. Dentu. 1879, p. 148) von Bismarck folgende Worte über die Zukunft der österreichischen Monarchie gehört haben will: „Ce qui est allemand retournera tôt ou tard à l’Allemagne, c’est inévitable. Il n’est pas plus difficile de gouverner Vienne de Berlin que de gouverner Pesth de Vienne. Ce serait même beaucoup plus facile.“ Diese Aeußerungen find mehrfach reproduziert worden (s. z. B. Kohl, Regesten I, S. 238). Friedjung bezeichnet (I, S. 97) die ganze bezügliche Mitteilung als „mit Vorsicht hinzunehmen“. Ich war nicht Zeuge jener Unterhaltung und kann daher nicht kategorisch dementieren, halte mich aber für verpflichtet, die Ueberzeugung auszusprechen, daß Bismarck jene Aeußerungen nicht gethan haben kann. Denn in den neun Jahren seines täglichen Verkehrs mit mir habe ich oft genug von ihm gerade die entgegengesetzten Ansichten aussprechen hören, nämlich: die Deutsch-Oesterreicher würden niemals mit uns in einem Staatswesen verbunden werden können; schon allein die Existenz der Stadt Wien mache das unmöglich. Dieselbe Ueberzeugung ist auch in den „Gedanken und Erinnerungen“ ausgesprochen (Bd. II, S. 45). Ich darf übrigens daran erinnern, was den Zeitgenossen bekannt war, daß Bismarck, auch nach gelegentlichem Genuß schwerer Weine, sich immer bewußt geblieben ist, zu wem, wo und was er sprach. Nun hat er oft gesagt: Was einer im diplomatischen Corps weiß, pflegen bald alle zu erfahren und dann kommt es an den auswärtigen Minister. Demnach halte ich für undenkbar, daß er im Hause des freundlichen Gastgebers zu einem Mitgliede des diplomatischen Corps Aeußerungen gethan haben könnte, deren Wiederholung den von ihm als unersetzlich betrachteten politischen Freund tödlich hätte verletzen müssen.
25Hermann Wagener, Erlebtes. Berlin, R. Pohl, 1884, II. Abteilung, S. 6. Der Verfasser ist der auch als ein Führer der Konservativen im Abgeordnetenhause bekannt gewordene erste Redakteur der Kreuzzeitung; von 1866 bis 1873 war er vortragender Rat im „Staatsministerium“.
26Die Angabe Friedjungs (I, S. 113), Bismarck habe erst im Januar geantwortet, wird durch die vom 21. Dezember datierte österreichische Entgegnung auf die diesseitige Depesche vom 13. widerlegt.
27Die von Kohl (Reg. I, S. 247) übernommene Angabe Sybels (IV, S. 51), diese Depesche (vom 21. Dezember 1869) habe darauf hingewiesen, daß, wenn Preußen nicht auf das österreichische Programm eingehe, der Bruch der Allianz bevorstehe, ist unbegründet. Eine Analyse dieses Dokuments enthält die dem Abgeordnetenhause mitgeteilte Denkschrift vom 8. Mai 1865. (Drucksachen No. 179.)
28Als bei der Militärvorlage von 1892 es sich um die Beseitigung des dritten Dienstjahres bei der Infanterie gegen gewisse Kompensationen handelte, schickte ich dem damaligen Reichskanzler den Entwurf eines Zeitungsartikels, welcher die von Eulenburg erzählten Thatsachen ohne Nennung der Quelle enthielt. General von Caprivi ließ diesen „Ein Rückblick“ überschriebenen Artikel in der „Post“ vom 31. Dezember 1892 abdrucken, hielt den Inhalt desselben also für richtig. Daß 1865 in dieser Angelegenheit ein schriftlicher Immediatbericht erstattet worden sei, glaube ich nicht. Denn in so hochwichtigen Fragen pflegte schriftlich nur berichtet zu werden, nachdem der König dem Antrage bei mündlichem Immediatvortrag zugestimmt hatte. Es wird daher vielleicht nie eine urkundliche Bestätigung der erwähnten Mitteilungen des Grafen Eulenburg aufgefunden werden.
29Der Abgeordnete Loewe.
30Kabinettsordres vom 12. Oktober und 27. November 1854, s. Bauer, Neuere ständische Gesetzgebung S. 447.
31Jetzt Frau von Batocki-Bledau; eine intime Freundin des Hauses.