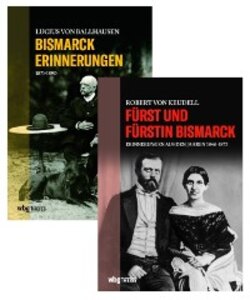Читать книгу Begegnungen mit Bismarck - Robert von Keudell - Страница 20
VIII.
Merseburg. Lauenburg. Biarrits.
Ende des österreichischen, Abschluß des italienischen Bündnisses.
Antrag auf deutsches Parlament. Mobilmachungen. September 1865 bis Juni 1866.
ОглавлениеAm 6. September ging’s wieder fort über Homburg nach Berlin, wo die Verwaltung von Schleswig manches zu thun gab.
Im Mai schon war von der Kölnischen Zeitung behauptet worden, daß die Organe der Kieler Landesregierung in Nord-Schleswig die dänisch redende Bevölkerung mit ähnlichen Bedrückungen quälten, wie sie früher die Deutschen von den Dänen erfahren hatten. Eine auf Bismarcks Anregung durch Zedlitz veranlaßte Untersuchung ergab die Richtigkeit dieser Behauptungen; der Einspruch Halbhubers aber verhinderte gründliche Remedur. Die Thatsache der stattgehabten Untersuchung belebte die Hoffnungen der dänisch redenden Schleswiger, und Anfang September folgten sie in Masse einer Einladung nach Kopenhagen, wo man wissen wollte, daß der mächtige Kaiser der Franzosen die Rückgabe Nord-Schleswigs an Dänemark bewirken würde. General Manteuffel, der nunmehrige Gouverneur von Schleswig, trat diesem Irrtum öffentlich entgegen, faßte aber fast gleichzeitig die Anstellung von ehemals dänischen Beamten ins Auge. Er war mit Zedlitz darin einverstanden, daß in Schleswig ein Regierungskollegium wie das Kieler nicht zu bilden, sondern daß die Verwaltung von dem Präsidenten allein mit Hilfe vortragender Räte zu führen sei. Für solche aber fehlte es an geeigneten Personen, wenn man nicht augustenburgisch gesinnte anstellen wollte. Daher wurde beabsichtigt, einige der gut qualificierten, ehemals dänischen Beamten zu wählen.
Bismarck trat dieser Absicht entschieden entgegen und betonte, es komme darauf an, daß wir uns als „Freunde unserer Freunde“ bewährten; er empfahl demnach, Leute aus der in Flensburg gebildeten Nationalpartei zu bevorzugen, auch wenn ihre Vorbildung nicht ganz genügend scheine.
Am 16. September wurde dem Ministerpräsidenten die Grafenwürde verliehen. Er hatte so wenig wie seine soeben aus Homburg eingetroffene Gemahlin Freude an diesem Gnadenbeweise. Beide legten einen gewissen Wert darauf, Geschlechtern des altmärkischen und pommerschen „Uradels“ anzugehören; den Zwang aber, dem alten Namen ein neues Prädikat beizufügen, bezeichneten beide vertraulich als eine nicht leicht zu überwindende Unannehmlichkeit. Indes wußte Bismarck, wie lebhafte Genugthuung es seinem königlichen Herrn gewährte, ihn in dieser Weise auszeichnen zu können, und die Möglichkeit einer Ablehnung kam ihm daher nicht in den Sinn.
Am 17. ging im Gefolge des Königs der Minister, nur von mir begleitet, nach Merseburg, wo eine Feier der 50-jährigen Zugehörigkeit der Provinz Sachsen, verbunden mit einem großen Korpsmanöver, fünftägigen Aufenthalt verursachte. Wir waren sehr angenehm einquartiert bei Herrn Regierungsrat Gaede, einem berühmten Bienenzüchter, welcher außerdem die Pflege feiner Bordeauxweine als Liebhaberei betrieb. Er hielt für nötig, dieselben mittelst einer kleinen Maschine einzuschenken, um jede mögliche Erschütterung der Flasche durch eine menschliche Hand auszuschließen. Der Minister hörte mit demselben Vergnügen sachkundige Mitteilungen über Bienenzucht, mit dem er beim Frühstück die feinen Weine probierte. Er ritt auch gern zum Manöver hinaus und hielt mitunter zu Pferde Immediatvortrag.
Am 21. kam er erhitzt und bestaubt vom Manöver zurück und fragte in meinem Zimmer nach den neuen Sachen. Ich legte ihm ein durch die Presse bekannt gewordenes englisches Cirkular vor, welches wie das oben erwähnte französische die Gasteiner Abmachungen in unhöflichen Ausdrücken tadelte. Der Minister ging, nachdem er gelesen, im Zimmer auf und ab und diktierte so schnell, daß ich kaum nachschreiben konnte, folgende in der Presse zu verwertende Betrachtungen.
„Bei Meinungsverschiedenheiten der Deutschen unter sich sucht jeder seiner Sache dadurch ein Relief zu geben, daß er sagt: Hier bei mir ist Deutschland; ich vertrete die Macht, die Ehre, die nationalen Interessen der Gesamtheit. Bei der jetzt vorliegenden Divergenz zwischen den beiden Großmächten und der Würzburger Politik wird die Frage, wo das Interesse Deutschlands liegt, durch eine Probe aufs Exempel in schlagender Weise entschieden.
„Das Prinzip, für welches Frankreich und England im Namen der deutschen Nationalität leidenschaftlich Partei ergreifen, ist ganz gewiß kein deutsches, ist ganz sicher nicht der Weg, auf welchem Deutschland zur Entwickelung seiner nationalen Kräfte gelangt. Durch die Protektion des Auslandes wird diejenige Partei, der sie zuteilwird, als die antideutsche gebrandmarkt. Wer die Lächerlichkeit nicht fühlt eines Deutschen Bundes unter französisch-englischer Protektion, einer schleswig-holsteinischen Nationalität unter französisch-englischem Protektorat, der deutschen Freiheit geschützt durch Frankreich, der ist sicher entschlossen, mit Hilfe des Auslandes Partikularzwecke zu verfolgen und deutsche Phrasen dazu als Maske zu gebrauchen.
„England hat uns vom Siebenjährigen Krieg bis zum Wiener Frieden ausgebeutet und beeinträchtigt, und über Frankreichs teutonische Begeisterung und Frankreichs Schutz deutscher Freiheit, deutscher möglichst kleiner Nationalitäten, braucht man kein Wort zu verlieren. Frankreich hat offenbar gerechnet auf einen inneren Krieg Deutschlands. Das Mißvergnügen darüber, daß dieser innere Krieg, wenn nicht ganz beseitigt, so doch ins Unbestimmte vertagt ist, tritt zu plötzlich und zu leidenschaftlich in die Oeffentlichkeit, als daß nicht jeder Deutsche über die wiedergefundene Einigkeit der beiden großen Militärmächte sich beglückwünschen sollte. Die Leidenschaftlichkeit, mit der das französische Cirkular die Gasteiner Konvention verdammt, ins Deutsche übersetzt heißt: Ich hätte die Rheingrenze gewinnen können, ohne einer Koalition gegenüberzustehen, wenn die deutschen Großmächte nicht die Unwürdigkeit begangen hätten, sich einstweilen wieder zu verständigen. Wenn es irgendeine Form ernster und durchsichtiger Mahnung an die Deutschen gab, einig zu sein, so liegt sie in diesen fast identischen Cirkulardepeschen Englands und Frankreichs, deren Sprache zu stark ist, um sie einer Regierung, die sich selbst achtet, mitteilen zu können, und die man deshalb in die Form der Korrespondenz mit den eigenen Behörden einkleidet, denen gegenüber man seine Ausdrücke nicht zu mäßigen braucht, die man aber durch absichtliche Indiskretion in die Oeffentlichkeit wirft.
„Die französische Regierung hätte den deutschen Regierungen kaum einen größeren Dienst erweisen können als durch diese drohende Sprache; sie braucht sie nur fortzusetzen, um sehr schnell alle Regierungen und alle Parteien in Deutschland zu einigen, die preußische Regierung nach Umständen fortschrittlich, die süddeutschen absolutistisch zu machen, falls es zur Verteidigung des gemeinsamen Vaterlandes gegen die Rheingelüste notwendig ist. Wenn irgendetwas die Deutschen in ihrer Gesamtheit einigen kann, so sind es französisch-englische Drohungen; und wir werden Mühe haben, alle Parteien in Deutschland zu überzeugen, daß diese westmächtliche Arbeit nicht eine von den deutschen Großmächten bestellte sei, so nützlich wirkt sie im deutsch-nationalen Interesse.“
Nach diesem Diktat setzte er sich ans Fenster und sagte halblaut:
„Solange der Erbprinz in Kiel bleibt, hat man keine Sicherheit, daß wir mit der österreichischen Verwaltung gut auskommen werden; Edwin32 meint, in drei Monaten würden wir klar erkennen, wie es in Wien steht. Wenn Mensdorff wieder in Würzburger Politik verfällt, können wir ihm etwas Schwarz-Rot-Gold33 unter die Rase reiben. Die schleswig-holsteinische und die große deutsche Frage hängen so eng zusammen, daß wir, wenn es zum Bruch kommt, beide zusammen lösen müssen. Ein deutsches Parlament würde die Sonderinteressen der Mittel- und Kleinstaaten in gehörige Schranken weisen.“
Nach einer kurzen Pause fuhr er fort:
„Und wenn unter den mittelstaatlichen Ministern sich ein Ephialtes fände, die große deutsche Nationalbewegung würde ihn und seinen Herrn erdrücken.“
Dann stand er schnell auf und verließ das Zimmer.
Im Gefolge des Königs reisten wir am 23. nach Berlin, am 25. nach dem Herzogtum Lauenburg, in dessen Hauptstadt Ratzeburg die Huldigung der Stände für den neuen Landesherrn stattfinden sollte. Gegen Abend kamen wir in das freundliche Städtchen, welches an der Ostseite eines großen, von Buchenwäldern eingefaßten Sees liegt. Bismarck war zum Minister von Lauenburg ernannt worden und hatte als solcher die erforderlichen Anordnungen zu treffen.
Bald nach dem Bekanntwerden der Gasteiner Konvention hatte ein Vertreter des ansässigen Adels den Wunsch ausgesprochen, der König möchte die Aufrechterhaltung gewisser alter Privilegien zusagen. Das war nicht geschehen, der Minister daher zweifelhaft, ob die Stände die ihnen in der Kirche vorzulesende Eidesformel beschwören würden. Für den Fall irgendeiner Zögerung war Bismarck entschlossen, das gesamte in der Kirche anwesende Volk schwören zu lassen. Eine zu diesem Zweck vorbereitete andere Eidesformel nahm er mit in die Kirche34. Die Huldigung der Stände erfolgte aber ohne Unterbrechung mit der wünschenswerten Feierlichkeit. Die so imponierenden wie gewinnenden Erscheinungen Sr. Majestät des Königs und Sr. Königlichen Hoheit des Kronprinzen machten sichtlich großen Eindruck auf die Anwesenden.
* * *
Am 27. von Lauenburg zurückgekehrt, rüstete der Minister sich, mit Gemahlin und Tochter auf einige Wochen nach Biarrits zu reisen. Er suchte wie in den Vorjahren die stärkenden Bäder, hatte diesmal aber auch besondere Gründe, einen persönlichen Meinungsaustausch mit dem Kaiser Napoleon zu wünschen.
Derselbe hatte dem Grafen Goltz gelegentlich gesagt, er bedaure, daß Drouyn de Lhuys jenes Cirkular in seiner Abwesenheit und ohne sein Wissen abgesandt habe. Bismarck aber hörte in Paris von Rouher, einem Vertrauten des Kaisers, daß der Wortlaut des Schriftstückes durch diesen selbst vor der Absendung gebilligt worden sei. Von Drouyn de Lhuys mit ausgesuchter Höflichkeit empfangen, gab Bismarck diesem über unsere Politik ähnliche Aufschlüsse wie später dem Kaiser.
In Biarrits, wohin von der Kaiserin Eugenie Graf Goltz und der Botschaftssekretär von Radowitz als einzige Fremde zu einem längeren Aufenthalt eingeladen waren, hatte unser Minister mehrmals Gelegenheit zu eingehenden Unterredungen mit dem mächtigen Herrscher, der ihn auch Anfang November noch einmal in St. Cloud empfing.
Der Hauptinhalt der über diese verschiedenen Gespräche an den König erstatteten Berichte war Folgender:
Der Minister entwickelte vor dem Kaiser die Ansicht, es sei ratsam, die Ereignisse nicht willkürlich schaffen zu wollen, sondern ihre natürliche Entwicklung abzuwarten und nur in geeigneten Momenten einzugreifen. Schleswig-Holstein betreffend, werde Oesterreich hoffentlich zur Abtretung seines Anrechtes gegen eine Geldsumme sich bereitfinden lassen. Die beabsichtigte Erwerbung der Herzogtümer sei jedoch als eine unmittelbare Verstärkung der preußischen Macht nicht anzusehen. Im Gegenteil müßte sie unsere Kräfte nach mehr als einer Richtung, behufs Entwicklung unserer Marine und unserer nördlichen Defensivstellung, in einem Maße festlegen, welches durch den Zuwachs von einer Million Einwohner nicht ausgewogen würde. Durch diese Erwerbung sei aber die historische Aufgabe Preußens nicht erfüllt, sondern mit deren Erfüllung erst ein Anfang gemacht. Preußen sei berufen, durch engere Verbindung mit einigen anderen Staaten in Norddeutschland eine Macht zu schaffen, die stark genug wäre, um selbständige Politik zu treiben und nicht zur Anlehnung an die Ostmächte wie in den Jahrzehnten nach 1815 gezwungen zu sein.
Im Interesse Frankreichs scheine zu liegen, eine solche Entwicklung mit Wohlwollen zu begleiten; denn würde sie durch Frankreich gehemmt, so wäre Preußen wieder darauf hingewiesen, in einer Koalition mit den Ostmächten Schutz zu suchen; während ein aufstrebendes Preußen immer einen hohen Wert auf die Freundschaft des westlichen Nachbars legen müßte.
Der Kaiser bezeichnete die Anschauungsweise als ihm „vollkommen einleuchtend und sympathisch“. Um über die Zukunft der gegenseitigen Beziehungen sich zu verständigen, sei es nicht nötig, die Entwickelung der Dinge zu überstürzen, sondern ratsam, dieselbe abzuwarten und die Entschließungen der Lage anzupassen. Die Erwerbung von Schleswig-Holstein würde er empfehlen, durch irgendein Organ der Bevölkerung nachträglich sanktionieren zu lassen. Im Falle eines Konflikts in Deutschland sei ein Bündnis mit Oesterreich für ihn eine Unmöglichkeit. Einen Versuch dazu, den Metternich bei ihm kurz vor der Gasteiner Konvention machte, habe er abgelehnt.
Nach alledem glaubte Bismarck im Kriegsfalle eine wohlwollende Neutralität Frankreichs für wahrscheinlich halten zu dürfen.
Ueber die Erlebnisse seiner Reise und des Aufenthalts in Biarrits schrieb die Gräfin:
Biarrits, 8. Oktober 1865.
… Die Verstimmung über die hetzjagende Abreise überwand ich bald, als wir still im Coupee saßen und weiter und weiter durch die eisige Nacht hinflogen. Es war so kalt, daß wir alles, was von Decken und Mänteln vorhanden, in Bewegung brachten. Die Morgensonne beschien vor Düsseldorf und weiter hin schneeweiß bereifte Ebenen und der Wind wehte so kalt ins Coupee hinein, daß wir sehnend an Pelze dachten und sehr glücklich über den aufmerksamen Bahndirektor in Köln waren, der uns mit geheiztem Zimmer und Frühstück empfing. Ich ging mit Marie wieder einmal durch den Dom mit immer neuem Entzücken. Bald nach 9 Uhr sausten wir weiter und freuten uns fortwährend über den sehr warmen Tag und die sehr hübschen Gegenden, durch die wir flogen – mit denen ich die gleiche Ueberraschung erlebte wie in Schlesien, dem ich solche Schönheit gar nicht zugetraut. So wunderhübsch wie dort ist’s freilich nicht, aber doch sehr freundlich, voll Abwechselung und recht merkwürdiger Felspartien. Sie kennen es ja alles längst, also sage ich nur, daß ich viel mit Vergnügen hinausgeschaut und Witiko35 wenig las, den ich mir zu Bismarcks hoher Belustigung mitgenommen. Um 9 Uhr fuhren wir glücklich in Paris ein, wurden auf dem Bahnhof von Solms und Lynar empfangen, zum Hotel geleitet und nachher noch bis 11 Uhr spazieren geführt, die Boulevards entlang bis zur Place de la Concorde, Seinebrücke, Tuilleriengarten, Vendomesäule, Notre-Dame, Madeleine und Gott weiß welchen Herrlichkeiten. – Dann soupierten wir mit ihnen in irgendeinem Café und schließlich fanden wir die Ruhe um 1 Uhr. Aber welch ein Unterschied in der Temperatur! Wie kühl und frisch den Abend vorher in Berlin und wie sommerlich warm Abend und Nacht in Paris!
Andern Tages sehr heiß; wir fuhren unter Lynars Schutz durch viele Straßen und durchforschten alle möglichen Läden, die wir aber sämtlich so theuer fanden, daß Berlin sehr hoch in unsrer Achtung stieg. Wir gingen und fuhren bis halb sechs Uhr und jagten um 8 Uhr weiter nach Süden im wundervollen Mondschein, waren aber so müde, daß wir uns nicht viel um mögliche schöne Gegenden kümmerten, sondern sehr bald einschliefen; und ich glaube wir verloren nicht viel, denn gegen Morgen sah es überall recht langweilig aus, so nach Jüterbog, Luckenwalde und dergleichen Sand- und Kiefernsteppen, was bis Bordeaux und drüber hinaus, fast bis Bayonne fortdauert, wobei ich den halben Witiko ausgelesen – recht weitläufig, der echte Ur-Stifter, aber doch nicht uninteressant. Hinter Dax bekommt Frankreich eine anziehendere Physionomie, sehr grün und freundlich, mit den Pyrenäen und dem Meer am Horizont, und bleibt so bis Biarrits. Zuerst war ich hier etwas enttäuscht über die Schattenlosigkeit und die kahlen Felsen all überall, da ich mir fest eingebildet hatte, Kastanienwälder, Feigengärten und allerlei wunderbare breitblättrige südliche Bäume und Pflanzen zu finden. Die Gegend ist durchaus nicht überwältigend schön – fällt ihr gar nicht ein –, aber das Meer und der Himmel unvergleichlich und die Luft so bezaubernd weich, so wunderbar belebend wie nichts wieder, und fortwährend so warm wie die herrlichsten Julitage in Homburg. Morgen, Mittag, Abend, Nacht – immer gleich köstlich –, man hat durchaus keine Idee von solcher Luft bei uns. Bismarck und Marie baden mit Leidenschaft und sind sehr wohl, gottlob – ich werde es vielleicht noch, so Gott will, augenblicklich ist’s nicht besonders. Anfangs war es sogar recht schlimm, nun geht es wieder so mittelmäßig schwächlich weiter.
Von Goltz sehen wir wenig, da er fast immer zu Kaisers eingeladen ist. Der Kaiserin sind wir vorgestellt und damit ist’s nun gut. Sie reist bald ab und Goltz wohl auch. Ich hoffe, wir werden dann Savignys viel sehn, die gestern eingetroffen und recht angenehm sind. Wenn ich nur wieder erst ein bisschen mehr Athem habe, so wollen wir zusammen verschiedene Partien machen, wozu ich mich recht freue. Jetzt kann ich nur bis an den Strand hinunter oder mühsam einen kleinen Felsenhügel hinauf, um mich von der Seeluft durchwehen und stärken zu lassen – Gott gebe doch mit Erfolg! – Ich war in den ersten Tagen hier schrecklich verzagt, weil ich mich unbeschreiblich elend fühlte und mir einige Vorwürfe machte, dem armen Bismarck so viel zu kosten ohne jegliche Hoffnung auf Hilfe.
Er ist heute zum Frühstück bei Ihro Majestät – schon seit drei Stunden dort. Ich finde höchst liebenswürdig und rücksichtsvoll, daß sie uns beide nicht befohlen; hoffe sie wirds auch nie thun. Die kaiserliche Villa liegt unserer höchst reizenden Wohnung gegenüber, hart am Strande, und wer gute Augen hätte, könnte die Frühstücksgesellschaft im Pavillon unaufhörlich beobachten … Grüßen Sie alles Liebe, was Ihnen in den Weg kommt, vor allen natürlich Lulu36 sehr … Marie und Bismarck grüßen viel und Letzterer läßt Ihnen sagen, er schwelgte in dem ungewohnten Genuß, keine Briefe zu bekommen.
Biarrits, den 14. Oktober.
… Jetzt ist der Hof abgereist, Goltz natürlich hinterher, auch Radowitz, der bei näherer Bekanntschaft recht gewinnt. So sind wir nun jeglicher gêne los und leben wie daheim, nur mit Savignys, sonst mit keinem. Mariechen hat sich noch eine russische Freundschaft besorgt, siebzehnjährig und ganz niedlich. Uns fehlt also gottlob nichts wie schönes Wetter, aber da das in Biarrits maßgebender ist wie sonst irgendwo, so fangen wir an, etwas katzenjämmerlich die Häupter hängen zu lassen über den dritten Regentag. Kalt ist es zwar immer noch nicht, im Gegentheil weht ein Zephir wie laues Wässerlein, aber der Regen ist zu schlimm hier und verstimmt uns ziemlich. Bismarck ist sehr einverstanden mit Ihrer Reise nach Schleswig – nur möchten Sie vorsichtig zu Werke gehn, bittet er, damit der Friedländer37 nicht gereizt werde, wozu er ja, wie Sie wissen, große Anlage hat, und ihn deßhalb auf Ihre Hinkunft in geeigneter Weise vorbereiten, ihm die Sache plausibel zu machen, so nett wie möglich. – Die Jagd bei dem Lauenburger Bernstorff Güldensteen tentiert Bismarck sehr und er hofft sicher, der liebenswürdigen Einladung im November folgen zu können, was Sie dem freundlichen Granden wohl gütig gelegentlich sagen, mündlich oder schriftlich. Von Reinfeld habe ich gute Nachricht – gottlob –, aber es friert gründlich dort und man heizt alle Zimmer … Ich möchte den einsamen Jungen gern einige Weintrauben zukommen lassen. Vielleicht ahnt der staatsministerielle Gärtner eine Traubenquelle in Potsdam, aus der man einen kleinen Kanal nach Reinfeld abzweigen könnte – wöchentlich für 1 Thaler; wenn Sie die große Güte hätten, dies zu besorgen, lieber Herr von Keudell, so würden Sie mir eine große Freude machen.
… Bismarck hat 10-mal gebadet und es geht ihm gottlob sehr wohl. Ich könnte sehr viel besser sein und es scheint mir fast, als sei ich in Homburg viel wohler gewesen. Aber die Vergangenheit ist ja immer rosig freundlich – so mag ich mich ja wohl täuschen … Grüßen Sie alle Freundschaft die Ihnen vielleicht begegnet …
Biarrits, 24. Oktober.
… Leider bleibt Biarrits nicht ohne Wolkenschatten – sowohl äußere als innere. Wir haben wunderschöne Tage gehabt und bei 21 Grad Wärme im Schatten eine Partie nach St. Jean de Luce gemacht – reizende Fahrt zwischen dem Meer und den Pyrenäen. Auch sonst hatten wir wohl schöne Tage und Stunden, aber doch viel Regen dazwischen, fast täglich. Und wenn der Himmel grau darein scheint, so macht das den Menschen melancholisch, mich wenigstens, die ich von je her ziemlich wetterlaunisch war. Wenn nun noch dazu der Athem fehlt und man bei jedem kleinen Hügel in keuchenden Zustand geräth, so kann man hier nicht sehr glücklich sein und sehnt sich zurück ins eigene Nest. Das sollte man eigentlich gar nicht verlassen, wenn man sich elend fühlt. Meine Hauptfreude sind die guten Briefe von Reinfeld und Bismarcks Wohlbefinden; gottlob er ist wieder recht gestärkt und erfrischt durch Bäder und Luft … Sehnsucht nach Menschenamüsement hatten wir nicht, da unsre Zeit ganz ausgefüllt war, im Zimmer mit Schreiben und Lesen, draußen – was wir doch so viel wie möglich genossen – mit Anschauen des Meeres und des köstlichen Gebirges, welches ja immer neu ist und immer lieber wird, je öfter man es betrachtet mit seiner wechselnden Farbenpracht.
… Savignys waren vierzehn Tage hier, sehr angenehm, wie immer; seit vorgestern sind sie fort. Orloffs sind nicht gekommen, weil sie aus Angst vor der Cholera Frankreich meiden und an englischer Küste baden wollten. Wir haben das etwas übelgenommen und mucken jetzt mit ihnen …
Ueber Friedland38 hat Bismarck viel an Thile geschrieben, der Ihnen wohl weitere Mittheilung machen wird. Bismarck gab mir den Brief von Thile zu lesen, der mir so sehr gefiel in seinem urgemüthvollen Ton, daß ich ihn noch um 20 Grad wärmer liebe wie schon bisher. Was ist’s doch für eine Freude, wenn man unter der Masse gleichgültiger, langweiliger, falscher Kreaturen einem solchen Menschen begegnet mit so kerngesundem Herzen und so aufrichtig treuer Gesinnung. Bitte, grüßen Sie sehr herzlich ihn, auch Lulu, Loeper und Wolff39, wenn Sie sie sehen …
Biarrits, 29. Oktober 65.
Nun heißt’s „Biarrits ade!“ und Mariechen fügt in großen Mollakkorden hinzu „Scheiden thut weh“. Sie wäre so maßlos glücklich hier, daß sie Homburgs nie mehr gedachte, und hätte ich einen Funken Lust empfunden, den Winter hier zu bleiben, sie wäre mit Wonne dazu bereit gewesen. Ich aber bin glücklich bei dem Gedanken an die Heimkehr und segelte am liebsten ohne Aufenthalt fort und fort, um so bald wie möglich zu Hause zu sein …
Gestern und vorgestern hat’s noch gewaltig gestürmt, so daß die Fenster klirrten und man oft fürchten konnte, mit dem ganzen Hause ins Meer gestürzt zu werden. Und am Morgen war dies aufgeregte Meer, so weit man sehen konnte, wie eine weiße Schneefläche – und wenn der Schaum haushoch (nicht Redensart, sondern Wahrheit) aufspritzte, so schillerte er im hellen Sonnenschein in vielen Regenbogenfarben, und wenn er niederfiel, so jagte ihn der Sturm in großen Flocken wie weiße Tauben weit ins Land hinein. Sie können sich keine Vorstellung machen von dieser Pracht, von der man ganz überwältigt wurde. Und von dem Anblick konnte man sich gar nicht trennen, obgleich man so zerweht und zerzaust wurde, daß man zuletzt frappante Aehnlichkeit mit den Blocksbergbewohnern hatte.
… Uebermorgen nehmen wir nun Abschied von diesem Wunderland, wie Moritz40 es nennt, und gehen mit kleinem Umweg über Pau nach Paris … Bismarck grüßt und wird von Paris über die Zeit der Ankunft in Berlin telegraphieren lassen.“
* * *
Auf holsteinischem Boden sollten nun zum zweiten Mal scheinbar unbedeutende Vorgänge den verhängnisvollen Konflikt vorbereiten.
In Salzburg hatte Graf Moritz Esterhazy geäußert, nach der Gasteiner Konvention könne der Erbprinz von Augustenburg natürlich nur als Privatmann sich in Schleswig-Holstein aufhalten. Manteuffel konnte daher berichten, daß der Gouverneur, Feldmarschallleutnant Freiherr von Gablenz, demselben in Kiel eine entsprechende mündliche Mitteilung gemacht und ihm die königliche Loge im Theater entzogen habe, um sie sich als dem Vertreter des Landesherrn vorzubehalten. Er verbot auch den Zeitungen, ihn als Herzog Friedrich VIII. zu bezeichnen, mahnte sie zur Mäßigung bei Besprechungen der preußischen Politik und warnte gelegentlich vor irgendwelchen öffentlichen Demonstrationen gegen die bestehende Landeshoheit der verbündeten Monarchen. Die sogenannte „herzogliche Landesregierung“ aber, das Kollegium augustenburgischer Beamten, ließ er bestehen und in der bisherigen Weise verwalten, so daß die Zustände im Wesentlichen unverändert blieben. Die Bevölkerung erholte sich bald von dem Schrecken der Gasteiner Konvention und fuhr fort, auf dereinstige Einsetzung des Herzogs durch Oesterreich und den Bund zu hoffen.
Mit Manteuffel trat Gablenz in kameradschaftlichen Verkehr. Mehrere Wochen blieben sie in leidlichem Einvernehmen. Dann aber wurden bei Gelegenheit einer Reise der Frau Erbprinzessin von Altona nach Kiel auf allen Bahnhöfen öffentliche Demonstrationen veranstaltet, welche sie als Gemahlin des Landesherrn ehren sollten, ohne daß dagegen etwas geschah.
Manteuffel speiste bald darauf in Kiel bei Gablenz und hatte eingehende Unterredungen mit ihm wie mit seinem Civilbegleiter, Baron Hofmann.
Nach beider vertraulichen Mitteilungen hatte man in Wien die von Preußen für Erwerbung der Herzogtümer angebotene Geldabfindung definitiv abgelehnt. Man glaubte dort auch zu wissen, daß Preußen noch weitere Pläne habe und die volle Herrschaft in Deutschland auf Kosten Oesterreichs anstrebe. Die augustenburgische Gesinnung der Bevölkerung sei daher zu pflegen, damit man den Pfandbesitz an Holstein zu geeigneter Zeit verwerten und unter Umständen den Erbprinzen als Herzog einsetzen könne. Die Stimmung in Wien sei gereizter gegen Preußen als vor Gastein; man scheue einen Krieg nicht mehr, da es sich um Behauptung der deutschen Stellung des Reiches handele.
Als ich den bezüglichen Bericht Manteuffels las, mußte ich denken, daß die in Wien eingetretene Wandelung wohl durch Mitteilungen des österreichisch gesinnten Ministers Drouyn de Lhuys hervorgerufen worden war.
In Frankreich mußte Bismarck seine Zukunftspläne andeuten, um einer plötzlichen Störung ihrer Ausführung nach Möglichkeit vorzubeugen; in Oesterreich aber hatte er nie darüber gesprochen. Es war daher natürlich, daß die Nachricht, er beabsichtige, die preußische Politik von 1849 wieder aufzunehmen, die österreichischen Minister in heftige Erregung versetzte41.
Ob die Thatsache einer bezüglichen Mitteilung von Drouyn de Lhuys an Metternich dereinst durch ein Aktenstück des Wiener Staatsarchivs bestätigt werden wird, bleibt abzuwarten.
Nach der erwähnten Unterredung mit Gablenz beantragte Manteuffel, früher der wärmste Anhänger der österreichischen Allianz, in mehreren Berichten, von der österreichischen Regierung die Entfernung des Erbprinzen zu verlangen und die Frage zu stellen, ob man mit Augustenburg oder mit Preußen brechen wolle. Der König billigte diese Auffassung und gewöhnte sich mit blutendem Herzen allmählich an den Gedanken eines Bruchs.
Ein neues Aergernis brachte der 23. Januar 1866. In Altona versammelten sich etwa 4000 Männer aus den Herzogtümern und einige süddeutsche Demokraten unter freiem Himmel, beschimpften vielfach die preußische Regierung, verlangten die Einberufung der holsteinischen Stände und brachten ein donnerndes Hoch „dem geliebten Landesherrn Friedrich VIII.“ Dergleichen war selbst von dem gut augustenburgisch gesinnten Baron Halbhuber nicht geduldet worden.
Am 26. Januar sandte Bismarck an Werther einen ausführlichen Erlaß, in welchem die in den letzten Wochen schon mehrmals eingehend begründeten Beschwerden zusammengefaßt wurden. In Gastein sei man übereingekommen, revolutionäre, beide Kronen bedrohende Tendenzen zu bekämpfen. Demnach hätten vor wenigen Monaten beide Mächte den Frankfurter Senat wegen Duldung einer revolutionären Versammlung verwarnt. Nun aber habe unter dem Schutze des österreichischen Doppeladlers in Altona eine gleichartige Volksversammlung getagt. Preußen könne nicht dulden, daß Holstein zum Herde revolutionärer Bestrebungen gemacht und dadurch das im Gasteiner Vertrage Oesterreich anvertraute Pfand deterioriert werde. Solche Eindrücke müßten dahin führen, das von Seiner Majestät dem Könige lange und liebevoll gehegte Gefühl der Zusammengehörigkeit der beiden deutschen Großmächte zu erschüttern. Wir bäten, im beiderseitigen Interesse den Schädigungen, welche das monarchische Prinzip, der Sinn für öffentliche Ordnung und die Einigkeit beider Mächte durch das jetzt in Holstein gehandhabte System erlitten, ein Ziel zu setzen. Es sei ein unabweisliches Bedürfnis für uns, Klarheit in unsere gegenseitigen Verhältnisse zu bringen; habe die kaiserliche Regierung nicht den Willen, auf die Dauer gemeinsame Wege mit uns zu gehen, so müßten wir für unsere ganze Politik volle Freiheit gewinnen.
Die österreichische Antwort (vom 7. Februar) brachte eine in Biegelebens hochmütigem Tone verfaßte kühle Ablehnung. Die Agitation in Holstein habe keinen revolutionären Charakter. Die Verpflichtung Oesterreichs, das anvertraute Pfand unverletzt zu bewahren, könne sich nur auf die ungeschmälerte Erhaltung der Substanz beziehen. Die Verwaltung von Holstein unterliege ausschließlich der Kompetenz der kaiserlichen Regierung; das Verlangen, über einen Akt dieser Verwaltung Rechenschaft zu erhalten, müßte entschieden zurückgewiesen werden.
Nach Empfang dieser Depesche erklärte Bismarck dem Grafen Karolyi in ruhigem Tone, Preußens Beziehungen zu Oesterreich hätten nunmehr den intimen Charakter der letzten Jahre verloren und seien auf denselben Stand zurückgekommen, auf dem sie vor dem dänischen Kriege waren; nicht besser, aber auch nicht schlechter als zu jeder andern Macht.
Eine schriftliche Erwiderung der österreichischen Depesche unterblieb.
* * *
Nachdem im Juni 1865 das Abgeordnetenhaus sich unfähig gezeigt hatte, über Schleswig-Holstein irgendeine Ansicht durch Majoritätsbeschluß zum Ausdruck zu bringen, traten vereinzelte Symptome eines beginnenden Umschwungs der öffentlichen Meinung hervor.
Zu dem Abgeordnetentage, welchen der Frankfurter Ausschuß auf den 1. Oktober einberufen hatte, um den Gasteiner Vertrag für nichtig zu erklären, erschienen unter 272 Abgeordneten nur ein Oesterreicher und 8 Preußen, von denen 6 sich der Abstimmungen enthielten. Bekannte Parlamentarier wie Twesten und Mommsen hatten ihr Erscheinen mit der Begründung abgelehnt, daß sie an Beschlüssen nicht teilnehmen wollten, deren Spitze gegen die Machtentfaltung Preußens gerichtet sein würde.
In der badischen Kammer sagte der liberale Parteiführer Mathy gelegentlich, Bismarck „gefalle ihm mit jedem Tage besser“.
In weiten Kreisen des preußischen Volks schien man der fruchtlosen Redeübungen und Resolutionen überdrüssig und begann man einzusehen, daß der vielgeschmähte „Junker“ nach außen bedeutende Erfolge zu erringen und im Innern sparsam zu wirtschaften vermochte.
Das Abgeordnetenhaus aber zeigte beim Wiederzusammentreten am 15. Januar 1866 ein unverändert böses Gesicht. Der Präsident Grabow gab beim Beginn der Sitzungen der feindseligen Stimmung des Hauses wieder durch heftige Vorwürfe gegen die Staatsregierung Ausdruck. Auf Anregung Virchows empfahl eine Kommission, zu erklären, daß die Vereinigung des Herzogtums Lauenburg mit der Krone Preußen rechtsungültig sei, solange nicht die verfassungsmäßige Zustimmung beider Häuser des Landtags erfolgt wäre.
Man bezog sich dabei auf Artikel 48 der Verfassung, wonach Verträge des Königs mit fremden Regierungen, „wenn dadurch dem Staate Lasten auferlegt werden“, zu ihrer Gültigkeit der Zustimmung der Kammern bedürfen; sowie auf Artikel 55, welcher lautet: „Ohne Einwilligung beider Kammern kann der König nicht zugleich Herrscher fremder Reiche sein.“
Bismarck wies (am 4. Februar) in längeren Ausführungen nach, daß der Ankauf von Lauenburg aus Privatmitteln Seiner Majestät des Königs dem Lande keinerlei Lasten auferlegt habe und daß ein deutsches Ländchen von dem Umfange Lauenburgs nicht als ein „fremdes Reich“ bezeichnet werden könne, ohne sich an der deutschen Sprache und Nationalität zu versündigen. Dann fuhr er fort:
„Daß die Personalunion dem Preußischen Staate Nachteil bringe, habe ich nicht behaupten hören; ich glaube im Gegenteil, sie bringt ihm mehr Vorteile, als ihm die Anwendung des Programms der Februarbedingungen, beispielsweise in Lauenburg, gebracht haben würde, und ich glaube, Sie zollten diesem Programme teilweise Ihre Anerkennung.
„Wäre es nicht, wenn es gelänge, Schleswig-Holstein zu einer Personalunion mit Preußen zu bringen, ein sehr viel erheblicherer Vorteil, als wenn wir bloß die Februarbedingungen dort durchführten? Wäre es nicht ein Vorteil, der bedeutender Opfer, der einiger Staatslasten sogar wert wäre?
„Wenn Ihnen aber, meine Herren, das System der Personalunion nicht gefällt, warum haben Sie es nicht früher gesagt? Ich habe ja im vorigen Jahre von dieser Stelle die dringendste Frage, ich kann wohl sagen die Bitte, an Sie gerichtet: Äußern Sie doch Ihre Ansicht über die Zukunft der Herzogtümer! Ich habe Sie gefragt: Sind Sie mit dem Programm der Februarbedingungen einverstanden? Wünschen Sie, daß es abgeändert, daß etwas hinzugesetzt werde, streben Sie z. B. nach der Personalunion? Ihre Antwort war ein Schweigen, welches ich kaum beredt nennen kann. Sie konnten sich nicht einmal entschließen, darauf zu sagen: wir beharren bei unserem Ausspruch von vor zwei Jahren, wir wünschen noch heute, daß der Prinz von Augustenburg in die Souveränität von Schleswig-Holstein eingesetzt wird.
„Meine Herren! Ich wiederhole diese Frage heute und in diesem Jahre an Sie. Noch ist es Zeit, zwar nicht über Lauenburg, da ist es zu spät, wohl aber in Betreff Schleswig-Holsteins, da sind Sie heut noch in der Lage, Ihrer Meinung und der des Volkes, welches Sie vertreten, Geltung zu verschaffen: so sprechen Sie doch im Namen des Volkes, was Ihre Ansicht über Schleswig-Holsteins Zukunft ist!“
„Interessiert Sie diese Frage gar nicht? Sie interpellieren uns darüber, Sie legen uns bei jeder Gelegenheit, bei jedem Schritte, den wir thun, Schwierigkeiten in den Weg; aber Sie verheimlichen Ihre eigene Meinung über die Frage sorgfältig.
„Nun, meine Herren, wenn Sie auch in diesem Jahre darüber schweigen, dann beklagen Sie sich auch nachher nicht, wenn wir auf die von Ihnen verschwiegene Meinung keine Rücksicht nehmen können.“
Diese Aufforderung hatte keinen Erfolg; der Kommissionsantrag aber wurde mit 251 gegen 44 Stimmen angenommen. Ebenso später zwei Resolutionen, betreffend eine Entscheidung des Obertribunals und einen polizeilichen Vorgang.
Diese drei Resolutionen wurden durch den Präsidenten dem Staatsministerium übersandt, von diesem aber wegen der darin enthaltenen Ueberschreitungen der Kompetenz des Hauses wieder zurückgeschickt. Von ferneren Beratungen der Abgeordneten war nach diesen Vorgängen Ersprießliches nicht zu erwarten; der Landtag wurde daher am 22. Februar geschlossen.
Bald darauf (am 28.) trat in Gegenwart des Königs und des Kronprinzen ein Ministerrat zusammen, welchem auch Graf Goltz sowie die Generale Moltke, Manteuffel und Gustav Alvensleben beiwohnten. Nur der Kronprinz und Bodelschwingh empfahlen wie im vorigen Jahre, Verständigung mit Oesterreich zu suchen. Alle anderen Anwesenden stimmten darin überein, daß in Schleswig-Holstein nicht nachzugeben und eine kriegerische Lösung als wahrscheinlich ins Auge zu fassen sei. Moltke entwickelte dabei die Ansicht, daß auf einen günstigen Erfolg mit einiger Sicherheit nur dann zu rechnen wäre, wenn Italien in den Krieg einträte. In diesem Falle würde Oesterreich nicht mehr als 240.000 Mann in Böhmen aufzustellen vermögen.
* * *
Schon im Januar hatte Bismarck an Usedom geschrieben, daß der Zeitpunkt der Krise voraussichtlich näher heranrücke; der Grad der Sicherheit und der Umfang dessen, was wir von Italien zu erwarten hätten, würde von wesentlichem Einfluß auf unsere Entschließungen sein, ob wir nämlich es zur Krise kommen ließen oder uns mit geringeren Vorteilen begnügten. Die deutsche Frage ruhe einstweilen; bei weiterer Entwickelung der Beziehungen Oesterreichs zu den Mittelstaaten mit aggressiver Tendenz gegen Preußen könne jedoch leicht eine Wendung eintreten, welche den Bestand des Bundes in Frage stellte. Wenn z. B. die holsteinischen Stände gegen unseren Willen zu antipreußischen Zwecken zusammenberufen werden sollten, so würden wir auf diese Regungen des Partikularismus mit Anrufung der nationalen Gesamtinteressen antworten und die Basen wieder betreten, welche s. Zt. dem Frankfurter Fürstentage entgegengesetzt wurden. Wir hätten keinen Grund, anzunehmen, daß bei Regelung der deutschen Angelegenheiten die Haltung Frankreichs uns feindselig sein würde; sollte sie aber auch bedenklich werden, so wäre das nur ein Anlaß mehr, uns auf die tiefere nationale Basis zurückzuziehen und die dort vorhandenen Kräfte uns zu verbünden.
Nach längerem Schwanken La Marmoras konnte Usedom am 24. Februar telegraphieren, König Victor Emanuel sei zum Kriege gegen Oesterreich bereit, wenn man sich vorher über die Ziele des Krieges verständigt haben würde.
Es kam nun hierbei wesentlich auf die Haltung des Kaisers Napoleon an. Auf Befehl des Königs entwickelte Goltz vor demselben Anfang März das Programm einer engeren Verbindung der norddeutschen Staaten, betonte, daß die Führung der Südstaaten Bayern zu überlassen sei, und versuchte, den Kaiser zu einer Aeußerung darüber zu bewegen, welche Schritte er zu thun gedächte, um das französische Nationalgefühl mit einer wesentlichen Verstärkung der preußischen Machtstellung auszusöhnen.
Der Kaiser gab seiner vollen Sympathie mit diesem nationalen Programm Ausdruck, lehnte jedoch ab, jetzt schon ein Kompensationsobjekt zu bezeichnen. In Belgien herrsche vollkommene Ruhe; die Schweiz anzugreifen, sei schwierig, in den deutschen Grenzlanden sollten mit Ausnahme Rheinbayerns keine französischen Sympathien vorhanden sein. Marschall Niel wünsche die Grenzen von 1814 (Landau und Saarbrücken); aber die Abneigung des Königs gegen Abtretung deutschen Gebiets erschwere die Wahl.
Goltz schloß den bezüglichen Bericht mit der Vermutung, der Kaiser werde für Erwerbung der Herzogtümer keine Kompensation, bei größerem Machtzuwachs Preußens aber die Grenzen von 1814 verlangen.
Umgehend antwortete Bismarck, der Kaiser sei falsch berichtet, wenn er an französische Sympathien in Rheinbayern glaube; von Abtretung deutschen Landes könne unter keinen Umständen die Rede sein. Goltz möge die Frage ruhen lassen, bei Anregung von französischer Seite aber entschieden alles ablehnen, was das deutsche Nationalgefühl verletzen könnte.
Die erwähnte Audienz des Grafen Goltz bei Napoleon hatte jedoch die Folge, daß der Kaiser dem italienischen Ministerpräsidenten empfahl, ein Schutz- und Trutzbündnis mit Preußen zu schließen. Zu diesem Zwecke traf General Govone am 14. März in Berlin ein mit der Instruktion, das Bündnis so zu gestalten, daß Preußen im Falle eines italienischen Angriffs auf Venetien zu sofortiger Kriegserklärung verpflichtet wäre. Aber weder Bismarck noch der König waren gesonnen, die Entscheidung über den Kriegsfall aus der Hand zu geben. Die Verhandlung stockte, da La Marmora argwöhnte, Bismarck wolle einen Vertrag mit Italien nur zu dem Zwecke schließen, um von Oesterreich neue Konzessionen zu erpressen. Ein Scherz Bismarcks mit einer liebenswürdigen Dame hatte aber so ernste Folgen, daß Govone seinen Minister um neue Instruktionen bat.
Nach dem erwähnten Ministerrat vom 28. Februar hatten Unberufene erzählt, es sei in demselben baldiger Angriff auf Sachsen und Oesterreich beschlossen worden. Die Gemahlin des sächsischen Gesandten, Gräfin Hohenthal, richtete nun an Bismarck die Frage, ob es denn wahr sei, daß er so böse Absichten hege. „Natürlich,“ sagte er, „seit dem ersten Tage meines Ministeriums habe ich keinen andern Gedanken gehabt; Sie werden bald sehen, daß wir besser schießen als unsre Gegner.“ Da erbat die Gräfin einen freundschaftlichen Rat, wohin sie flüchten solle, auf ihre Besitzung in Böhmen oder auf ihr Gut bei Leipzig.
„Ich kann nur empfehlen,“ sagte Bismarck, „nicht nach Böhmen zu gehen, denn gerade in der Nähe Ihres dortigen Besitzes werden wir die Oesterreicher schlagen; und da wird es mehr Verwundete geben, als Ihre Leute pflegen können. Aber auf Ihrem sächsischen Schlosse werden Sie nicht einmal durch Einquartierung belästigt werden, da Knautheim nicht an einer Etappenstraße liegt.“
Am folgenden Tage erwiderte Bismarck auf Anfragen einiger Diplomaten, die Verspottung einer naiven Frage dürfe man doch nicht ernst nehmen.
Beust aber, dem Hohenthal das Tischgespräch berichtet hatte, rief Oesterreichs Schutz an und versicherte, daß alle Mittelstaaten zu ihm stehen würden.
In Wien war gerade ein Marschallsrat (vom 7. bis 13. März) versammelt, um über die Opportunität des Beginnes von Rüstungen zu entscheiden. Mensdorff und Esterhazy sprachen dagegen; die Depesche Beusts aber verschaffte den Generalen das Uebergewicht, und man beschloß, die Garnisonen in Böhmen bis auf ungefähr 80.000 Mann zu verstärken.
Am 16. März stellte Graf Karolyi amtlich an Bismarck die Frage, ob Preußen beabsichtige, die Gasteiner Konvention zu brechen und den Bundesfrieden zu stören. Bismarck antwortete:
„Nein! Wir wünschen im Gegenteil, daß Oesterreich die Verträge von Wien und Gastein genauer beobachte.“
Auf Erkundigung über unsere Rüstungen erhielt Karolyi die sachgemäße Antwort, daß dazu in keiner Weise irgendein Anfang gemacht worden sei. Der Gesandte versicherte darauf, daß, wenn, was er nicht wisse, in Oesterreich einige Rüstungen stattfänden, sie nur defensiven Zweck haben könnten, da man nicht im Entferntesten daran denke, Preußen anzugreifen. „Solche defensive Vorbereitungen,“ sagte Bismarck, „sind für uns immer eine Gefahr; hat Oesterreich einmal 150.000 Mann an den Grenzen zusammen, so ist ein Grund zum Bruche leicht gefunden. Das haben wir 1850 erlebt.“
Ohne Karolyis Bericht über diese Unterredung abzuwarten, hatte Mensdorff am 16. März ein Rundschreiben an die deutschen Regierungen abgesandt, worin er ankündigte, was geschehen werde, wenn Bismarck auf die zu stellende Frage ungenügende Antwort gäbe. Dann wolle Oesterreich beim Bunde beantragen, über Schleswig-Holstein zu entscheiden, und, falls Preußen sich dieser Entscheidung widersetze, das Bundesheer mobilzumachen.
Dieser Operationsplan wurde uns natürlich bald bekannt. Bismarck gab darauf den Gesandten an den deutschen Höfen genaue Nachrichten über die Verstärkungen und die Verschiebungen österreichischer Truppenteile nach Norden, erklärte, daß solcher Bedrohung gegenüber wir Deckungsmaßregeln würden ergreifen müssen, und fragte, ob, im Falle sich hieraus ein österreichischer Angriff entwickele, wir auf die Hilfe der Bundesgenossen zählen dürften.
Endlich am 27. März, in der dritten Woche nach dem Beginne der österreichischen Rüstungen, beschloß ein Ministerrat unter Vorsitz des Königs: Armierung der schlesischen Festungen, Ankauf von Artilleriepferden und Verstärkung einiger Truppenteile um im Ganzen 11.000 Mann, jedoch keinerlei Vorschiebungen von Truppen nach der Grenze hin.
Alle diese Vorgänge verringerten das natürliche Mißtrauen des Generals Govone und des italienischen Gesandten Grafen Barral. Die italienischen Wünsche in Betreff der zum deutschen Bundesgebiete gehörigen Bezirke von Trient und Triest lehnte Bismarck zwar entschieden ab, stellte aber die Erwerbung Veneziens in sichere Aussicht. Zugleich betonte er wiederholt, daß es lediglich von Italiens Entschließung in Betreff des Vertrages abhänge, ob es zum Kriege komme oder nicht, da der Weg zur Verständigung noch immer offen sei. Nachdem nun auch der Kaiser Napoleon dem italienischen Minister dringend empfohlen hatte, den Vertrag abzuschließen, kam es endlich am 8. April zu einem Bündnis auf drei Monate, während welcher Italien in den Krieg eintreten sollte, falls in dieser Frist Preußen eine Kriegserklärung gegen Oesterreich verkündete.
* * *
Am Tage nach der Unterzeichnung des italienischen Bündnisses erhielt Savigny telegraphische Weisung, den seit längerer Zeit vorbereiteten Antrag auf Einberufung eines aus direkter Volkswahl hervorgehenden Parlamentes in der Bundesversammlung einzubringen.
Wie erwähnt, hatte Bismarck schon im März 1862 (in Petersburg) von der Nützlichkeit eines deutschen Parlamentes gesprochen, und im September 1863 hatte auf Antrag des Staatsministeriums der König den Bundesfürsten erklärt, daß ein Parlament zu den Vorbedingungen gedeihlicher Bundesreform gehöre. Ein fester Plan über die Gestaltung der Reichsverfassung war jedoch bei Einbringung des bezüglichen Antrags an den Bundestag noch nicht gefaßt.
Friedjung meint (I, S. 161), daß Bismarck „mit Lothar Bucher42 den Plan zu einer deutschen Reichsverfassung unter thätiger Mitwirkung der Nation“ entworfen habe. Diese Vermutung bedarf der Widerlegung, weil sie ein unrichtiges Bild von Bismarcks Schaffen geben kann. Nur beiläufig sei erwähnt, daß Bucher damals ausschließlich mit der Verwaltung von Lauenburg beschäftigt war und erst im Dezember 1866 zur Ausarbeitung der Verfassung des Norddeutschen Bundes herangezogen worden ist; wichtig aber scheint mir, festzustellen, daß Bismarck, soweit meine Wahrnehmungen reichen, niemals irgendeinen Plan in Gemeinschaft mit einem seiner Räte erwogen oder entworfen hat.
„Zu erfinden, zu beschließen,
Bleibe, Künstler, oft allein.“
Bismarcks Künstlernatur forderte einsames Schaffen. Sein überreicher Geist bot ihm für jedes Problem verschiedene Wege der Erfindung und des Rats. In der heißen Glut seiner Vaterlandsliebe schmolzen auch spröde Stoffe, so daß er sie kneten und formen konnte. Bei dieser rastlosen inneren Arbeit war ihm der Rat anderer Menschen unwillkommene Störung. Immer bestrebt, zu lernen, nahm er thatsächliche Mitteilungen gern entgegen, ließ auch die täglich durch Menschenverkehr, Geschäfte und Presse herantretenden Eindrücke unbefangen auf sich wirken, verhielt sich aber kritisch oder ablehnend, wenn irgendjemand Rat zu geben versuchte. In Kleinigkeiten konnte er auch fremde Gedanken gelegentlich benutzen; so ließ er in Abekens Entwürfen manche nicht von ihm angegebene Nebengedanken desselben gelten; in den wesentlichen Zügen aber wie in allen wichtigen Fragen kam das fast niemals vor. Nur eines solchen Falles kann ich mich erinnern. Im Jahre 1871 bei Vorbereitung der preußischen Kreisordnung geschah es, daß er einige Vorschläge, die Gneist ihm abends in seinem Kabinett unterbreitete, guthieß und in amtliche Behandlung nahm.
Seine Ziele waren, wie bekannt, anfangs die Sicherung und Erhöhung der preußischen Macht, dann die Gründung eines norddeutschen Bundesstaates.
Für jede der tausendfachen Aufgaben, die auf den Wegen dahin herantraten, fand er mehrere Lösungen. Hatte er darunter gewählt, was oft in wenigen Minuten, manchmal aber erst nach jahrelanger Ueberlegung geschah, so mußte er in den meisten Fällen seine Ansicht dem Könige annehmbar zu machen versuchen, in anderen, weniger häufigen seine Kollegen, die Staatsminister, von der Richtigkeit seiner Auffassung überzeugen.
Die in jenen Jahren tägliche Wiederkehr der mündlichen Vorträge beim Könige erleichterte sehr, daß etwa hervortretende Gegensätze der Anschauungen sich ausglichen. Gewöhnlich war ihm die Stunde von 4 bis 5 Uhr, in der er dem schwärmerisch verehrten Herrn vorzutragen pflegte, die erfreulichste des Geschäftstages. Dennoch kam es, wie bekannt, mitunter zu ernsten Friktionen. In seltenen Fällen lehnte der König seine Anträge völlig ab wie in der erwähnten Frage der Ablösung persönlichen Militärdienstes durch Stellvertretungsgelder. Häufig aber kam es vor, daß der König seinem Antrag eine etwas veränderte Richtung gab. Bismarck brauchte mitunter das Bild, es sei durch die Einwirkung des königlichen Willens auf den seinigen wie im Parallelogramme der Kräfte die praktisch richtige Diagonale gefunden worden. Wäre es möglich, derartige Thatsachen nachträglich festzustellen, so würde vermutlich meine Meinung sich als richtig erweisen, daß der Einfluß Seiner Majestät auf Bismarcks politische Entschlüsse ein viel bedeutenderer gewesen ist, als von vielen angenommen wird.
Widerspruch seiner Kollegen im Staatsministerium war ihm äußerst unerfreulich. Vielerfahrene Sachverständige zu überzeugen ist schwierig; darüber hat er oft geklagt. Die kollegialische Verfassung des preußischen Staatsministeriums, in welchem Stimmenmehrheit entschied, war ihm ein Gräuel. Er hätte in allen Staatsgeschäften zu seiner Hilfe nur Sekretäre gewünscht, wie es seine vortragenden Räte thatsächlich waren. Die Opposition des Landtages war ihm natürlich auch unangenehm, verstimmte ihn aber, wie mir schien, lange nicht so sehr wie die der Minister.
* * *
Als am 9. April 1866 in Frankfurt der Antrag auf ein deutsches Parlament eingebracht wurde, lag noch kein Bundesverfassungsentwurf vor. Bismarck sah voraus, daß Verhandlungen über einen solchen am Bundestage nie zu Ende kommen würden, und machte deshalb zuerst nur den Vorschlag, sogleich einen festen Termin für die Einberufung des Parlaments zu beschließen. Erst auf Bitten vonseiten befreundeter Höfe ermächtigte er Savigny, in der Bundesversammlung am 11. Mai mündlich einige Grundzüge der künftigen Bundesverfassung mitzuteilen. Die Mäßigung in diesen Andeutungen ging so weit, daß eines künftigen Bundesoberhauptes gar keine Erwähnung geschah. Savignys Mitteilungen machten einen so günstigen Eindruck, daß man trotz des Widerspruches von Oesterreich und Darmstadt beschloß, neue Instruktionen einzuholen.
Im April wurde der preußische Antrag auf Einberufung eines deutschen Parlamentes fast überall mit Mißtrauen und Hohn begrüßt. Nur die zweite Kammer Badens erklärte sich einverstanden. Aber beispielsweise die in Neumünster versammelten Ausschüsse schleswig-holsteinischer Vereine weissagten wörtlich: „Es steht fest, daß ein Gewährenlassen der verabscheuungswürdigen Politik des preußischen Kabinetts Deutschland unrettbar dem tiefsten Verfall preisgeben würde.“
An der Pariser Börse gab es Panik und starke Verluste einflußreicher Leute. Allgemein wurde nicht Oesterreich, welches die Rüstungen begonnen hatte, sondern Preußen, welches den Status quo verändern wollte, als der Störenfried angeklagt, und wohl mit Grund. Als Goltz wegen einer möglichen Aenderung unserer Politik anfragte, antwortete Bismarck, es wäre höchst bedenklich, Systeme und Ziele willkürlich zu wechseln, besonders aber, Entschließungen, deren Durchführung mit Gefahren verknüpft sei, bei Annäherung der Gefahr wieder aufzugeben.
Nach dem ersten bescheidenen Anfang unserer am 27. März beschlossenen Rüstungsmaßregeln wurde von Oesterreich eine Korrespondenz wegen beiderseitiger Abrüstung eingeleitet. Eine der bezüglichen Depeschen (vom 7. April) war inhaltlich so wenig begründet und in der Form so hochfahrend, daß der russische Gesandte, Baron Oubril, welcher für den Frieden zu wirken angewiesen war, seinen Wiener Kollegen ersuchte, bei Mensdorff die Zurückziehung dieses Schriftstückes anzuregen. Das gelang natürlich nicht; Bismarck aber antwortete in höflichem Tone, unsere Abrüstung würde Zug um Zug der österreichischen folgen.
Da wurde in Wien plötzlich die Mobilmachung der ganzen Südarmee beschlossen. Es waren merkwürdigerweise wieder ungenaue Nachrichten gewesen, welche diesen entscheidenden Schritt veranlaßten.
Der englische Gesandte in Wien, Lord Bloomfield, meldete nämlich, daß nach Mitteilung seines Florentiner Kollegen, Sir Henry Elliot, eine Verstärkung der italienischen Armee um etwa 100.000 Mann im Gange wäre, während nichts anderes vor sich ging als die gewöhnliche Rekrutenaushebung von jährlich 80.000 Mann. Aus Venedig aber kam die Nachricht, Garibaldi sei mit Freischaren in die Provinz Novigo eingebrochen. Beide Meldungen wurden nach wenigen Tagen widerrufen; aber die Mobilmachungsbefehle waren infolge jener Gerüchte bereits am 21. April abgegangen43. Nun konnte auch bei uns von Abrüstung nicht mehr die Rede sein. Am 26. folgten in Oesterreich die Befehle zur Mobilmachung der Nordarmee.
La Marmora ließ an demselben Tage anfragen, was wir zu thun gedächten, wenn Oesterreich Italien angriffe, und erhielt von Bismarck die Zusage, daß wir in diesem Falle in den Krieg eintreten würden, obgleich der Vertrag uns hierzu nicht verpflichte. Darauf wurde am 27. die Mobilmachung der italienischen Armee befohlen.
Am 28. April übergab Graf Karolyi eine Depesche, welche nochmals die Einsetzung des Erbprinzen von Augustenburg als Herzog von Schleswig-Holstein unter den im vorigen Jahre zugestandenen Bedingungen anbot, für den Fall der Ablehnung aber Abgabe der Streitfrage an den Bund und Einberufung der holsteinischen Landstände in Aussicht stellte. Diese Aufkündigung des Gasteiner Vertrages blieb unbeantwortet; vom 3. Mai ab wurden jedoch endlich auch bei uns die einzelnen Armeekorps nach und nach mobilgemacht.
* * *
Während im Kabinett des Ministers rastlos für den Krieg gearbeitet wurde, herrschte am Kaminfeuer des großen Wohnzimmers die friedliche und heitere Stimmung der früheren Jahre – der Kreis der häufig erscheinenden Abendgäste hatte sich nicht wesentlich vergrößert.
Die Gräfin war im Herbste mehrfach leidend gewesen, empfand aber im Winter günstige Nachwirkungen von Homburg und Biarrits. Sie konnte mitunter in Konzerte gehen, deren damals frühe Stunden es ihr möglich machten, bald nach 9 Uhr am Theetisch zu walten. Oper und Schauspiel blieben jedoch der unvermeidlichen Verspätung wegen ausgeschlossen.
Am Geburtstage der Gräfin (dem 11. April) ließ ich immer im Kuppelsaale des Ministeriums Orchestermusik machen. Im Jahre 1866 wurde u. a. Beethovens C-Moll-Symphonie ausgeführt, deren heroischer letzter Satz auf den Minister großen Eindruck machte. Doch war die in einem vielgelesenen Romane vorkommende Erzählung, er sei durch ein Musikstück zur Entscheidung für den Krieg bestimmt worden, natürlich Dichtung und zwar eine mit seinen Eigenschaften unvereinbare. Die Entscheidung politischer Fragen ist von ihm immer durch kühle Berechnung gefunden, niemals durch augenblickliche Gemütsstimmung beeinflußt worden. Daneben ist gewiß, daß, als der seit 14 Jahren vorausgesehene Entscheidungskampf herannahte, seine Seele in leidenschaftlicher Erregung glühte, deren notwendige Beherrschung mitunter seine Gesundheit angriff. Seit dem Januar hatte er die gewohnte Stärkung durch Jagden entbehren müssen und war dadurch anfälliger geworden. Als am 23. März gegenüber den österreichischen Rüstungen unsererseits noch nichts geschehen war, erkrankte er, gesundete aber, sobald am 27. die erwähnten ersten Rüstungsbefehle ergingen. Ebenso kränkelte er um Mitte April, während über die beiderseitige Abrüstung viel geschrieben werden mußte, erholte sich aber bald nach Eingang der Meldung von der Mobilmachung der österreichischen Südarmee.
Wenn er am späten Abend die Thüre seines Arbeitszimmers öffnete und durch das kleine, offene Kabinett in das Wohnzimmer trat, war er immer heiter und guter Dinge. Gewöhnlich führte er die Unterhaltung, sprach aber nicht über Tagesfragen. Die Gräfin war natürlich mit seinen Bestrebungen vertraut, doch suchte er ihr Kenntnis der täglichen, oft unerfreulichen Zwischenfälle zu ersparen. Im Familienkreise kein Wort von Politik zu hören und von harmlosen Dingen zu sprechen, war ihm Erquickung.
Am 7. Mai kam er wie gewöhnlich nach 5 Uhr aus dem königlichen Palais zurück, hielt sich aber länger als sonst in seinem Kabinett auf, um einen kurzen Bericht an Seine Majestät zu schreiben, und trat dann mit einer Entschuldigung seiner Verspätung in den Salon. Ehe man sich zu Tische setzte, küßte er seine Gemahlin auf die Stirn und sagte: „Erschrick nicht, mein Herz, es hat jemand auf mich geschossen, ich bin aber durch Gottes Gnade unverletzt geblieben.“
So erzählte mir bald nachher einer der Tischgenossen.
Vor Abend kamen der König, die königlichen Prinzen und viele Würdenträger, um den wunderbar Erretteten zu begrüßen.
Abends erzählte er in kleinem Kreise den Hergang ungefähr mit diesen Worten:
„Ich ging unter den Linden auf dem Fußweg zwischen den Bäumen vom Palais nach Hause. Als ich in der Nähe der russischen Gesandtschaft gekommen war, hörte ich dicht hinter mir zwei Pistolenschüsse. Ohne zu denken, daß mich das anginge, drehte ich mich unwillkürlich rasch um und sah etwa zwei Schritte vor mir einen kleinen Menschen, der mit einem Revolver auf mich zielte. Ich griff nach seiner rechten Hand, während der dritte Schuß losging und packte ihn zugleich am Kragen. Er faßte aber schnell den Revolver mit der linken, drückte ihn gegen meinen Ueberzieher und schoß noch zweimal. Ein unbekannter Civilist half mir ihn festhalten. Es eilten auch sogleich Schutzleute herbei, die ihn abführten, zusammen mit einer Patrouille vom zweiten Garderegiment, die zufällig des Weges kam.
„Als Jäger sagte ich mir: Die letzten beiden Kugeln müssen gesessen haben, ich bin ein toter Mann. Eine Rippe that zwar etwas weh, ich konnte aber zu meiner Verwunderung bequem nach Hause gehen. Hier untersuchte ich die Sache. Ich fand Löcher im Ueberzieher, im Rock, Weste und Hemde; an der seidenen Unterjacke aber waren die Kugeln abgeglitten, ohne die Haut zu verletzen. Die Rippe schmerzte etwas wie von einem Stoß, das ging aber bald über. Es kommt bei Rotwild vor, daß eine Rippe elastisch federt, wenn die Kugel aufschlägt. Man kann nachher erkennen, wo sie abgeglitten ist, weil da einige Haare fehlen. So mag auch meine Rippe gefedert haben. Oder vielleicht ist die Kraft der Schüsse nicht voll entwickelt worden, weil die Mündung des Revolvers unmittelbar auf meinen Rock drückte.“
Alle Anwesenden waren in feierlicher Stimmung, als hätten sie Uebernatürliches erlebt. Bismarck aber zergliederte den Fall mit einer Ruhe, als handelte es sich um ein gleichgültiges Vorkommnis.
Am folgenden Tage wurde bekannt, daß der Verbrecher namens Cohen-Blind, der von London gekommen war, um Bismarck zu erschießen, im Gefängnisse sich durch Oeffnen einer Pulsader getötet hatte.
Als abends der kleine Kreis der Hausfreunde wieder versammelt war, meldete ein Diener, daß vor dem Hause große Menschenmassen sich bewegten. Man ging in den chinesischen Saal und öffnete die Fenster nach der Straße. Ueber die Stimmung des Berliner Volkes war früher Erfreuliches nicht bekannt geworden; jetzt aber ertönte unaufhörlich der Ruf: „Bismarck hoch!“ Er sprach aus dem Fenster mit erhobener Stimme ungefähr folgende Worte:
„Meine Herren und Landsleute, herzlichen Dank für diesen Beweis Ihrer Teilnahme. Für unsern König und das Vaterland das Leben zu lassen, ob auf dem Schlachtfelde oder auf dem Straßenpflaster, halte ich für ein hohes Glück und erflehe von Gott, daß mir ein solcher Tod vergönnt sei. Für jetzt hat Er es anders gewollt; Gott hat gewollt, daß ich noch lebendig meinen Dienst thun soll. Sie teilen das patriotische Gefühl mit mir und Sie werden gern mit mir rufen: Seine Majestät, unser König und Herr, er lebe hoch!“
Die Folge des Attentats war eine gehobene Stimmung Bismarcks. Mehrmals hatte ich den Eindruck, daß er sich jetzt als Gottes „auserwähltes Rüstzeug“ fühlte, um seinem Vaterlande Segen zu bringen. Ausgesprochen aber hat er das nicht.
In den nächsten Tagen, während die Mobilmachungen überall ausgeführt wurden, kam unter andern Fürsprechern des Friedens Herr Abraham Oppenheim als Vertreter von 17 rheinischen Handelskammern nach Berlin. Er wurde von Bismarck empfangen und trug die Bitte vor, wenn der Krieg unvermeidlich wäre, möchte vorher mit dem Landtag Frieden gemacht werden. Der Minister erwiderte inhaltlich Folgendes:
„Ich hege den Wunsch nach Aussöhnung mit dem Landtage, ehe vielleicht ein großer Konflikt unvermeidlich wird, so lebhaft wie irgendjemand. Meine verhaßte Person würde aber ein Hindernis der Verständigung sein; ich habe deshalb vor einiger Zeit den König gebeten, statt meiner den Fürsten von Hohenzollern zum Ministerpräsidenten zu ernennen und mir den Posten eines Unterstaatssekretärs im auswärtigen Ministerium zu geben. In dieser Stellung würde ich meine Erfahrungen im auswärtigen Dienst ebenso verwerten können wie als Minister, und der Fürst würde mir wohl freie Hand lassen. Der König hat aber auf diesen Gedanken nicht eingehen wollen. Er hat dagegen Neuwahlen zum Abgeordnetenhause anzuordnen befohlen, und wir müssen zunächst diese abwarten.“
Auflösung des Hauses und Vorbereitung von Neuwahlen waren am 9. Mai verfügt worden. Herr Oppenheim erzählte diese Unterredung an demselben Abend in Ausdrücken höchster Bewunderung seinem Freunde Bleichröder, welcher mir am anderen Morgen darüber berichtete. Eine Bestätigung der Thatsache, daß Bismarck dem Könige jenen Vorschlag unterbreitet hat, ist mir nicht zuteilgeworden44. Doch hielt ich die Angaben Oppenheims wie den Bericht Bleichröders für zweifellos glaubwürdig und freute mich ebenso sehr, daß Bismarck den selbstlosen Antrag gestellt wie daß der König ihn abgelehnt hatte.
Damals gingen Strömungen weichlicher, ganz unpreußischer Gefühle durch das Land. Hervorragende Mitglieder der konservativen Partei setzten alle erlaubten Mittel in Bewegung, um den Krieg zu verhindern. Nicht nur 17 rheinische Handelskammern und eine Kölner Volksversammlung petitionierten um Erhaltung des Friedens, sondern auch 4 Wahlbezirke Berlins und die Stadtbehörden von Stettin, Köslin und Königsberg. Der Abgeordnetentag in Frankfurt und der Ausschuß des Nationalvereins erklärten übereinstimmend, die einzige zur Lösung der obwaltenden Schwierigkeiten berufene Behörde sei ein deutsches Parlament; sie verdammten aber gleichzeitig den Minister, der ein solches amtlich beantragt hatte, und den Krieg, welcher der Durchführung dieses Antrages unerläßlich vorhergehen mußte.
Nur zwei verständige Kundgebungen wurden in jener Zeit bekannt: eine Adresse der Altliberalen in Halle und die bereits früher erwähnte der Stadtbehörden von Breslau.
Schlesien war die der Gefahr eines feindlichen Ueberfalles am meisten ausgesetzte Provinz. Dennoch schrieben die Breslauer am 15. Mai. an Seine Majestät den König, man wolle lieber alle Lasten und Leiden eines Krieges auf sich nehmen als erleben, daß die Lösung der historischen Aufgabe Preußens, die Einigung Deutschlands, noch einmal – wie es 1850 geschehen – auf lange Jahre hinausgeschoben würde. Es fehle zwar, da der innere Konflikt nicht gelöst sei, an der allgemeinen Begeisterung, wie sie 1813 herrschte; dennoch aber würden die schlesischen Männer mit derselben Opferwilligkeit wie damals den Gefahren und Nöten des Krieges entgegengehen.
Der König gab in einem huldvollen Erlaß vom 19. Mai der Freude über das Wiedererwachen des schlesischen Geistes von 1813 ernsten Ausdruck und bezeichnete als das Ziel seiner Wünsche eine Verständigung zwischen der Regierung und dem neu zu wählenden Abgeordnetenhause.
Im Monat Mai schwebte noch eine geheime Verhandlung zwischen den Höfen von Berlin und Wien, welche während einiger Tage Frieden zu verheißen schien. Baron Anton Gablenz, ein in Preußen angesessener Bruder des Generals, hatte einen Vertragsentwurf auf folgenden Grundlagen ausgearbeitet: In Schleswig-Holstein wäre Prinz Albrecht von Preußen als Herzog einzusetzen, der Oberbefehl des Bundesheeres zwischen Preußen (für die nördlichen) und Oesterreich (für die südlichen Armeekorps) zu teilen, diese Reform aber dem Bunde aufzudrängen. Die besonders für Oesterreich nützlichen Spezialbedingungen lasse ich unerwähnt.
Gablenz wurde durch seinen Bruder bei Graf Mensdorff eingeführt, der ihn freundlich anhörte, und kam dann nach Berlin. Daß Bismarck die schließliche Annahme dieser Lösung in Wien für wahrscheinlich gehalten hat, glaube ich nicht; er sprach sich darüber nicht aus, behandelte aber die Sache geschäftlich mit ernster Gründlichkeit und brachte verschiedene Verbesserungen in den Entwurf. Gablenz reiste hin und her und wurde von beiden Monarchen mit Wohlwollen empfangen, erhielt aber schließlich in Wien den Bescheid, er komme mit seinen Vorschlägen um acht Wochen zu spät. Man hatte sich den hilfsbereiten Mittelstaaten gegenüber schon zu fest engagiert, um sie plötzlich wie Gegner behandeln zu können; auch war die Preußen zugedachte Machtsphäre offenbar viel bedeutender als die südliche.
Schon vor dem Beginn der Besprechungen mit Gablenz hatte Mensdorff dem Kaiser Napoleon angeboten, Venetien abzutreten, sobald Schlesien erobert sein werde; später ließ er diese Vorbedingung fallen und verhieß Venetien schon vor Beginn des Krieges, wenn nur die Neutralität Italiens gesichert werden könnte. Napoleon empfahl diese Lösung; aber Visconti Venosta erklärte sofort einen solchen Vorschlag für unannehmbar und hielt fest am preußischen Bündnis.
Der Kaiser nahm nun seinen mehrmals geäußerten Lieblingsgedanken wieder auf, durch einen europäischen Kongreß die schwebenden Fragen zu lösen: die venetianische, die schleswig-holsteinische und die deutsche Bundesreform. Bismarck hielt diesen Plan zwar für aussichtslos, aber nicht für geraten, Besprechungen darüber abzulehnen.
Inzwischen erfuhren wir, daß die französischen Gesandten in den Mittelstaaten und in Frankfurt eine gegen uns entschieden feindliche Sprache führten sowie daß Napoleon eine vorläufige Verständigung über den Kongreß nicht mit uns, sondern mit London und Petersburg suchte. Graf Harry Arnim meldete aus Rom, Kardinal Antonelli wisse von geheimen, zwischen Wien und Paris schwebenden, wichtigen Verhandlungen. Aus allem ging hervor, daß Napoleon infolge unserer beharrlichen Weigerung, deutsches Gebiet abzutreten, seine Gunst uns entzogen und dem zu manchen Versprechungen geneigten Oesterreich zugewandt hatte. Die formelle Einladung zum Kongresse wurde jedoch Ende Mai und Anfang Juni von allen Beteiligten außer Oesterreich acceptiert, welches die Annahme an Bedingungen knüpfte, die eine Ablehnung in sich schlossen. Napoleon sagte darauf am 3. Juni zu Goltz, Oesterreich allein trage die Verantwortung für den Krieg; daraus folge seine für uns wohlwollende Neutralität. Diese Worte konnten jedoch nicht ernst gemeint sein, denn die geheimen Verhandlungen mit Oesterreich gingen ununterbrochen weiter. Der sonderbare Vertrag, der am 10. Juni zustande kam, blieb uns zwar unbekannt; aber ein Manifest des Kaisers vom 11., welches in Form eines Briefes an Drouyn de Lhuys dem Senate mitgeteilt wurde, enthielt eine deutliche Absage an Preußen.
* * *
Als gegen Ende Mai der Krieg unvermeidlich zu werden schien, trat der Finanzminister von Bodelschwingh zurück, der schon früher bei jeder Gelegenheit eine friedliche Lösung befürwortet hatte. Die Verlegenheit war augenblicklich groß. Da wandte sich Bismarck an den Freiherrn von der Heydt, der früher lange Jahre Handelsminister, im Sommer 1862 Finanzminister gewesen und im September wegen Gewissensbedenken gegen eine budgetlose Verwaltung zurückgetreten war. Jetzt aber, da er das Vaterland in Gefahr sah, war er sofort bereit, die schwerste Verantwortung zu übernehmen und den Kredit, den er als Chef eines großen Bankhauses in Finanzkreisen genoß, zur Geltung zu bringen. Der Opfermut dieser Entschließung in einem Moment, wo an der Börse bereits Kriegskurse herrschten, ist, wie mir scheint, weder damals noch später voll gewürdigt worden; vielleicht weil die folgende Zeit so viel Kriegsruhm brachte, daß man darüber des wohlthätigen Zauberers vergaß, der seine ganze Habe einsetzte, um die versiegenden Quellen der Rüstungsmittel plötzlich wieder aufzuschließen.
Es darf erwähnt werden, daß von der Heydt in der entscheidenden Unterredung, welche am 1. Juni abends stattfand, den Wunsch aussprach, nach Beendigung des Krieges möchte wegen der Finanzverwaltung seit 1862 vom Abgeordnetenhause Indemnität nachgesucht werden, und daß Bismarck diesen Wunsch beim Könige zu befürworten zusagte. Die Thatsache dieser Zusage hat, wie ich glaube, damals niemand erfahren45, weder die andern Minister noch die Finanzmänner, welche Herrn von der Heydt reichliche Mittel zur Verfügung stellten. Der unter diesen an erster Stelle thätige Leiter der Diskontogesellschaft, Herr von Hansemann, sowie der Sohn des Ministers, Freiherr Karl von der Heydt, haben von der erwähnten Zusage Bismarcks nichts gewußt. Der große Name des neuen Leiters der preußischen Finanzverwaltung genügte, um alles Nötige zu beschaffen. Vielleicht kam auch bei maßgebenden Persönlichkeiten der Glaube an die Ueberlegenheit unserer Waffen hinzu, ein Glaube, der jedoch in Berlin keineswegs verbreitet war. Im Gegenteil glaubten die meisten, daß die verbündeten österreichischen und mittelstaatlichen Streitkräfte den unsrigen überlegen seien. Die allgemeine Stimmung war gedrückt.
Den zum Krieg führenden Schritt that Graf Mensdorff am 1. Juni, indem er die Entscheidung über Schleswig-Holstein in die Hand des Bundes legte und demselben die bevorstehende Einberufung der holsteinischen Stände anzeigte.
Moltke wünschte natürlich baldige Kriegserklärung, um den Gegnern nicht die Zeit zur Vollendung ihrer Rüstungen zu lassen. Der König aber befahl, den Verlauf der Sache am Bundestage abzuwarten.
Bismarck protestierte gegen den österreichischen Antrag durch einen Erlaß an Werther (vom 3. Juni), worin er ausführte, Oesterreich habe durch Uebertragung der Entscheidung wegen Schleswig-Holsteins an den Bund den Gasteiner Vertrag zerrissen; für den dortigen Rechtszustand sei daher fortan nur der Wiener Friede von 1864 maßgebend. Demnach dürften beide Mächte beide Herzogtümer militärisch besetzen, die Stände aber nur durch gemeinsamen Beschluß beider Regierungen einberufen werden.
In einem Rundschreiben an unsere Vertreter in Deutschland und im Auslande legte er dar, daß Oesterreich planmäßig den Krieg herbeiführen wolle. Der am 1. Juni beim Bundestage eingebrachte Antrag sei beleidigend in der Form, vertragswidrig im Inhalt. Der König habe noch im Mai einen von unparteiischer Seite gemachten Vorschlag zu direkter Verständigung bereitwillig entgegengenommen, der Vorschlag sei aber in Wien gescheitert; und aus authentischer Quelle seien dem König Auslastungen kaiserlicher Minister mitgeteilt worden, wonach dieselben den Krieg um jeden Preis begehrten, teils in der Hoffnung auf Erfolge im Felde, teils um über innere Schwierigkeiten hinwegzukommen, ja selbst mit der ausgesprochenen Absicht, den österreichischen Finanzen durch preußische Kontributionen oder durch einen ehrenvollen Bankerott zu Hilfe zu kommen.
Am 5. Juni brachte der Staatsanzeiger den Artikel des Vertrages vom 16. Januar 1864, in welchem die beiden Mächte sich zugesagt hatten, über Schleswig-Holsteins Zukunft nur in gemeinsamem Einverständnisse zu bestimmen.
Am Bundestage folgte unsererseits eine ausführliche Entgegnung auf den österreichischen Antrag.
Allen deutschen Regierungen übersandte Bismarck am 10. Juni den Entwurf eines Umrisses der künftigen Bundesverfassung. Der Hauptinhalt war: Ausschluß Oesterreichs, Teilung des Oberbefehls über das Bundesheer zwischen Preußen und Bayern, Bundesmarine, Parlament aus Volkswahlen nach allgemeinem Stimmrecht, Vertrag zwischen Deutschland und Oesterreich.
Dem Herzog von Koburg schrieb Bismarck bei Uebersendung dieses Schriftstückes:
… „Die in dem Entwurfe enthaltenen Vorschläge sind nach keiner Seite hin erschöpfend, sondern das Resultat der Rücksicht auf die verschiedenen Einflüsse, mit denen kompromittiert werden muß intra muros et extra. Können wir sie aber zur Wirklichkeit bringen, so ist damit immer ein gutes Stück der Aufgabe, das historische Grenznetz, welches Deutschland durchzieht, unschädlich zu machen, erreicht, und es ist unbillig, zu verlangen, daß eine Generation oder sogar ein Mann, sei es auch mein allergnädigster Herr, an einem Tage gutmachen soll, was Generationen unserer Vorfahren Jahrhunderte hindurch verpfuscht haben. Erreichen wir jetzt, was in der Anlage feststeht, oder Besseres, so mögen unsere Kinder und Enkel den Block handlicher ausdrechseln und polieren.
„Ich habe die Skizze zunächst Baron Pfordten mitgeteilt; er scheint mit allem Wesentlichen einverstanden, nur nicht mit Artikel I, weil er meint, daß Bayerns Interesse Oesterreichs Verbleiben auch im engeren Bunde fordere. Ich habe ihm mit der Frage geantwortet, ob und wie er glaubt, daß die übrigen Artikel oder irgendetwas Aehnliches auf einen Bund anwendbar seien, welcher Oesterreich zum Mitgliede hat …
„Daß der vorliegende Entwurf den Beifall der öffentlichen Meinung haben werde, glaube ich nicht; denn für den deutschen Landsmann genügt im Allgemeinen die Thatsache, daß jemand eine Meinung ausspreche, um sich der entgegengesetzten mit Leidenschaft hinzugeben; ich begnüge mich mit dem Worte qui trop embrasse, mal étreint“…
In einigen Teilen Deutschlands gaben jetzt die Volksvertretungen Mißbilligung der partikularistischen Politik ihrer Regierungen zu erkennen; so in Darmstadt, Nassau, Kassel, Hannover; aber in Sachsen, Bayern und Württemberg schien leidenschaftlicher Haß gegen Preußen vorherrschend.
32General von Manteuffel.
33Die nach 1815 von den deutschen Burschenschaften als Panier des Deutschen Reichs angenommene und 1848 als solches ziemlich allgemein anerkannte schwarz-rot-goldene Fahne (s. a. oben S. 23) wurde 1867 durch die schwarz-weiß-rote ersetzt.
34Moritz Busch erzählt (Unser Reichskanzler, Bd. I, S. 200), Bismarck habe am Abend des 25. dem Erblandmarschall von Bülow-Gudow bei einer Fahrt auf dem See mitgeteilt, was geschehen würde, wenn die Huldigung nicht ohne jede Störung erfolgte. Ich kann diese Angabe weder bestreiten noch bestätigen. Obwohl in demselben Hause wie der Minister einquartiert, habe ich von dessen Wasserfahrt nichts erfahren. Gewiß ist, daß er am Morgen des 26. auch die zweite Eidesformel mit nach der Kirche genommen hat.
35Roman von Adalbert Stifter.
36Die Gemahlin des Obersten von Schenck geb. von Luck.
37General Manteuffel citierte mitunter den Wallenstein, den er fast ganz auswendig wußte, und ist hier mit der Bezeichnung „Der Friedländer“ gemeint. Ich hatte mich erboten, wenn er es wünschte, ganz Schleswig zu bereisen, um mit allen Beamten zu sprechen und ihm für alle in nächster Zeit wahrscheinlich bevorstehenden Anstellungen Vorschläge zu machen, welche dann in Berlin genehmigt werden würden. Zedlitz schrieb mir sehr erfreut über diesen Gedanken, Manteuffel aber besorgte, daß eine solche Reise seinem Ansehen im Lande Eintrag thun könnte; und deshalb unterblieb sie.
38General Manteuffel.
39Arthur von Wolff, damals Rat im Ministerium des Innern, später Oberpräsident von Sachsen, zuletzt Präsident der Oberrechnungskammer.
40Blanckenburg.
41Sybel (IV S. 247; 251) meint, die Erbitterung gegen Bismarck sei in Wien durch die völlig unbegründeten Gerüchte hervorgerufen worden, daß er in Biarrits ein Bündnis gesucht und in Paris den Abschluß einer österreichischen Anleihe zu hindern sich bemüht habe, welche später unter geheimer Billigung des Kaisers zustande kam. Ich zweifle, ob diese Gerüchte für sich allein die entscheidende Wendung der kaiserlichen Politik hätten bewirken können.
42In Bezug auf Bucher spricht Friedjung (S. 181) auch die Vermutung aus, daß dieser auf die Entscheidung Bismarcks für das allgemeine Wahlrecht eingewirkt habe. Das Staatsministerium hatte sich aber schon im September 1863 dafür ausgesprochen, während Bucher erst im November 1864 eintrat. Ueberhaupt hat er meines Wissens niemals einen Versuch gemacht, gesprächsweise dem Chef eine Ansicht nahezubringen. In späteren Jahren pflegte er, wenn nach seiner Meinung der Reichskanzler sich in einem faktischen oder juristischen Irrtum befand, eine kurze Denkschrift einzureichen. Des Sprechens war er wenig gewöhnt. Am 19. April 1866 schrieb er mir, der täglich durch sein Arbeitszimmer kam, ich möchte doch dem Chef für die künftige Reichsverfassung eine gewisse Bestimmung vorschlagen, die vielleicht den Ring der Opposition brechen könnte. Er war, bei eminenten Fähigkeiten und Kenntnissen, wortkarg und verschlossen; aber, soviel ich aus vereinzelten Aeußerungen entnehmen konnte, stand er in den letzten Jahrzehnten seines Lebens demokratischen Anschauungen sehr fern und suchte das Heil des Gemeinwesens in möglichster Stärkung der Autoritäten.
43Friedjung (I S. 215 bis 222) weist aus dem italienischen Generalstabswerk über den Krieg von 1866 nach, daß die italienische Armee im April nicht nur durch die gewöhnliche Rekrutenaushebung, sondern auch durch andere Maßregeln, namentlich durch Einbehaltung der höchsten Altersklasse, verstärkt worden sei, was der österreichische Generalstab in Rechnung gestellt habe (S. 216). Dennoch ist auch nach seiner Meinung der Beschluß, die österreichische Südarmee mobilzumachen, eine verhängnisvolle Uebereilung gewesen. Graf Mensdorff hat dagegengestimmt (S. 221, 222).
44Bernhardt (Aus meinem Leben, Bd. VI, S. 318) erwähnt eine Aeußerung Max Dunckers, der damals vortragender Rat beim Kronprinzen war, an Bennigsen, Bismarck habe dem Könige vorgeschlagen, ein „liberales Ministerium“ zu berufen. Diese vermutlich auf denselben Vorgang zu beziehende unbestimmte Angabe scheint mir weniger glaubhaft als Oppenheims genaue Erzählung dessen, was ihm der Minister selbst gesagt hatte.
45Mir wurde das am 1. Juni wegen der Indemnitätsnachsuchung getroffene Uebereinkommen am 13. Juli (im Hauptquartier Czernahora) zufällig bekannt durch einen mir zum Entwurf der Antwort übergebenen Brief des Finanzministers an den Chef.