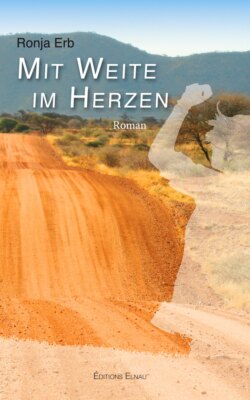Читать книгу Mit Weite im Herzen - Ronja Erb - Страница 7
Kapitel 4
Оглавление„Sprechen Sie Deutsch?“, fragte mich jemand. Nur langsam drang die Frage in mein Bewusstsein. Ich versuchte meine Augen zu öffnen, aber die Lider fühlten sich schwer an. Ich nahm eine drückende Hitze wahr. „Oder Englisch?“, wurde ich wieder angesprochen, und jetzt hörte ich auch ganz viele andere Stimmen und sogar Musik.
Ich lag auf etwas Hartem, Kaltem. Jemand schob mir ein kleines Kissen unter den Kopf. Die Kühle lies mich langsam wieder zu Bewusstsein kommen. Als ich die Augen öffnete, sah ich, erst unscharf und dann immer klarer, viele Menschen, die um mich herumstanden und durcheinanderredeten. Ein Mann hielt meine Hand und fragte mich nach meinem Namen. „Helen Kramm“, antwortete ich.
„Ich bin Nahas Utbiteb, ich bin Arzt“, sagte er auf Englisch. „Wo kommen Sie her?“, fragte er.
„Aus Deutschland.“
„In Ordnung, dann können wir deutsch miteinander sprechen“, sagte er und fügte auf Deutsch hinzu: „Sie sind in Namibia, genauer gesagt in Windhoek. Sie hatten einen Kreislaufzusammenbruch. Sie brauchen ärztliche Hilfe. Sind Sie schwanger?“
„Ja“, sagte ich und fasste an meinen Bauch. „Ist was mit meinem Kind?“
„Das weiß ich nicht, wir müssen Sie untersuchen, dann können wir mehr sagen. Ich werde Sie mit in meine Praxis nehmen. Heute ist der einundzwanzigste März, der Nationalfeiertag in Namibia, fast alle Arztpraxen sind geschlossen, und auch die Krankenhäuser haben heute nur eine Notfallbesetzung. Daher ist es besser, wenn Sie mit zu mir kommen.“
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich fürchtete mich zwar ein bisschen, aber der Mann sah vertrauenerweckend aus und hatte ein sehr freundliches Gesicht, sodass ich zustimmte. Ich wollte aufstehen, aber er sagte, dass ich besser liegen bleiben solle. Er sprach mit ein paar von den Leuten, die um mich herumstanden, ich konnte aber nicht verstehen, was er sagte, denn er unterhielt sich mit ihnen in einer mir unbekannten Sprache, und außerdem wurde der Lärm, der von der Straße hereinkam, immer lauter.
Ich sah, wie jemand mit einem großen Tuch kam, einer Tischdecke oder einem Laken. Es wurden an allen vier Ecken Knoten hinein gemacht, und vier Männer hielten das Tuch anschließend wie eine Trage. Einige andere Männer hoben mich an und legten mich auf das Tuch, das nach unten sackte, mir aber, bevor ich den Boden berührte, Halt gab. Ich hörte, wie der Mann, der sich mir als Arzt vorgestellt hatte, etwas zu den anderen Männern sagte.
Angeleitet von ihm, trugen sie mich auf die Straße hinaus und schlängelten sich durch die Menschenmassen. Die Menschen schienen einem Umzug zu folgen, denn sie bewegten sich singend und tanzend alle in die gleiche Richtung, und immer wieder hörte ich Musik und Fanfaren. Ich sah unendlich viele Beine, die rechts und links an mir vorbeistoben. Ich legte meine Arme fest um meinen Bauch, da ich fürchtete, in dem Gewühl einen Tritt abzubekommen. Ich versuchte zu fühlen, ob sich das Baby bewegte, aber es war nichts zu spüren. Panik überkam mich, Schweißtropfen liefen an meiner Stirn runter, und ich rang nach Luft.
Die Männer legten mich auf den Boden, aber auf Anweisung des Arztes hoben sie das Tuch sofort wieder an. Der Arzt trat an mich heran und reichte mir eine Flasche Wasser. „Nehmen sie einen Schluck, das wird Ihnen guttun“, sagte er. Sanft sprach er auf mich ein und bat mich, mich zu beruhigen.
„Mein Baby“, sagte ich, „mein Baby.“
Er legte mir eine Hand auf den Bauch und die andere auf die Stirn. „Ihr Kopf ist heiß“, sagte er, „es scheint, als haben Sie Fieber. Sie müssen unbedingt trinken, die Hitze und das Fieber werden Sie sonst noch einmal kollabieren lassen. Trinken Sie die Flasche leer. Wir müssen nur noch da vorne um die Ecke gehen, dann sind wir in meiner Praxis.“
Unsere kleine Karawane setzte ihren Zug durch die Menschenmassen fort. Ein paar Straßen weiter gingen wir durch ein Tor und kamen in einen Hinterhof, in dem es still und friedlich war. Die Stimmen und die Musik drangen bis hierher nur noch in gedämpfter Lautstärke. Die Männer legten mich auf eine Liege, die in einem, von dem Hof abgehenden Räumen stand.
Der Arzt hatte sich einen Kittel angezogen und kam nun mit allerlei Gerätschaften an meine Liege getreten. Wieder legte er mir seine Hand auf die Stirn und bat mich, ein Thermometer in den Mund zu nehmen. Während er Fieber maß, fühlte er meinen Puls und hörte mein Herz ab. Er schaute sich das Thermometer an und sagte: „Sie haben tatsächlich Fieber. Ich denke, Sie haben bereits sehr viel Flüssigkeit verloren, ich werde Ihnen eine Infusion legen.“
Als er die Nadel einstach, wimmerte ich kurz, und er tätschelte mir beruhigend über die Hand, anschließend legte er mir das Blutdruckmessgerät an. „Ihr Kreislauf ist schon wieder relativ stabil“, sagte er, „jetzt wollen wir mal sehen, was das Baby macht.“ Er tastete meinen Bauch ab und zog dann ein Ultraschallgerät zu sich heran, lange fuhr er damit über meinen Bauch und schaute auf den kleinen Bildschirm, der das Ultraschallbild anzeigte. Beunruhigt folgte ich seinem Blick und versuchte, seine Mimik zu deuten.
„Dem Kleinen scheint es gut zu gehen“, sagte er schließlich.
Ich strahlte über das ganze Gesicht und fragte zögernd: „Dem Kleinen?“
„Ja“, sagte er, „wussten Sie noch nicht, dass es ein Junge wird?“
„Nein“, antwortete ich.
„Es sieht so aus, als seien Sie in der einundzwanzigsten Schwangerschaftswoche“, sagte er. „Wie lange sind Sie denn schon in Namibia?“
Ich überlegte und stellte fest, dass ich mich gar nicht richtig daran erinnern konnte, was passiert war. „Ich weiß es nicht“, sagte ich zögernd, „aber ich glaube nicht lange.“
„Wo wollten Sie denn hin, bevor Sie in diese Bar gegangen sind, wo Sie dann den Kreislaufzusammenbruch hatten?“, fragte er weiter.
Wieder überlegte ich. Langsam kam die Erinnerung zurück und mir fiel ein, dass ich aus dem Flugzeug gestiegen war und ein Taxi genommen hatte. „Was habe ich dem Taxifahrer gesagt, wo ich hin will?“, fragte ich mich laut.
„Wahrscheinlich wollten Sie in ein Hotel“, vermutete der Arzt. „Sie haben jedenfalls zwei Koffer dabei“, er deutete mit dem Finger auf mein Gepäck, das in der Ecke stand und mir bis dahin noch gar nicht aufgefallen war.
„Ja“, antwortete ich, „natürlich ins Hotel.“
„Wie auch immer“, sagte er, „Sie können jetzt ohnehin nicht allein in einem Hotel bleiben. Sie müssen sich erst einmal erholen, das Fieber deutet auf einen Infekt hin. Ich biete Ihnen an, dass Sie sich in meinem Haus ausruhen. Meine Frau und ich würden uns freuen, Sie bei uns als Gast aufzunehmen, und die ärztliche Versorgung hätten Sie auch noch gleich mit dabei“. Als er das sagte, guckte er mich aufmunternd an.
Ich sah ihn an, die dunkle Haut seines Gesichts war ganz glatt und das, obwohl er schon ziemlich alt zu sein schien, denn er hatte weiße Haare, die sich in kurzen kleinen Locken auf seinem Kopf kräuselten. Ich spürte seine Hand auf meiner und sagte: „Gerne, wenn es Ihnen nicht zu viele Umstände macht.“
„Nein, ganz und gar nicht.“ Unvermittelt fragte er: „Hat Sie Ihr Mann oder Freund verlassen?“
Ich erschrak und senkte meinen Blick. Sofort entschuldigte er sich und sagte, dass ihn das nichts anginge.
„Hören Sie die Musikanten?“, fragte er mich, „Sie spielen gerade unsere Nationalhymne, kennen Sie die?“ Ohne meine Antwort abzuwarten, stimmte er in den Refrain ein: „Namibia our country, Namibia, motherland, we love thee“. Als er aufgehört hatte zu singen, sagte er: „Ich muss Sie kurz alleine lassen, denn irgendwo da draußen steht noch meine Frau. Ich hatte Lucas, einem Freund von mir, zwar gebeten, ihr Bescheid zu geben, aber ich möchte sie dennoch nicht noch länger warten lassen, sie wird sich bestimmt schon Sorgen machen. Kann ich Sie einen Moment alleine lassen?“
„Ja“, sagte ich, obwohl mir unwohl bei dem Gedanken war. Er schien das zu spüren, denn er betonte nochmals, dass er gleich zurück sein würde.
Als er gegangen war, ließ ich meinen Blick durch den Raum schweifen. Das Behandlungszimmer unterschied sich nicht von dem in einer Arztpraxis in Deutschland. Ich richtete mich auf und versuchte, in die angrenzenden Räume und den Innenhof zu schauen. In die anderen Räumen konnte ich nicht sehen, denn die Fensterläden waren geschlossen. Der Innenhof war schön, sonnenerhellt und mit großen Kübelpflanzen wirkte er einladend. Ich hatte Lust, dort rauszugehen, doch ich entschied, dass ich wohl besser hier auf der Liege bleiben sollte. Außerdem hing die Infusion noch an meinem Arm.
Auf der anderen Seite des Zimmers war ein großer Spiegel und ich setzte mich so hin, dass ich mich darin sehen konnte. Liebevoll streichelte ich meinen Bauch und sagte: „Ein kleiner Junge wirst du also. Es tut mir so leid, dass ich dir so einen Schreck eingejagt habe, aber der Flug, die Hitze, das war wohl alles zu viel für deine Mutter. Ich verspreche dir, dass ich mich schonen werde, bis ich wieder ganz gesund bin. Du kleiner Kerl hast ja offensichtlich schon einen starken Lebenswillen.“ So als wollte er mir das bestätigen, spürte ich einen leichten Tritt in meinem Bauch. Mein Herz hüpfte vor Freude.
„Unser Haus liegt außerhalb von Windhoek, wir können jetzt hinfahren, der Festumzug ist durchgezogen“, sagte der Arzt, als er wieder zur Tür hereinkam. Hinter ihm erschien seine Frau, er stellte sie mir vor: „Das ist Pendukeni, meine Frau.“
Pendukeni kam an die Liege getreten, auf der ich saß, nahm meine Hand und streichelte mir über den Kopf, genauso wie es ihr Mann vorhin getan hatte. Auch sie hatte eine herzliche Ausstrahlung. Ihr Haar war ebenfalls weiß, aber nicht kraus, wie es für eine Afrikanerin typisch gewesen wäre, sondern glatt, und es war zu einem dicken Zopf gebunden. „Mein Mann hat mir gesagt, dass Sie eine Weile bei uns bleiben werden, bis Sie sich erholt haben“, sagte sie auf Deutsch und fügte hinzu, „ich freue mich darüber.“ Sie sagte das mit so viel Wärme, dass ich gerührt war. Es war sehr lange her, dass ich ein so tiefes Gefühl von Geborgenheit empfunden hatte, wie in diesem Moment.
„Nenn uns Nahas und Pendukeni“, sagte sie und legte meine Hand in ihre.
„Ich bin Helen“, antwortete ich.
„Hier ist nur meine Praxis, wir wohnen nicht in Windhoek, es ist uns zu groß. Ich bin in den Bergen aufgewachsen. Bis heute brauche ich die Ruhe da draußen, um mich wohlzufühlen“, erklärte Nahas, als wir im Auto saßen.
„Windhoek ist in den letzten Jahrzehnten immer größer geworden. Als Nahas in den achtziger Jahren als junger Arzt im Krankenhaus in Windhoek gearbeitet hat, war Windhoek noch viel kleiner, heute hat es über dreihunderttausend Einwohner. Damals war Namibia noch keine unabhängige Republik. Zwar ist seit der Unabhängigkeit Englisch die offizielle Amtssprache, aber trotzdem sprechen viele Namibier deutsch. Das stammt noch aus der Kolonialzeit, als eine größere Zahl von Deutschen um 1880 nach Namibia gekommen ist und sie das Land bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs besetzt gehalten haben. Nach wie vor ist Deutsch neben den anderen Sprachen wie Afrikaans, Englisch, Bantu und Khoisan noch eine der wichtigsten Sprachen in unserem Land“, sagte Pendukeni.
Die Häuser zogen an mir vorbei. Ich fühlte mich in dem Auto mit Nahas und Pendukeni wie in einem kuscheligen Nest. Ich lauschte ihren Worten und nickte darüber ein.
Ich wachte erst wieder auf, als das Auto anhielt und Nahas sagte, dass wir angekommen seien. Ich entschuldigte mich dafür, eingeschlafen zu sein und fragte, wie lange wir gefahren seien.
„Eine gute halbe Stunde“, sagte Nahas und fügte hinzu: „Es ist gut, dass du dich ausruhst, du hast eine anstrengende Zeit hinter dir.“
„Woher weißt du das?“, fragte ich.
„Das sehe ich dir an.“
„Ja, du hast recht“, sagte ich und senkte meinen Blick.
Nahas tätschelte mir aufmunternd die Schulter.
„Kommt lasst uns reingehen“, sagte Pendukeni.
Nachdem ich die Autotür aufgemacht hatte, kam mir eine angenehme Wärme entgegen, die nicht so drückend war wie die in Windhoek. Ich atmete tief ein und stieg aus dem Auto.
Wir standen vor einem großen Steinhaus, das ganz und gar weiß gestrichen war und in der Sonne leuchtete und mich fast blendete. Als ich mich umdrehte, sah ich weiter unten an dem Hügel ein paar Häuser, die allerdings sehr viel kleiner waren, aber die meisten waren auch hell gestrichen und schimmerten ebenfalls in der Abendsonne. Am Fuß der Berge konnte ich eine Stadt sehen. Ich nahm an, dass es Windhoek war, und wollte gerade ansetzen, Nahas zu fragen, als ich sah, dass er dabei war, meine Koffer ins Haus zu tragen. Schnell eilte ich ihm zu Hilfe und nahm sie ihm ab. Ich entschuldigte mich und sagte, dass ich so von dem Blick fasziniert gewesen sei, dass ich gar nicht gemerkt hätte, dass er schon die Koffer aus dem Auto geholt hat.
„Du entschuldigst dich oft“, sagte Nahas, „das ist nicht nötig. Unter Familienmitgliedern braucht man sich für so etwas nicht zu entschuldigen.“
Irritiert von dem letzten Satz, antwortete ich nichts und folgte ihm ins Haus. Vom Eingang kam man direkt die Küche, die sich fast über das ganze Erdgeschoss erstreckte. Drei Türen gingen von der Küche ab, und ich vermutete, dass sich dahinter das Wohnzimmer und der Aufgang zum Obergeschoss befanden.
Pendukeni hatte sich sogleich eine Schürze umgebunden und stand vor dem Herd. Nahas hatte sich an den großen Esstisch gesetzt.
Ich schätzte, wie viele Leute an dem Tisch sitzen konnten, es konnten wohl rund fünfzehn Personen an ihm Platz finden.
Als hätte Nahas meine Gedanken gelesen, sagte er: „Wir sind eine große Familie. Wir haben sieben Kinder und achtzehn Enkelkinder und zweiundvierzig Urenkel, der Tisch ist also eigentlich zu klein.“ Er grinste ganz stolz.
Ich stellte mein Gepäck ab und setzte mich auch an den Tisch. Auf dem Herd fing ein Topf mit Wasser an zu brodeln. Als das Wasser kräftig blubberte, nahm Pendukeni den Topf vom Herd und hielt ein Säckchen hinein. Sofort fing es herrlich an zu duften, die ganze Küche roch nach würzigen Kräutern.
Nachdem Pendukeni für uns alle eine Tasse eingeschenkt hatte, streute sie in meine Tasse noch ein Pulver, das sich in dem heißen Tee auflöste. Verwundert sah ich sie an, und sie sagte: „Das wird dich wieder in Schwung bringen, das ist Moringa-Pulver. Du solltest in den nächsten Tagen zwei- bis dreimal täglich ein bisschen davon zu dir nehmen.“
Schweigend saßen wir da und tranken den Tee. Ich sah mich in der Küche um, es gab eine Feuerstelle, einen Holzofen und einen Elektroherd. Die Regale waren voll mit Tellern, Töpfen und Schüsseln. Ja, hier kann man wirklich für eine Großfamilie kochen, dachte ich und versuchte mir vorzustellen, wie viel Trubel hier sein musste, wenn all die Kinder, Enkel und Urenkel zu Besuch waren. Pendukeni riss mich aus meinen Gedanken, indem sie sagte, dass sie mir mein Zimmer zeigen wolle.
Wir nahmen eine der drei Türen, die von der Küche abgingen, und kamen in einen kleinen Flur, von dem aus eine Treppe nach oben führte. Im Obergeschoss gingen von dem Flur, der sich über die ganze Hauslänge erstreckte, sechs Türen ab.
Pendukeni öffnete die erste Tür auf der rechten Seite. „Hier ist dein Zimmer“, sagte sie.
Ich sah durch den Türrahmen in ein kleines, aber sehr schön eingerichtetes Zimmer. Vom Fenster aus konnte man auf den Vorhof des Hauses gucken und auf die dahinter liegende Stadt.
„Ist das Windhoek?“, fragte ich, und Pendukeni nickte.
„Von hier oben sieht es sehr friedlich aus“, sagte sie, „wie ein großer, weißer Riese, der sich im Tal zum Schlafen gelegt hat.“
„Ja“, sagte ich und fand, dass ihr Bild sehr treffend war.
„Das Bad ist zwei Türen weiter, auf der linken Seite, vielleicht möchtest du dich etwas frisch machen. Ich werde dir ein Handtuch hinlegen und dann runtergehen, um das Abendessen vorzubereiten. Wenn es fertig ist, rufe ich dich“. Und als sie schon fast zur Tür draußen war, fügte sie noch an: „Lass dir ruhig Zeit, es wird etwas dauern, bis das Essen gekocht ist.“
Ich setzte mich auf das Bett und fühlte mich wie ein Kind. Wenn es möglich gewesen wäre, hätte ich die Beine schaukeln lassen. Außer dem Bett gab es nur noch einen Tisch, einen Schrank und eine kleine Kommode, auf der eine Nachttischlampe stand. Die Wände waren unverputzt und die Steine nur weiß übertüncht. Obwohl das Zimmer eher spartanisch eingerichtet war, hatte es eine gemütliche Atmosphäre.
„Hamburg“, sagte ich laut. Wie weit weg mir das vorkam, und doch war es erst zwei Tage her, dass ich Deutschland verlassen hatte. Ich ließ alles in Gedanken Revue passieren: den Abschied von Marlis, den flüchtigen Blick auf Lars am Flughafen, die Tränen im Flugzeug. Die Hitze, die mir entgegengeschlagen war, als ich aus dem Flugzeug stieg. Das Taxi, das ich gerufen hatte, um vom Flughafen zum Hotel zu fahren, und dann das Aufwachen in der Bar. Mir fiel nun auch wieder ein, warum ich an der Bar angehalten hatte, ich hatte etwas essen wollen, denn das Frühstück im Flugzeug hatte ich verschlafen. „Von Hamburg“, wiederholte ich und fügte hinzu, „nach“, doch ich stockte, denn ich wusste gar nicht, wie der Ort hieß, in dem ich jetzt war, der Einfachheit halber sagte ich daher, „von Hamburg in das Dorf, das oberhalb von Windhoek in den Bergen liegt.“ Ich nahm mir vor, nachher beim Abendessen zu fragen, wie es hieß. Doch zunächst wollte ich dem Vorschlag von Pendukeni folgen und mich etwas frisch machen.
Nachdem ich eine Dusche genommen hatte, sprang ich vergnügt die Treppe runter und hielt dabei meinen Bauch, dessen Rundung sich unter meinem T-Shirt abzeichnete. Es war eine Wohltat, frische Kleidung zu tragen und den Staub und Schweiß abgewaschen zu haben. Auch hatte ich den Eindruck, dass das Fieber gesunken war. Ich fühlte mich beschwingt und lief durch das Haus, als hätte ich hier schon immer gewohnt.
In der Küche stand Pendukeni am Herd, und Nahas saß am Tisch und schrieb etwas auf einen Zettel. Es standen schon Teller auf dem Tisch und auch ein Topf, aus dem es dampfte.
„Wir können gleich essen“, sagte Pendukeni.
Ich setzte mich an den Tisch und legte meine Arme um den Teller, so wie ich es als Kind immer gemacht hatte, wenn ich mit hungrigem Magen auf das Essen wartete. Pendukeni klatschte in die Hände und sagte etwas zu Nahas, das ich nicht verstand. Ich nahm an, dass sie Afrikaans gesprochen hatte.
Nach dem Essen unterhielten wir uns noch eine ganze Weile, anschließend bedankte ich mich für das Essen und ging hoch in mein Zimmer.