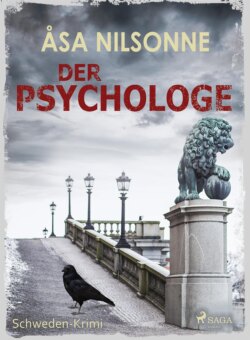Читать книгу Der Psychologe - Schweden-Krimi - Åsa Nilsonne - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеDie Härchen auf Monika Pedersens Armen sträubten sich. Die Bewegung setzte in der Nähe der Armbeuge ein und pflanzte sich wie eine Welle oder eine Seuche bis zu den Händen fort.
Rasch ließ sie das Buch sinken und atmete tief durch. Der harte Einband schlug gegen ihr verletztes Bein, und sie verkrampfte sich in Erwartung eines Schmerzes, der jedoch überraschenderweise ausblieb. Das musste ein Zeichen des Fortschritts sein. Ihr Unfall lag jetzt fast drei Monate zurück, aber die Heilung war nur langsam vorangeschritten. Monika war noch immer krankgeschrieben und brauchte also nicht zum Dienst bei der Kriminalpolizei zu erscheinen.
Misstrauisch blickte sie auf die dicht beschriebenen Seiten, die mit einem Mal anonym und unpersönlich aussahen. Offenbar hatte sie das Gelesene missverstanden. Ein Buch, von dem sie nie in ihrem Leben gehört hatte, konnte wohl kaum von ihrer Mutter handeln. Vielleicht kam es häufiger vor, dass jemand auf Buchstellen stieß und sich darin wiederzuerkennen glaubte.
Um sich im Krankenhaus die Zeit zu vertreiben, hatte sie angefangen zu lesen und auch nach ihrer Entlassung damit weitergemacht. Nach den ersten fünf oder sechs Büchern hatte sie förmlich eine Art Hunger entwickelt.
Sie wollte die Welt durch anderer Menschen Augen sehen und näherte sich neuen Büchern jetzt mit großer Freude und Neugier.
In den vergangenen drei Monaten hatte sie mehr Bücher gelesen als während der gesamten fünfundzwanzig Jahre davor. Liebesromane, historische Romane, Fantasy und Science Fiction, Biografien, alles mit einer bedingungslosen Entdeckungslust. Das Einzige, was sie nicht anrührte, waren Kriminalromane – sie hatte mit mehr Morden zu tun gehabt, als sie sich erinnern konnte, und das Letzte, worüber sie lesen wollte, waren fiktive Ermittlungen, vor allem, da die Morde oft reichlich grotesk dargestellt wurden und die Arbeit der Polizei geradezu lächerlich unwahrscheinlich wirkte.
Das Buch, das jetzt auf ihren Knien lag, hatte lange warten müssen, bis es an die Reihe gekommen war – weder Einband noch Klappentext hatten sonderlich verlockend gewirkt. Aber die Krankenhausbibliothekarin hatte sie mit den fröhlichen Worten auf ihren wöchentlichen Bücherstapel gelegt: »Sie interessieren sich doch für Menschen, da wird Ihnen dieses Buch gefallen.«
Der Titel hatte alles andere als verheißungsvoll ausgesehen – Meine Patienten – mein Leben, dazu der Untertitel: »Vierzig Jahre psychoanalytische Erforschung der menschlichen Psyche«. Monika hatte sich das Buch nur geben lassen, weil sie hoffte, der Autor könne hilfreiche Hinweise geben, wie man einen stetigen Strom von Patienten, von menschlichem Elend überlebte. Vielleicht wussten Psychologen in dieser Hinsicht ja etwas, von dem die Polizei noch nicht gehört hatte.
Die Frage war nur, ob dieses Wissen noch immer relevant war. Sie war mit der brutalen Arbeitssituation, in der sie bisher gelebt hatte, doch fertig. Vielleicht war dies eine Erklärung dafür, dass sie das Buch noch nicht gelesen hatte, aber ein wenig neugierig war sie ja doch gewesen, deshalb hatte sie es nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus mit nach Hause genommen. Dort war es dann wieder liegen geblieben, aber nun hatte sie es endlich hervorgeholt. Sie hatte es neben Teetasse und Morgenzeitung auf den Küchentisch gelegt, als Puffer zwischen sich und dem langen, planlosen Tag, der ihr bevorstand.
Der Umschlag war abgegriffen, doch innen hatte das Buch unberührt ausgesehen – vielleicht hatten es andere ausgeliehen und als Unterlage benutzt, es aber nicht gelesen? Aber das sollte sich jetzt ändern!
Sie hatte sich bequem hingesetzt, zu frühstücken angefangen und gelesen. Wie sie festgestellt hatte, bestand das Buch aus einer Sammlung von Fallstudien – Zusammenfassungen von Lebensschicksalen und Therapieverläufen. Das Lesen war ihr schwer gefallen, da die Sprache mit Fachbegriffen gespickt war und keinerlei stilistischen Ehrgeiz aufwies, und nach ein paar frustrierenden Minuten hatte Monika beschlossen, dem Buch nur noch eine Stunde Zeit zu gewähren. Wenn es nicht spannender wurde, konnte sie es immer noch beiseite legen.
Aber bei der zweiten Fallstudie hatten sich ihre Haare gesträubt.
Sie griff nach dem Buch und las weiter.
»Wer berühmt wird, entdeckt plötzlich, dass dieser Ruhm andere berühmte Menschen anzieht. Auch in meinem Fall war das so. Eine unserer prominenten Politikerinnen suchte mich auf, um ihrer Tochter zu helfen, und ich nahm mich wider besseres Wissen ihrer an, weil ich Hilfe bieten wollte, fast als patriotische Pflicht. Deshalb konnte ich die tragische Entwicklung einer ganz besonders schweren Charakterneurose über fünfzehn Jahre verfolgen, leider ohne sie wirklich beeinflussen zu können. Das Ganze gipfelte im Tod der Patientin, nicht durch Selbstmord, wie man doch meinen könnte, sondern durch Mord, was eine ungewöhnliche und reichlich erschütternde Art ist, eine Patientin zu verlieren, auch wenn dieser Mord in diesem Fall durchaus seine Logik hatte.«
Hier war Monikas Interesse ein wenig geweckt worden – ein Mord könnte den spröden Text vielleicht zugänglicher machen, und es handelte sich immerhin nicht um Gewalttaten, die der Unterhaltung dienen sollten.
Mordermittlungen waren ihr selbstgewählter Lebensinhalt gewesen, ihre Art, sich für eine bessere Gesellschaft zu engagieren. Die ersten Jahre waren auch zufrieden stellend verlaufen, aber ihre Arbeitsfreude hatte immer mehr nachgelassen und war am Ende ganz verflogen.
In den vergangenen Monaten hatte sie versucht, nicht an ihre Arbeit zu denken, doch nun tauchte ein Mord in einem ganz unerwarteten Zusammenhang auf.
Das erinnerte sie daran, dass sie zum ersten Mal in ihrem Erwachsenenleben nicht wusste, was aus ihr werden sollte.
Sie las weiter.
»Es war eine hoch gewachsene, elegant gekleidete Frau, die meine Praxis aufsuchte. Sie war am Vortag aus New York eingetroffen und schien höchst energiegeladen zu sein, vielleicht lag das aber nur an ihrer professionellen Disziplin. Es war eine Frau, die keine der üblichen weiblichen Schwächen oder irgendeine Form von Empfindsamkeit an den Tag legte. Eine Erklärung dafür bekam ich viel später: Ihr Vater hatte sie wie den Sohn aufgezogen, den er sich gewünscht hatte. Sie hatte diesen kastrierten Zustand mit dem innigen Wunsch kompensiert, es in einer männlichen Sphäre weit zu bringen, was ihr auch gelungen war. Doch wie meist in diesen Fällen hatte das einen hohen Preis gefordert, der teilweise von ihrem einzigen Kind bezahlt werden musste, einer Tochter, die sie mit knapp dreiundvierzig Jahren zur Welt gebracht hatte. Und diese Tochter, die nun ihrerseits schwanger war, wurde meine Patientin.«
An dieser Stelle hatte Monika innegehalten. Monikas Großmutter war groß gewesen, hatte in New York gearbeitet und mit knapp dreiundvierzig Jahren ihr erstes und einziges Kind bekommen. Sie hatte spät geheiratet und nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass die Geburt dieser Tochter ein unvorhergesehenes und in Wahrheit unerwünschtes Ereignis in ihrem Leben gewesen war.
Monika hatte sich gesagt, dass es nicht allzu selten passierte, dass beruflich erfolgreiche Frauen erst spät Kinder bekamen, und erfolgreiche Frauen durchaus häufig in New York arbeiteten. Die Ähnlichkeiten mit ihrer eigenen Familie hatten gewiss nichts zu bedeuten.
»Ich traf diese tief und bereits früh gestörte junge Frau, nennen wir sie Fräulein F., zu zwei Behandlungsrunden. Sie war zwanzig, als die erste Behandlung anfing, oder genauer gesagt, der erste Behandlungsversuch, denn es fehlte ihr an der Fähigkeit zu konstruktiver Introspektion und Objektkonstanz, die notwendig ist, um von einer analytischen Behandlung zu profitieren. Fräulein F. war zu diesem Zeitpunkt von zwei ausländischen Schulen verwiesen worden und hatte in der dritten, einer schwedischen, lediglich aufgrund des starken Drucks der Mutter bleiben dürfen. Sie war eine angespannte und unreife junge Frau, die unter offensichtlichen Problemen mit der Impulskontrolle und Grenzen litt, die ich nun in die analytische Arbeitsweise einführen sollte. Sie war unmotiviert und verbrachte viel Zeit mit unbegründeten Anklagen gegen ihre Mutter und andere Autoritätsgestalten. Ihr Vater – das war natürlich von größter Bedeutung – war zu diesem Zeitpunkt seit vierzehn Jahren tot.«
An dieser Stelle hatten sich Monikas Haare gesträubt.
Das konnte nun wirklich kein Zufall mehr sein. Monikas Großvater war gestorben, als ihre Mutter sechs Jahre alt gewesen war. Ihre Mutter war von einer Schweizer Klosterschule verwiesen worden, die von der Schule in New York, die sie nicht mehr haben wollte, empfohlen worden war. Am Ende war sie in einem schwedischen Internat gelandet, dessen Leitung es nicht gewagt oder nicht geschafft hatte, sie auch von dieser Schule zu werfen.
Die junge Frau, dieses anonyme Fräulein F., konnte eigentlich keine andere sein als Monikas Mutter.
»Disruptive influence«, hatte Monikas Mutter in den seltenen Momenten oft gesagt, wenn sie in Stimmung für einen Rückblick gewesen war. »In New York haben sie behauptet, ich sei ein disruptive influence, und damit hatten sie wohl Recht . . .« Ihr amerikanischer Akzent war übertrieben. Sie lachte über die Unfähigkeit der Schulleitung, mit einer Dreizehnjährigen fertig zu werden, machte sich lustig über die Vorstellung, wie eine Schülerin die anderen so negativ beeinflussen konnte, dass der Schule nichts anderes übrig blieb, als die Eltern zu bitten, sich eine andere Lehranstalt zu suchen.
Eine andere Lehranstalt in einem anderen Erdteil – eine Schweizer Klosterschule, deren jahrhundertelange Erfahrung mit Mädchen aller Art dafür bürgte, dass sie auch dem schwierigsten Fall gewachsen wären. Eine Schule mit klaren Regeln und wohltuender Disziplin. In dieser Schule hatte Monikas Mutter nicht einmal ein halbes Jahr verbracht.
Aber »Fräulein F.«? Das klang erfunden und anachronistisch.
Monika las aufmerksam weiter. Bestimmt würde sie bald weitere Details finden, die bewiesen, dass Fräulein F. eine ganz andere Frau gewesen war, die sie nicht kannte.
Sie verstand nicht, was sie las.
Aggressions- und Sexualpathologie. Identitätsdiffusion. Primitive Affektivität. Unbewusste und verdrängte infantile Sexualität. Primitive Aggressivität in der Sexualität. Distorsion – feuchtes und genitales Vokabular, das Monika unangenehm war. Es war noch peinlicher als die Gelegenheiten, wenn sie in das enge Badezimmer geplatzt war und ihre Mutter überrascht hatte, wie sie sich die Beine rasierte oder Haare aus einem Muttermal auf ihrer Wange zupfte.
Noch dazu war es unverständlich und hörte sich alles andere als normal an.
Monika las weiter.
»Ihr Leben endete – wenig überraschend – jäh und brutal, als sie im Alter von fünfunddreißig Jahren ermordet wurde, vermutlich von einem Mann, dessen Verteidigungsmaßnahmen nicht ausreichten, um den heftigen Hass zu bezwingen, der durch die ungelösten Überführungsbeziehungen entstand, die sich einstellten, als Fräulein F.s unintegrierte infantile Wut auf die Menschen in ihrer unmittelbaren Nähe projiziert wurde.«
Fräulein F. war mit fünfunddreißig Jahren gestorben, genau wie Monikas Mutter.
Das konnte kein Zufall mehr sein.
Aber Fräulein F. konnte unmöglich ihre Mutter sein. Ihre Mutter war nicht ermordet worden. Und bei einem Psychologen war sie auch nicht in Behandlung gewesen.
Oder vielleicht doch? Monika ging auf, wie wenig sie über sie wusste. Über ihre Mutter wurde so selten gesprochen, dass allein Monikas Existenz einen unwiderlegbaren Beweis dafür bot, dass sie überhaupt gelebt hatte.
Es war unbegreiflich. Von dem, was Monika verstand, stimmte alles, bis auf den Kontakt zu diesem Psychoanalytiker und auf den Mord. Danach stimmte gar nichts mehr.
Sie legte das Buch beiseite. Das hier brachte doch nichts.
Sie wurde wütend. Was bildete sich dieser Autor eigentlich ein? Wie konnte er auf diese Weise über eine Frau schreiben, die dadurch wiederzuerkennen war?
Olzén hieß er. Sören Olzén, Psychoanalytiker.
Sie griff wieder zu dem Buch und schlug das Erscheinungsjahr des Buches nach. 1992. Damals war ihre Mutter seit fünfzehn, ihre Großmutter seit zehn Jahren tot gewesen. Vielleicht hatte der Autor geglaubt, es spiele keine Rolle mehr, er könne über Leute, die durch ihren Tod ihre Menschenrechte eingebüßt hatten, sagen, was er wollte. Oder hatte er vielleicht zwei Patientinnen miteinander vermischt – hatte er die Geschichte von Monikas Mutter genommen und mit dem Tod einer anderen Patientin verbunden?
Diese Frage ließ ihr keine Ruhe. Monikas Gehirn, das sich in letzter Zeit so sehr mit fruchtlosen Überlegungen über ihre Zukunft und der Frage beschäftigt hatte, wieso alles so schief gegangen war, stürzte sich dankbar auf diese neue Problematik.
Sie räumte das Frühstücksgeschirr weg und versuchte sich auf diese Tätigkeit zu konzentrieren, was ihr jedoch nicht gelang. Ihre Gedanken kreisten unablässig um Olzéns seltsamen Text.
Eine Bewegung unten auf dem Hof erregte ihre Aufmerksamkeit. Eine junge Frau in einer verschlissenen Jacke stemmte sich mit einer Zigarette in der einen und einer Einkaufstüte in der anderen Hand gegen den Wind. Ihr folgte ein kleines Mädchen, dessen abgenutzter roter Overall an den Beinen Falten warf. Die Ärmel waren so lang, dass die Hände der Kleinen nicht zu sehen waren. Das Ganze wurde von einer schief sitzenden, flauschigen weißen Mütze gekrönt.
Die Winterstiefel der Kleinen waren klobig, so dass sie plötzlich stolperte und der Länge nach auf den Asphalt fiel, sich jedoch rasch wieder aufrappelte. Soweit Monika sehen konnte, schrie sie nicht, sondern rannte einfach so schnell weiter, wie sie in ihrer dicken Kleidung konnte, und versuchte, ihre Mutter einzuholen, die ihr Tempo nicht verlangsamt hatte. Monika spürte den starren Nylon und die Füße, die in den breiten Stiefeln herumrutschten, fast am eigenen Leib. Dann hatte die Kleine die Mutter erreicht und griff vorsichtig nach der Tüte. Die Mutter blickte nach unten, schien sie aufzufordern, loszulassen, und zog abermals an ihrer Zigarette. Sie hatte die schmalen Schultern hochgezogen, gegen die Kälte, gegen den Wind, gegen die Armut.
Beeindruckt von der Entschlossenheit der Kleinen, wählte Monika die Telefonnummer ihres Vaters. Sie musste in Erfahrung bringen, ob ihre Mutter Olzéns Patientin gewesen war.
Besetzt.
Während sie wartete, liefen ihre Gedanken abermals mit ihren Gefühlen um die Wette. Was sollte sie sagen?
»Hallo, wie geht’s dir? Weißt du zufällig, ob Mama psychisch krank war und von einem Psychanalytiker behandelt wurde?«
Unmöglich.
»Hast du je von einem Psychologen namens Olzén gehört?«
Auch unmöglich.
Also fragte sie, ob sie kurz vorbeikommen könne – seine Wohnung war nur fünf Gehminuten von ihrer entfernt, in einem Haus, das nach demselben Plan gebaut war wie alle Häuser in der Gegend.
Er schien sich über ihr Kommen zu freuen, und das machte ihr ein schlechtes Gewissen. Es würde kein schmerzloser Besuch werden, daran bestand kein Zweifel.
Monika wusste, wie ihre Mutter ums Leben gekommen war. Sie war ein kleines Stück von ihrer Wohnung entfernt auf einem Zebrastreifen überfahren worden. Doch Monika hatte keiner Menschenseele jemals verraten, dass sie alles gesehen hatte.
Sie war auf dem Heimweg von einer Freundin gewesen, an einem späten, fast stockdunklen Novembernachmittag. Es hatte heftig geregnet, und der Regen war so kalt gewesen, dass er fast schon in Eisregen übergegangen war. Als Monika um die Ecke bog, sah sie eine Menschenmenge, die sich um ein kleines schwarzes Bündel unmittelbar neben dem Bürgersteig scharte. Auf der anderen Seite des Bündels waren buschige schwarze Haare zu sehen, bei denen es sich jedoch nicht um Haare handelte, sondern um einen Kragen aus Webpelz, einen Kragen, der Düfte ansammelte und an den Monika manchmal heimlich ihre Wange schmiegte. Die hintere, dem Gesicht zugewandte Seite, war von Creme beige verfärbt.
Was hatte dieser Kragen auf der Straße zu suchen? Wieso lag er im Rinnstein, im Schneematsch? Monika wurde von einer Stille erfasst, die sich immer dann über sie legte, wenn in ihrer Nähe eine Katastrophe drohte. In diesem Kragen, in diesem Mantel durfte ihre Mutter nicht stecken. Das reglose Bündel musste etwas sein, das jemand verloren hatte, irgendjemand, der einen ähnlichen Geschmack besaß, hatte auf dem Weg zur chemischen Reinigung etwas fallen lassen. Aber so war es nicht. Die Leute rannten umher, und ihre Körpersprache verriet, dass etwas passiert war, dass niemand etwas verloren hatte.
Monika stand stocksteif und unsichtbar da und weigerte sich, zu glauben, was sie sah. Es war drei Tage vor ihrem dreizehnten Geburtstag.
»Mama«, murmelte sie, aber vielleicht dachte sie es auch nur. Ihre Mutter reagierte nicht, wie so oft, nur dass es diesmal endgültig war.
Später, als der Krankenwagen fort war, war sie wie betäubt nach Hause gegangen, hatte die leere Wohnung betreten, in der es ebenfalls nach Rauch und Parfüm roch. Ihr Vater kam immer erst gegen halb sieben nach Hause, und sie hatte auf ihn gewartet, ohne ans Telefon zu gehen, das alle fünf Minuten läutete, ohne Licht zu machen, ohne zu denken.
Als ihr Vater nach Hause kam und sie im Dunkeln sitzen sah, schaltete er die Lampen ein und nahm das Telefon ab. Sein Gesicht lag im Schatten, deshalb hatte Monika seine Miene nicht erkennen können, sondern hatte nur gesehen, wie er die Schultern anspannte, während sein Körper in sich zusammensackte. Das Gespräch war ziemlich wortkarg verlaufen.
»Ja, ich bin das . . . woher? Ja, das ist meine Frau . . . was? . . . wann? . . . sicher? Ich kann sofort kommen.«
Er hatte weiter ins Leere gesprochen, nachdem er aufgelegt hatte, obwohl er sich Monika zuwandte, die hinter ihm auf dem Sofa saß.
»Das war das Krankenhaus. Mama hatte einen Unfall, ich muss hin. Du wartest hier, oder, nein, geh nach unten zu Ahlgrens. Nein, warte, ich komme mit.«
Sie waren die beiden Treppen zu den Ahlgrens hinuntergegangen, deren Tochter in Monikas Klasse ging. Monikas Vater hatte mit Frau Ahlgren gesprochen, als wäre nichts Außergewöhnliches passiert. Es war ihr deutlich anzusehen gewesen, dass ihr Monikas Besuch ungelegen kam, aber niemand konnte schließlich ein Kind zurückweisen, dessen Mutter eben überfahren worden war.
Als er sie abholen gekommen war, hatte er sich verändert. Er war grauer geworden, kleiner und stummer.
Fahrerflucht, hieß es schließlich, als die Ermittlungen abgeschlossen waren. Ein Auto, das niemals identifiziert werden konnte, war aus der Dunkelheit aufgetaucht, hatte Monikas Mutter in hohem Tempo angefahren und war dann verschwunden. Niemand hatte es danach noch gesehen, und falls der Fahrer unter Drogen oder Alkohol gestanden hatte, dann hatte es ihn nicht daran gehindert, sich vom Unglücksort zu entfernen. Der Wagen hatte offenbar ähnlich ausgesehen wie ein Volvo, aber die Zeugenaussagen gingen auseinander, was das Fahrzeug und eventuelle Insassen anging.
Fest stand nur, dass Monikas Mutter sofort tot gewesen war. Die offizielle Todesursache war ein gebrochenes Genick, aber auch sonst wäre sie an ihrem eingedrückten Brustkorb gestorben oder verblutet. Als der Krankenwagen eintraf, lebte sie schon nicht mehr.
Sich an diesen Tag zu erinnern war, als sehe man sich ein altes Video von schlechter Qualität an – veraltet, schwarzweiß, körnig. Wieso aber sprach der Psychologe von Mord, wenn Babs und Fräulein F. ein und dieselbe waren? Meinte er, sie sei vorsätzlich überfahren worden? Die einfachste und wahrscheinlichste Erklärung war wohl, dass er die Todesursache nicht klar definiert hatte – für ihn bestand vielleicht kein Unterschied zwischen Mord, Totschlag und fahrlässiger Tötung. Andererseits sprach er von Menschen, die Fräulein F. gehasst hatten, und von einem Mann, der sie angeblich ermordet hatte.
Nein, der Analytiker hatte bestimmt eine ganz andere Frau behandelt, eine, die erschossen oder erwürgt oder erschlagen worden war. Es bestand vermutlich kein Grund, Monikas Mutter mit einem Mord oder mit verwirrenden sexuellen Problemen in Verbindung zu bringen. Aber Monika war sich darüber im Klaren, dass ihre Mutter schon lange versuchte, die Aufmerksamkeit ihrer Tochter zu wecken. Ihr letzter Fall – vermutlich im wahrsten Sinne des Wortes ihr letzter, der zu ihrer Beinverletzung geführt hatte – hatte ihre Gedanken auf das Thema Mütter und Töchter gelenkt.
Es war offenbar Zeit, sich mit den Erinnerungen auseinander zu setzen.
Ihre Mutter hatte ein seltsames Vakuum hinterlassen, einen Teil von Monikas Innerem, der ihr stets verschlossen geblieben war. Dieser Teil musste geöffnet werden.
Monikas Mutter. Barbara Ellen.
Monika hatte sie stets Babs genannt, und ihre Bekannten hatten sie mit Babbie, Babsan, Babba, Babsie oder Babette angesprochen.
In einer der wenigen Anekdoten über ihre Großmutter, die Monika zu Ohren gekommen war, ging es darum, wie Barbara Ellen sich ihres Namens angenommen hatte.
»Ich war noch ziemlich jung. Sie nannte mich immer Ellen, aber ich fand diesen Namen so schrecklich. Sie sagte immer, sie habe mich nach Ellen Key so genannt.«
Babs war eine gute Imitatorin gewesen, und Monika, die ihre Großmutter nicht oft genug gesehen hatte, um sich ein eigenes Bild von ihr zu machen, hatte sich mit Hilfe von Babs’ Vorstellungen eines zurechtgelegt.
Babs hatte sich kerzengerade hingestellt, die Lippen zu einer schmalen Linie zusammengepresst und mit leiser, klangvoller Stimme verkündet:
»Du heißt so nach Ellen Key, die dafür gesorgt hat, dass Frauen das Stimmrecht bekommen. Sie war eine starke Frau, die etwas erreichen wollte und ihr Leben dem Versuch widmete, dieser Geißel ein Ende zu machen, die der Krieg so viele Jahrtausende hindurch dargestellt hatte. Sie hatte eine Vision. Ist der Name dir plötzlich nicht gut genug? Du darfst dich nicht Babsie nennen.«
»Aber da«, fügte Babs an dieser Stelle stets hinzu, »da habe ich gesagt dass es überhaupt keine Rolle spielt, ob es ihr recht war oder nicht. Ich hätte nicht vor, noch weiter Ellen zu heißen.«
Sie hielt einen Moment inne.
»Barbara, nach der du ebenfalls heißt, war eine elegante Frau, die sich niemals anders genannt hat als mit ihrem vollständigen, richtigen Namen«, fuhr Babs mit ihrer Imitation fort.
»Darauf scheiß ich, denn ich kann schließlich nichts dafür, nach wem du mich genannt hast, meine Namen gehören jetzt mir, MIR!«
»Reg dich doch nicht auf, Ellen . . .«
»Ich heiße Babsie!«
»Du heißt Barbara Ellen!«
Und dann hatte Babs ihre Trumpfkarte ausgespielt.
»Ellen. Ellen Key. Spielt es denn keine Rolle, dass sie sich geirrt hatte? Nur, weil das Frauenstimmrecht eingeführt wurde, haben die Leute doch nicht aufgehört, Kriege zu führen! Die Alte war doch verrückt. Ihr seid allesamt verrückt. Und ich werde nicht mehr reagieren, wenn du mich Ellen nennst. Und da«, endete Babs mit einem zufriedenen Lächeln, denn von diesem Triumph hatte sie ihr ganzes Erwachsenenleben hindurch gezehrt, »konnte sie einfach nichts mehr sagen oder tun.«
Monikas Großmutter hatte ihre Tochter weiterhin Ellen genannt. Babs hatte sich konsequent geweigert, darauf zu reagieren, was zu allerlei Verwicklungen, Missverständnissen und zurückgesandten Briefen geführt hatte. Keine der beiden hatte jemals nachgegeben.
Dann war Babs ums Leben gekommen, und einige Jahre später war ihre Mutter in ihrer Wohnung in New York im Schlaf gestorben.
Monika konnte sich nicht an ein wirkliches Gefühl von Verlust erinnern, stattdessen hatte sie sich vor allem leer und stumm gefühlt. Sie hatte es vermieden, an Babs oder an ihre Großmutter zu denken.
Doch nun war Babs in Monikas Gedanken zurückgekehrt – ein reichlich unverständlich geschriebener Text in einem Buch, das Monika unter anderen Umständen niemals gelesen hätte, hatte das Tor aufgestoßen. Der Zeitpunkt kam ihr nicht gerade gelegen, aber in solchen Fällen hatte man wohl keine Wahl.
Sie wollte fragen, was Niels über Olzén wusste, ihre stumme Vereinbarung brechen, nicht über Babs zu sprechen. Sie zog ihren Mantel an und dachte an das kleine Mädchen in dem großen Overall.
Was die konnte, konnte Monika ja wohl auch.