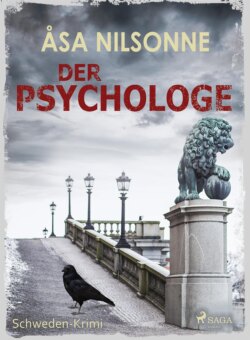Читать книгу Der Psychologe - Schweden-Krimi - Åsa Nilsonne - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеVaterlos war Monikas nicht einmal in ihrer Fantasie jemals gewesen, da ihr Vater sich an ihr schon rein äußerlich viel zu deutlich zeigte. Sie besaß die gleichen dünnen, hellblonden Haare, die gleiche Augenfarbe, irgendwo zwischen Grau, Grün und Blau, und die gleiche runde, ein wenig flächige Gesichtsform. Von Babs’ schmalem Gesicht und ihren braunen Haaren war bei Monika nicht einmal ein Hauch zu erkennen. Auch der gedrungene Körperbau verband Niels und Monika, während Babs lange Arme und Beine und schmale Füße und Finger gehabt hatte.
Jetzt öffnete er die Tür und trat einen Schritt zurück, um sie eintreten zu lassen. Er lächelte, sein gewohntes Lächeln und sagte mit gewohnter Stimme »Willkommen.«
Monika ließ sich wie immer auf dem Sofa nieder und fragte sich, wo sie anfangen sollte.
Am Ende zog sie einfach das Buch aus der Tasche und legte es auf den Couchtisch.
»Ich habe gerade eine Fallstudie in diesem Buch gelesen, die so gut auf Babs passt, dass sie es eigentlich sein muss.«
Niels’ Blick streifte das Buch, dann hob er den Kopf und schaute aus dem Fenster, wo es jedoch offenbar nichts Besonderes zu sehen gab.
»Papa?«
Am Ende blickte er sie mit ausdrucksloser Miene an.
»Darüber will ich nicht sprechen«, sagte er tonlos.
»Du brauchst nur eine einzige Frage zu beantworten. War Babs bei diesem Mann in Behandlung?«
Ihr Vater schwieg eine Weile.
»Hör auf damit, das habe ich doch schon gesagt. Woher hast du dieses Buch überhaupt?«
»Aus der Krankenhausbücherei.«
Er schaute jetzt wieder aus dem Fenster, und sie stellte mit einem unbehaglichen Schauder fest, dass die Existenz des Buches keinerlei Überraschung für ihn darstellte.
»Du hast davon gewusst, ja? Du hast gewusst, dass Olzén über Babs geschrieben hat, aber du hast kein Wort gesagt.«
»Ich sage, dass du damit aufhören sollst. Sie ist jetzt seit zweiundzwanzig Jahren tot, und es bringt nichts, in den alten Geschichten herumzuwühlen.«
»Dann weißt du also auch von seiner Behauptung, dass sie ermordet worden ist.«
»Ich will nicht darüber reden. Ich meine es ernst.«
»Spielt es keine Rolle, was ich will? Ich will wissen, ob Fräulein F. in dem Buch Babs ist.«
Doch die Worte schienen von Niels’ gekrümmtem Rücken abzuprallen. Er hatte sich mühsam aufgerichtet und war in die Diele gegangen, wo er seinen Mantel anzog, um das Haus zu verlassen, fort von diesem Gespräch, mit dem er nicht umgehen konnte. Sie wusste, dass es einige Stunden dauern würde, bis er zurückkehrte, durchnässt und halb erfroren. Sie wusste auch, dass er durch die Tür kommen würde, als sei nichts geschehen, er würde wie immer »Hallo« rufen, und wenn Monikas Fragen noch immer unbeantwortet waren, wenn sie noch immer wütend oder empört war, würde er sie gequält und beleidigt ansehen: Alles sollte wieder gut sein. Alles sollte sein wie immer.
So war es immer gewesen.
Die Tür fiel hinter ihm ins Schloss.
Monika schlug mit der Faust auf die Armlehne des Sofas – verdammt, warum hatte sie in all diesen Jahren keine Gegenstrategie entwickelt? Wieso konnte er sie mit so einfachen Mitteln manipulieren? So dass eine Frage, der er den Rücken kehrte, einfach zu Boden fiel und starb?
Aber diesmal sollte das nicht passieren.
Sie schaute sich in der Wohnung um.
Niels hatte das Kapitel Babs in der Tat endgültig abgeschlossen. Es gab nirgendwo ein Foto von ihr, weder Aschenbecher noch Stofftiere. Früher hatte die Sofaecke, wo Monika jetzt saß, ein wuscheliger großer Eisbär in Beschlag genommen, während in der Küche ein hübsches Stoffhuhn Staub gesammelt hatte. Babs hatte ihr Bett mit so vielen Schmusetieren geteilt, dass gar nicht alle Platz gehabt hatten und wie Opfer einer schrecklichen Katastrophe in den seltsamsten Stellungen und mit blinden Augen auf dem Boden herumlagen. Babs nahm oft ein Schmusetier auf den Schoß oder in den Arm und liebkoste es in einer Weise, wie sie Monika oder Niels niemals liebkost hatte.
Der Eisbär, das Huhn, der Muminvater, sie alle waren verschwunden gewesen, als Monika eines Tages aus der Schule gekommen war. Ins Kinderheim in der Sowjetunion, hatte Niels gemurmelt, für Kinder, die sie brauchen. Für Monika, die oft heimlich an den Tieren geschnuppert hatte, da Babs’ Duft noch in ihrem Fell hing, waren die Tiere eine viel deutlichere Erinnerung gewesen als Fotos, aber sie hatte nicht dagegen protestiert, da es ohnedies zu spät war.
Die Bilder von Babs hatten einst das Regal über dem Herd gefüllt und die Kühlschranktür bedeckt. Egoistisch, hatte Niels geklagt, aber Monika wusste noch, wie Babs sie bisweilen angestarrt hatte, als könnten die Bilder ihr verraten, wer sie war. Sie hatte sich mit einem breiten, aber unpersönlichen Lächeln gesehen, mit ihrem schlanken Körper in vorteilhaften Posituren, rein äußerlich eine junge Frau, die in ihrem Inneren dorthin zu gehören schien, wo sie sich gerade aufhielt.
Am liebsten hatte sie Bilder gemocht, auf denen sie Ähnlichkeit mit Frauen in der Werbung gehabt hatte und ihr eigenes Aussehen nicht so deutlich hervorgetreten war.
Ein Foto, das jahrelang den Kühlschrank geschmückt hatte, war von einem jungen Fotografen mit großem künstlerischem Ehrgeiz aufgenommen worden. Monika, die damals sieben oder acht gewesen war, hatte in der nackten Frau, die vor weißem Hintergrund saß, die Arme um die Knie geschlungen, die Haare vor dem Gesicht, ihre Mutter nicht wiedererkannt.
»Wer ist das denn?«, hatte sie gefragt, verblüfft von der Größe des Bildes, der glänzenden Oberfläche und den harten Kontrasten.
Babs hatte stumm und müde am Küchentisch gesessen; die Luft war vom Zigarettenrauch schon vernebelt gewesen.
Sie war zusammengezuckt und hatte Monika aus rot unterlaufenen Augen angestarrt.
»Was soll das heißen? Erkennst du deine eigene Mutter nicht?«
Eilig war sie gefährlich dicht an Monika herangetreten.
»Glaubst du, ich könnte nicht gut aussehen? Glaubst du, niemand sieht meine Möglichkeiten?«
»Reg dich ab!«, hatte Niels sich eingeschaltet.
Diese Mahnung zeigte niemals irgendeine Wirkung, trotzdem brachte er sie immer wieder an, da er zu glauben schien, Babs werde seinem Rat eines Tages doch noch folgen, sich abregen, wie andere sein.
»Kommandier mich hier ja nicht herum, verdammt noch mal! Reg dich doch selber ab. Reg dich ab, bis du tot bist. Und unbeschreiblich öde. Und . . .«, doch dann hatte ihre Stimme versagt, und sie war in Tränen ausgebrochen. »Ich weiß nicht, warum ich überhaupt versuche . . .«
Monika hatte sich inzwischen Cornflakes geholt, Milch darauf gegossen und angefangen zu essen, obwohl sich ihr Magen zusammenkrampfte, denn sonst würde Niels sie zurechtweisen. Zu einem normalen Leben gehörte schließlich ein Frühstück, und Monika hätte so gern ein normales Leben geführt.
Babs hatte immer heftiger geweint, das machte sie immer so.
»Was tue ich überhaupt hier? Niemand kümmert sich um mich. Ihr habt ja keine Ahnung, wie einsam ich bin . . .«
Und dann hatte Babs sich aufs Sofa zu ihrem Eisbären zurückgezogen, während Niels und Monika schweigend gefrühstückt hatten. Außer Babs’ Schniefen war es totenstill gewesen.
Inzwischen waren die Fotos lange verschwunden, aber Monika sah sie immer noch vor sich; sie wusste genau, wo sie gestanden und wie sie ausgesehen hatten. Ein einziges Bild von damals war noch da – das der kleinen Bethlehem, die wie immer auf dem Sims über dem Herd stand.
»Bethlehem«, hatte Monika eingewandt, als ihre Mutter das kleine Foto in einem billigen neuen und etwas zu großen Rahmen aufgestellt hatte. »Bethlehem ist doch eine Stadt, oder? So kann sie doch nicht heißen.«
Babs hatte den Text auf der Rückseite des Bildes noch einmal gelesen, kurz gezögert und noch einmal gelesen.
»Doch. In Äthiopien kann man offenbar Bethlehem heißen, hier steht jedenfalls Name und nicht Geburtsort. Sie wissen wohl nicht, wo sie geboren worden ist, sondern schreiben nur, ›in der Nähe von Mekele‹.«
Monika hatte Bethlehem lange betrachtet. Bethlehem trug ein schmutziges kariertes und zu weites Kleid, ihre Füße waren nackt und staubig, und um ihren Hals hing ein Amulett oder Anhänger an einem Lederriemen. Was vor allem überraschte, war ihr Lächeln. Es hätte zu einem kleinen Mädchen gepasst, das bei einem lustigen Spiel zusah oder es gerade auf dem Fahrrad bis zum Tor geschafft hatte, ohne umzukippen oder mit den Füßen den Boden zu berühren.
Dank Monika und ihren Eltern konnte sie jetzt in einem Heim wohnen, wo sie etwas zu essen und Kleider bekam und zur Schule ging.
Aber Bethlehem!
Man konnte doch keine Schwester haben, die Bethlehem hieß, so wenig wie eine Schwester Göteborg oder Helsingfors heißen konnte. Bettie, das war ein passender Name für eine Schwester. Bettie sollte sie heißen, wenn Monika an das kleine Mädchen mit dem strahlenden Lächeln dachte, an das Mädchen, das glücklicher und munterer lächelte, als Monika auf irgendeinem Foto, das sie in demselben Alter zeigte.
Und Bethlehems Foto war noch da gewesen, als alle Bilder von Babs verschwunden waren. Monika hatte nicht mitbekommen, wie Niels sie entfernt hatte, wie sein Gesicht ausgesehen hatte, als er die Bilder von der Wand genommen, die Klebestreifen abgepult und den Klebstoff weggekratzt hatte. Sie wusste nicht einmal, ob er die Fotos weggeworfen oder nur verpackt und irgendwo verstaut hatte. Sie fragte sich, ob er getrauert hatte. War er wütend gewesen, oder hatte er sich vielleicht geschämt?
Hier in der Wohnung war jedenfalls keine Spur von Babs mehr. Und wenn Niels nicht über sie sprechen wollte, gab es kaum jemanden, der Monika sonst helfen konnte. Babs hatte keine Geschwister gehabt, und ihre Eltern waren schon seit vielen Jahren tot.
Monika ging zurück zum Bücherregal. Dort hatte Niels nicht so sorgfältig Ordnung geschaffen wie in der übrigen Wohnung. Die Bücher der Großmutter standen immer noch da. Ihre dreibändige Autobiografie. Monika hatte sie nie gelesen – teils, weil sie sich an Babs’ Reaktion auf den dritten Band erinnerte. Monika zog ihn hervor – ja, er war noch immer verzogen, und die eine Ecke war geknickt, weil Babs das Buch an die Wand geworfen hatte, als sie festgestellt hatte, dass sie nicht darin vorkam. Wer es nicht besser wusste, hätte durchaus glauben können, Babs habe niemals existiert, sei niemals geboren worden. Der trockene Kommentar von Monikas Großmutter, das Buch handele von dem, was in ihrem Leben wichtig war, nämlich von dem, was sie geleistet hatte, war ebenfalls alles andere als hilfreich gewesen. Auf dem Vorsatzblatt stand mit schwarzer Tinte und kleiner Handschrift:
»Für meine liebe Ellen von Mutter.«
Die Lektüre dieser Bücher wäre Babs gegenüber unsolidarisch gewesen, außerdem waren sie schwer verständlich und langweilig, zumindest hatte Monika es als Zwölfjährige so empfunden.
Aber vielleicht halfen sie ihr weiter, schließlich hatte die Großmutter Babs ihr Leben lang gekannt.
Als Monika das Buch in der Hand hielt, musste sie wieder an die Beerdigung der Großmutter denken. Damals sie war siebzehn gewesen, und sie und Niels hatten als die einzigen Verwandten daran teilgenommen. Aber es war eine große Trauerfeier gewesen. Was der Großmutter an Verwandtschaft gefehlt hatte, hatte sie durch ihre beruflichen Kontakte wettgemacht. Es hatte viele prachtvolle Kränze gegeben – von der UNO, vom Außenministerium (ein Kranz in den schwedischen Landesfarben), von Organisationen und Verbänden jeglicher Art.
Die Frau, über die der Pastor sprach und die so vielen Menschen offenbar so viel bedeutet hatte, hatte kaum Ähnlichkeit mit Monikas vagen Erinnerungen an ihre Großmutter besessen. Die Großmutter war groß, sehnig und ungeduldig gewesen, und bei den seltenen Gelegenheiten, wenn sie einander begegnet waren, hatte Babs sich stets seltsam angespannt und schnippisch gezeigt. Monika war so gut wie nie allein mit ihrer Großmutter gewesen, erinnerte sich aber noch genau daran, dass sie ständig hatte wählen müssen – zwischen Puppen, die sie nicht haben wollte, zwischen Kuchen, von denen sie wusste, dass sie sie niemals aufessen würde. Sie erinnerte sich an die Gereiztheit ihrer Großmutter und an ihre eigene Unzulänglichkeit: nicht einmal eine so einfache Wahl konnte das Kind treffen. Es waren alte, undeutliche Erinnerungen, die das Gedächtnis zu einer Stimmung, zu einer Reihe verblasster Empfindungenreduzierte.
Aus einem Impuls heraus nahm Monika alle drei Bücher mit, als sie ging. Das erste hieß »Anlauf« und behandelte die Jugend der Großmutter in Sundsvall, der zweite Band mit dem undurchsichtigen Titel »Der Einsturz des Weltengebäudes« schilderte die Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg, und das letzte hieß »Die Jahre bei den Vereinten Nationen«. Der Umschlag des ersten Bandes zeigte Schwarzweißbilder der Großmutter als weißblonder Backfisch, den Blick in die Ferne gerichtet. Der zweite bestand aus einer Collage – die Großmutter, Mussolini und ein geschmeidiger, braunhäutiger Mann mit würdevoller Haltung und festem Blick. Der dritte Umschlag war so nichtssagend wie der Titel. Vor dem UNO-Gebäude war die Großmutter an einem Rednerpult zu sehen.
Auf dem Heimweg schmiedete Monika Pläne. Sie wollte wissen, ob Fräulein F. Babs war – und wenn Niels nicht mit ihr reden wollte, musste sie eben Olzén fragen.
Sie hoffte nur, dass er noch lebte. Und dass die gesuchten Informationen noch in der kollektiven Datenbank namens Menschenhirn zu finden waren.
Zum ersten Mal seit langer Zeit kam sie gern nach Hause. Sie hatte eine Aufgabe, ein Ziel, und die freie Zeit, die vor ihr lag, hatte plötzlich einen Sinn, statt ein Problem darzustellen.
Wie immer fing sie mit dem einfachsten Teil der Aufgabe an. In diesem Fall griff sie zum Telefonbuch. Als sie die Hand danach ausstreckte, schien etwas mit dem Zimmer zu geschehen: das Licht war mit einem Mal schärfer, und es wurde kälter. Ihr Körper verriet Monika, dass jetzt der Arbeitsgang eingeschaltet war, ob sie wollte oder nicht. Offenbar glaubte ihr Körper, dass sie mit einer neuen Ermittlung begann. Monika staunte, dass ihr Körper sie so verraten konnte.
Sie wusste, dass dies keine normale Ermittlung war, was auch immer ihr Körper glauben wollte, sie wusste es, obwohl sie von einem höchst vagen Verdacht ausging und die Wahrscheinlichkeit, mehr als zwanzig Jahre zurückliegende Sachverhalte aufklären zu können, gering war. Gleichzeitig fragte sie sich, ob es ein formaler Fehler war, sich in ihrer eigenen Branche sozusagen freiberuflich zu betätigen. War sie überhaupt befugt, eine inoffizielle kleine Mordermittlung in eigener Sache zu starten?
Sie unterbrach sich bei diesem Gedanken. Das hier war keine Mordermittlung, sondern sie war einfach eine Tochter, die wissen wollte, was mit ihrer Mutter passiert war. Daran konnte ja wohl niemand Anstoß nehmen.
Und, Fehler hin oder her, der Startschuss war gefallen.
Sie blätterte im Telefonbuch.
Olzén, das konnte kein gängiger Name sein, sondern eine Variante, die Namen wie Olsson und Nilsson und Andersson in individuellere, historisch gesehen jedoch belanglose Nachnamen verwandelte.
Einen Sören Olzén gab es nicht. So leicht sollte es also nicht sein.
Der nächste Schritt war die Auskunft – er konnte immerhin nach Sigtuna oder Vadstena oder an einen anderen ruhigen Ort gezogen sein, wo alte Leute gern ihren Lebensabend zubrachten.
Aber das hatte er offenbar nicht getan, denn er hatte eine Geheimnummer, was annehmen ließ, dass er noch lebte und nach wie vor in Stockholm wohnte.
Also musste sie ihr Glück beim Berufsverband versuchen, den sie im Telefonbuch fand: die Psychoanalytische Vereinigung.
Eine freundliche Frauenstimme meldete sich, und Monika schilderte ihr Anliegen.
»Soll das heißen, Sie wissen nicht, ob Ihre Mutter bei Herrn Olzén in Behandlung war?«
»Ja. Aber als ich sein Buch gelesen habe, kam mir der Verdacht, das meine Mutter Patientin bei ihm war.«
»Was ist danach aus ihr geworden?«
»Nichts Gutes. Sie ist gestorben. Und in seinem Buch behauptet er, dass sie, wenn sie es denn tatsächlich war, ermordet worden ist.«
»Und Sie wissen auch nicht, ob Ihre Mutter ermordet worden ist?«
»Nein, deshalb würde ich ja gern Kontakt zu ihm aufnehmen.«
»Und wie alt waren Sie, als das passiert ist?«
»Zwölf.«
Das Gespräch wurde langsam zum Verhör.
»Über das alles möchte ich mit ihm selbst sprechen. Ich wollte Sie wirklich nur um seine Telefonnummer bitten«, sagte Monika.
»Seine Geheimnummer?«
»Ja.«
»Dann haben Sie wohl nicht verstanden, warum er eine Geheimnummer hat. Bei unserer Arbeit stoßen wir auf so viele Probleme, auf so vieles, das starke Gefühle weckt. Nicht alle können uns als Fachleute und Privatpersonen auseinander halten. Ich gebe Ihnen den Rat, falls Sie nicht damit fertigwerden, dass Ihre Mutter Sie in einem so verletzlichen Alter im Stich gelassen hat, und ich kann wirklich verstehen, dass so etwas möglich ist, jedenfalls lautet mein Rat, suchen Sie sich einen eigenen Therapeuten, mit dem Sie über das alles reden können.«
»Ich will aber keine Therapie machen. Ich werde doch das Recht haben zu erfahren, ob meine Mutter bei diesem Olzén in Behandlung war.«
»Wenn sie bei ihm in Therapie oder Analyse war und zu Hause nichts davon erwähnt hat, dann hatte sie sicher ihre Gründe. Er musste ihren Wunsch respektieren und auf ihrer Seite stehen, auch wenn sie jetzt tot ist, und auch wenn er aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz über sie geschrieben haben sollte.«
»Das ist doch lächerlich. Sie können doch nicht wissen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, und es kann wohl nichts schaden, wenn ich mit Olzén spreche.«
»Ich glaube, wir kommen hier nicht weiter. Sie können einen Brief schreiben und an uns schicken. Wir leiten ihn gern an ihn weiter. Dann kann er selbst entscheiden, ob er mit Ihnen sprechen will. Aber eigentlich können Sie sich die Mühe sparen – er wird nicht mit Ihnen reden wollen, aus berufsethischen Gründen.«
Monika spürte, wie die Wut in ihr hochstieg, was im Vergleich zu der Gleichgültigkeit der vergangenen Monate immerhin ein Fortschritt war.
Und es machte ihr Mut. Sie hatte Widerstand immer schon zu schätzen gewusst und würde nicht lockerlassen, bis sie Olzéns Nummer hatte.
Wer nicht durch die Tür ins Haus gelangt, muss eben das Fenster nehmen. Sie rief den Verlag an, der Olzéns Buch veröffentlicht hatte.
Sie überlegte, was sie sagen sollte. Die Wahrheit, dass sie eine Tochter war, die ihre Mutter suchte, schien als Strategie nicht zu funktionieren, jedenfalls hatte sie bei der Analytiker-Vereinigung keine Wirkung gezeigt. Monika entschied sich daher für eine andere Methode.
In ihrer Eile hätte sie sich der Verlagsangestellten beinahe als Kriminalkommissarin vorgestellt, ehe sie in letzter Sekunde auf Journalistin umschwenkte. Sie arbeitete angeblich an einer Reportage über Psychoanalyse und wollte deshalb gern mit Sören Olzén sprechen. Die Lüge kam ihr überraschend leicht über die Lippen, und als Belohnung erhielt sie ohne weitere Fragen seine Adresse und seine Telefonnummer.
Wenige Minuten später brachte sie mit derselben Leichtigkeit noch einmal die gleiche Lüge vor. Seine dünne Greisenstimme hatte der Journalistin, die ihn interviewen wollte, nichts entgegenzusetzen. Sie sei jederzeit willkommen, jedenfalls ab dem nächsten Tag, da er sich erst vorbereiten müsse.
Monika bemerkte, dass sich nicht nur das Zimmer verändert hatte – plötzlich hatten die Zeiger ihrer Uhr einen großen Sprung nach vorn gemacht. Die Minuten, die nach dem Unfall so lang gewesen waren, waren nun kürzer, strömten vorüber und waren unwiederbringlich verschwunden.
Sie bemerkte auch, dass sie Angst hatte.
Unmittelbar nach Babs’ Tod war sie in Monikas Träumen und Erinnerungen ebenso unkontrolliert aufgetaucht wie früher in ihrem Leben. Im Traum stand Babs zumeist in der Tür zu Monikas kleinem Zimmer. Es war spät, und im Schein der Dielenlampe konnte Monika nur eine dünne, dunkle Frauengestalt sehen, die sich schwankend gegen den Türrahmen lehnte und hungrig an ihrer Zigarette zog.
Angst und Sehnsucht keimten gleichzeitig in ihr auf, neutralisierten sich gegenseitig und wichen Enttäuschung und Zorn, nur um kurz darauf wieder aufzuflammen und jedes andere Gefühl zu überflügeln. Monika wollte Mammmmmaaaa schreien, wollte gestreichelt werden, und sei es mit noch so ungeschickter Hand. Doch gleichzeitig wollte sie nicht von Babs angefasst werden, da es keine echte Berührung war und sie am nächsten Morgen schon keine Gültigkeit mehr hätte. Sie wollte nicht, dass Babs hereinkam, und sehnte sich zugleich brennend danach, dass sie es tat.
Babs’ Auftauchen in Monikas Träumen hatte dieselbe Wirkung wie früher im Leben – wie erstarrt lag Monika da, wie gelähmt, konnte sich nicht rühren, war erfüllt vom raschen, ängstlichen Schlag ihres Herzens, eines Herzens, das sich in ihrem kleinen Brustkorb auszudehnen schien und sie im nächsten Augenblick in einer Explosion aus heißem Blut zerfetzen würde. Dieser Traum, diese Erinnerung hatten ihr viele Jahre Angst gemacht.
Mit anderen Erinnerungen an Babs wurde sie besser fertig. Einige wenige waren harmlos, wie zum Beispiel Babs hinter dem Verkaufstresen in der Kosmetikabteilung eines Kaufhauses, von wo aus sie Monika zuwinken konnte wie eine normale Mutter. Oder Babs’ Gesicht, wenn sie sich konzentrierte und Mund und Augenbrauen zusammenzog, was sie so witzig aussehen ließ, ein Gesicht, über das man sogar lachen konnte, das keineswegs beängstigend wirkte. Ebenso wie ihr seltenes, kumpelhaftes Lächeln.
Und jetzt wollte Monika dieses Muster durchbrechen. Sie wollte versuchen, sich deutlicher zu erinnern statt weniger – ein Gedanke, bei dem ihr Körper sich anspannte.
Aber andererseits hatte sie ja keine Wahl.
Sie musste es tun.
Und wenn nicht jetzt, wann dann?
Sie holte tief Atem und versuchte bewusst, die Mauer, die sie zwischen sich und ihren Erinnerungen an Babs errichtet hatte, zum Bröckeln zu bringen. Die Mauer wies ohnedies etliche Risse auf, die Bildern und Gedanken Durchlass gewährt hatten – sei es in nächtlichen Träumen oder in kleinen, beängstigenden Momenten im Alltag, wenn etwas eine magische Schleuse geöffnet hatte. Ab und zu reichte es, eine große schlanke Frau in einem bodenlangen Mantel davoneilen zu sehen, oder zu beobachten, wie sich das Gesicht einer jungen Frau verzog, wenn das Nikotin durch ihre Venen strömte.
Die Mauer war unzuverlässig gewesen, aber nun, da Monika versuchen wollte, sich ganz bewusst zu erinnern, hielt sie auf einmal stand.
Ihr wollte beim besten Willen nichts einfallen.
Doch sie brauchte diese Erinnerungen. Vielleicht lag die Antwort auf ihre Fragen in ihr selbst, irgendwo hinter der Mauer. Immerhin hatte sie mit Babs zusammengelebt, hatte sie gesehen, gehört, sie so geliebt, wie sie es eben gekonnt hatte, hatte sie gehasst und Angst vor ihr gehabt.
Sie machte einen neuen Versuch.
Doch da war nichts als Leere.
Sie war zu ihrer eigenen widerwilligen Zeugin geworden. Vor ihrem geistigen Auge entstand ein Bild von ihr selbst in zwei Versionen, die einander an einem Tisch in einem Verhörzimmer gegenüber saßen. Bei diesem Bild musste sie auflachen, und dann passierte es plötzlich.
Eine winzige Erinnerung tauchte auf, nicht an Babs selbst, sondern an das Gewimmel aus kleinen Tuben, Flaschen, Hülsen und Döschen um sie herum. Die meisten davon waren klebrig, staubig und verschmutzt, als hätten sich die unterschiedlichen Produkte miteinander vermischt, während sie in Schminkbeuteln, Handtaschen, Küchenschubladen, Manteltaschen oder einfach an der Stelle lagen, wo Babs sie gerade deponiert hatte. Das Bild erweiterte sich zu einem Bild von Babs’ Haut – sie war hell und leicht sommersprossig gewesen, abgesehen vom Gesicht, wo sie einen gleichmäßigen matten Beigeton aufwies. Auf ihren Wangen waren dunkelrote Striche zu sehen gewesen, die die Wangenknochen betonten – das hatte Babs gesagt –, obwohl Monika im ovalen Gesicht ihrer Mutter niemals Wangenknochen entdeckt hatte. Dieses Gesicht, diese Schminke hatte sie nie berühren dürfen.
Monika fragte sich unvermittelt, ob ihre eigene Abneigung gegen Make-up darin begründet sein könnte.
Das musste reichen. Sie war völlig erschöpft.
Außerdem brauchte sie unbedingt jemanden zum Reden. Sie schaffte es nicht, ihre Gedanken ganz allein zu ordnen, und es gab nur einen, an den sie sich wenden konnte: Mikael, ihren besten Freund. Er war zwar gerade erst mit Patrik zusammengezogen, aber sie würde eben sehen müssen, wie sich ihr Verhältnis nach dieser Veränderung entwickelte. Sie war den beiden aus dem Weg gegangen, um nicht zu stören, was ihr mit einem Mal reichlich töricht vorkam.
Sie rief an. Mikael war am Apparat und schien sich zu freuen.
»Wie schön, dass du anrufst – hier ist es ein bisschen chaotisch, aber damit kannst du sicher leben. Klasse!«