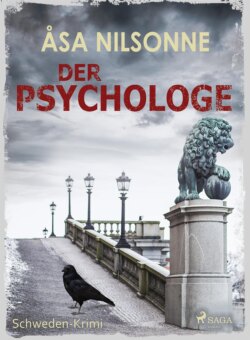Читать книгу Der Psychologe - Schweden-Krimi - Åsa Nilsonne - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеWährend sie bei Olzén gewesen war, hatte der Regen an Stärke zugenommen. Als sie die Haustür öffnete, schlug ihr die Luft entgegen – kühl, feucht und angenehm.
Da sie weder Schirm noch Regenmantel dabei hatte, beschloss sie zu warten. Kurz darauf wurde die Tür aufgerissen, und ein Mann in ihrem Alter kam herein. Das Wasser tropfte aus seinen strähnigen Haaren, seine Jacke war an den Schultern und auf dem Rücken dunkel vor Feuchtigkeit, und er trug rote Turnschuhe, die vollkommen durchweicht waren.
Lächelnd zog er einen Schlüssel heraus und öffnete die Tür zu der Wohnung im Erdgeschoss. Im Türrahmen fuhr er sich mit der Hand übers Gesicht.
»Sieht aus, als hätte Sie der Regen überrascht. Darf ich Ihnen eine Tasse Tee anbieten?«
Monika, die bislang nur gute Erfahrungen mit Gesprächen mit Nachbarn gemacht hatte, nahm das Angebot an. Wenn sie Glück hatte, erfuhr sie vielleicht etwas Interessantes. Sie betrat die Wohnung, die deutlich heller und luftiger als Olzéns war. Teilweise war dies der spärlichen Möblierung aus hellem Holz zu verdanken, die von der letzten Möbelmesse zu stammen schien, und einem großen Fenster, das auf eine verglaste Veranda hinausging.
»Ich heiße Marcus«, erklärte ihr Gastgeber. »Setzen Sie sich doch, während ich Wasser aufsetze und mir etwas Trockenes anziehe. Es ist wirklich toll hier, aber eigentlich wohne ich hier gar nicht. Ich bin nur da, wenn die eigentliche Mieterin verreist, und das tut sie oft. Ich kümmere mich um die Post, die Blumen, die Katzen und all das. Es ist wie ein inoffizielles Schriftstellerstipendium. Wirklich überaus praktisch.«
Und damit war er verschwunden. Monika ließ sich gedankenverloren auf ein weißes Sofa sinken, ohne auf ihre Umgebung zu achten.
Das unangenehme Gefühl, schachmatt gesetzt worden zu sein, überwog ihre Neugier auf Marcus’ Wohnung. Ihre Gedanken waren noch ein Stock höher, bei Olzén.
»Sie sehen völlig geschafft aus. Waren Sie bei dem alten Psycho?« Marcus hatte sich inzwischen umgezogen und brachte Tee in Bechern, die exakt zu den Möbeln passten.
Monika nickte. Wie gut, damit brauchte sie sich keine Mühe zu geben, das Gespräch auf Olzén zu bringen.
»Ich wollte ihn interviewen.« Sie hielt inne.
»Hat er noch immer Patienten?«, fragte sie, als ihr die Bedeutung seiner Frage aufging.
»Ich glaube schon. Jedenfalls kommen immer dieselben, und immer zur selben Zeit. Zu welchem Thema wollten Sie ihn interviewen?«
»Zu seinem Buch.«
»Ich wusste gar nicht, dass er eins geschrieben hat. Wovon handelt es denn?«
»Von seinen Patienten. Seiner Arbeit. Seinen Theorien.«
»Ist es gut?«
Sie musste sich in Acht nehmen. Sie wurde ausgefragt, statt selbst Informationen zu sammeln. »Ob es gut ist? Für eine Außenstehende ist das schwer zu sagen. Er scheint jedenfalls sehr genau vorgegangen zu sein. Die Details stimmen offenbar alle. Kennen Sie ihn?«, meinte sie trotzdem freundlich.
»Ich habe noch nie mit ihm gesprochen, er scheint nicht viel Kontakt zu den Nachbarn zu haben. Jedenfalls nicht mit mir. Ich sehe ihn vor allem, wenn er mit seiner Frau unterwegs ist. Sie fährt ihn montags, mittwochs und freitags im Rollstuhl spazieren, und zwar Punkt halb elf. Er ist immer ganz korrekt angezogen, falls das etwas darüber aussagen kann, wie glaubwürdig sein Buch ist.«
Er überlegte.
»Flüchtigkeitsfehler begeht er bestimmt nicht, aber ansonsten sind Pedanten wahrscheinlich auch nicht glaubwürdiger als andere . . .«
»Er hat also eine Frau?«
»Ich glaube schon. Meinen Sie, sie sind nicht verheiratet und leben in Sünde?«
»Das habe ich nicht gemeint. Ich habe eine Frau von Mitte fünfzig gesehen, die er mir als seine Pflegerin vorgestellt hat, aber das war vielleicht nicht dieselbe.«
»War sie klein, mit glatten grauen Haaren, einem runden Gesicht, schmalen Schultern und einem breiten Hintern?«
So hätte Monika Schwester Marit vielleicht nicht beschrieben, aber das musste sie sein. Sie nickte.
»Geht es ihm so schlecht, dass er eine Pflegerin braucht?«, fragte Marcus.
»Das glaube ich nicht. Ich hatte den Eindruck, dass sie früher in seiner Praxis gearbeitet hat und jetzt noch immer bei ihm ist.«
»Wozu braucht ein Psychologe wohl eine Krankenschwester?«
»Keine Ahnung, und ich bin auch nicht auf die Idee gekommen, danach zu fragen.«
Marcus’ Haare waren inzwischen fast trocken. Sie waren von einem hellen Aschblond und zu einer Prinz-Eisenherz-Frisur geschnitten. Er schien sich den Schnitt selbst mit einer stumpfen Schere vor dem Badezimmerspiegel verpasst zu haben, und es war nicht auszuschließen, dass er auch den grobmaschigen bunten und verfilzten Pullover selbst gestrickt hatte.
Doch sein Gesicht leuchtete vor Enthusiasmus und Interesse. Monika konnte sich nicht erinnern, jemals so hellbraune Augen gesehen zu haben. Sie sahen aus wie Puppenaugen, klar und ganz ohne jegliche farbliche Schattierung.
»Was halten Sie übrigens von dem Wort unselbstkritisch?«, fragte er unvermittelt.
Monika hatte keine Ahnung, worauf er hinauswollte. Sie durchforstete ihr Gehirn nach einer brauchbaren Antwort.
»Für einen Titel, meine ich. Könnte ein Buch heißen: ›Der unselbstkritische Mensch. Eine Studie über Übermut und Fehlschlüsse?‹ Überkommen Sie bei diesem Titel Kauf- und Leselust?«
Diese Frage konnte sie immerhin sofort beantworten.
»Nein.«
»Genau. Trotzdem wird unser Leben dauernd von den Missverständnissen und schlecht begründeten Beschlüssen anderer Menschen beeinflusst. Sie sprechen von unvorhergesehenen Konsequenzen oder neuen Tatsachen. Die Wahrheit ist, dass unser Gehirn unseren Entscheidungen nicht gewachsen ist, und deshalb sitzt die Menschheit dermaßen im Dreck.«
Er lachte.
»Von solchen Dingen handelt mein Buch. Im Moment schreibe ich über Hyperthermophile.«
Seine Augen funkelten jetzt und ließen seine Umrisse deutlicher hervortreten, als komme nun sein inneres verstecktes Wesen an die Oberfläche.
»Hyperwas?«, fragte Monika interessiert.
»Hyperthermophile. Das klingt fast wie eine ungewöhnliche sexuelle Veranlagung, aber es geht um Lebensformen, die sich dort wohl fühlen, wo es schrecklich warm ist. Früher war man davon überzeugt, dass Leben bei extrem hohen Temperaturen nicht möglich ist. Wenn Sie einen Krebs oder eine Möhre oder eine Syphilisbakterie kochen, dann sterben Sie. Aber jetzt hat sich herausgestellt, dass es Dutzende von zumeist einzelligen Organismen gibt, die insbesondere am Siedepunkt gedeihen.«
Er kramte in seinen Papieren herum und beförderte einige körnige Fotokopien von etwas zu Tage, das aussah wie ein Dutzend schwarze Tennisbälle. Er schob die Kopie über den Tisch.
»Sie haben übrigens wunderbare Namen. Wie finden Sie zum Beispiel Pyrodictum abyssi oder Pyrococcus? Wir unselbstkritischen Menschen sind immer davon ausgegangen, dass das, was für uns gilt, auch für alle anderen gelten muss. Unsere Enzyme funktionieren nicht, wenn sie erhitzt werden, deshalb glauben wir, dass es bei anderen genauso ist. Wir atmen Sauerstoff, deshalb kommen wir gar nicht erst auf die Idee, nach Lebensformen zu suchen, die ihre Energie aus anderen Stoffen ziehen. Die Hyperthermophilen können auch Schwefel oder Stickstoff einatmen. Das bedeutet, dass sie weder Wasser noch Licht brauchen, um zu wachsen und sich zu vermehren. Wir könnten unten im Urgestein, in dem sie hausen, nicht überleben, deshalb haben wir dort auch nie nach Leben gesucht.«
Monika lächelte, angesteckt von seiner Begeisterung für ein Thema, von dem sie noch nie gehört hatte.
»Was sagen Sie dazu, dass ihre niedrigste Wachstumstemperatur bei achtzig Grad Celsius liegt, die obere bei hundertdreißig und die optimale bei hundertsechs? Außerdem können sie auf minus hundertvierzig Grad eingefroren werden, und das bedeutet, dass sie eine Reise ins Weltall überleben würden, eingebettet in ihre Steine, und auf dem nächsten Planeten weiterleben könnten, wenn es dort warm genug wäre. Vielleicht sind die Hyperthermophilen die wahren Astronauten – vielleicht haben sie sich im ganzen All verbreitet. Vielleicht sind sie unsere Ahnen.«
Monika lachte.
»Mein nächstes Kapitel soll von militärischen Irrtümern handeln. Dafür gibt es so viele Beispiele, dass ich glatt zwei Bände füllen könnte. Eines steht jedenfalls fest: unsere Historiker, die von brillanten Strategien und fähigen Generälen sprechen, können Glück und Geschick nicht unterscheiden.«
Inzwischen hatte es aufgehört zu regnen. Monika bedankte sich für den Tee und stand auf. Auf dem Weg hinaus kam sie an einem Bücherstapel vorbei. Ihr Blick fiel auf das oberste Buch, auf dessen Einband eine bekannte Silhouette zu erkennen war. Das Buch handelte von Mussolini, jenem Politiker, der auch auf dem Band ihrer Großmutter abgebildet war. Es konnte sogar durchaus dasselbe Bild sein. Monika fragte, ob sie sich das Exemplar für einige Tage leihen könne. Marcus, der ein vertrauensseeliger Kerl zu sein schien, war einverstanden.
Erschöpft saß Monika im Bus. Nach der Unterforderung der letzten Zeit empfand sie die jüngsten Ereignisse als höchst anstrengend.
Zuerst Babs, Niels, Olzén und Eloïse, jetzt Marcus, Mussolini und hyperthermophile Bakterien.
Babs, die sich seit so vielen Jahren ganz dicht hinter Monikas Bewusstsein rührte. Niels und Olzén, die nicht mit ihr sprechen wollten. Eloïse, die ihr beibringen wollte, was Babs nicht mehr geschafft hatte.
Die Anzahl der offenen Fragen wurde immer größer.
Jetzt konnte sie nur noch die Mitarbeiter der Kanzlei fragen. Das würde sie als Erstes tun, wenn sie nach Hause kam. Es musste doch noch jemanden, oder sogar mehrere geben, die sich an Babs erinnerten. Es kam sicher selten vor, dass eine Mitarbeiterin so plötzlich starb, und außerdem war Babs keine unauffällige Frau gewesen. Es musste jemanden geben, dem sie sich anvertraut hatte. Und diesen Jemand galt es zu finden.
Die Stimme, die sich bei Granat & Hamid meldete, klang nach Geld und Selbstsicherheit.
»Ich würde gern mit Herrn Granat sprechen.«
»Haben Sie einen Termin für dieses Gespräch vereinbart?«, fragte die kühle Stimme.
»Nein . . .«
»Herr Granat ist im Moment leider sehr beschäftigt und nimmt keine neuen Fälle an.«
Es war ein klares Handicap, dass sie ihrem Gegenüber nicht mitteilen konnte, dass der viel beschäftigte Mann die Wahl hatte – entweder sprach er sofort mit ihr, oder er kam auf die Wache und stellte sich dort ihren Fragen. Aber daran ließ sich nichts ändern.
»Ich brauche keinen Anwalt, sondern habe nur ein paar Fragen . . .«
»Er gibt leider keine Interviews.«
Als Nächstes würde sie sicher sagen, dass er auch nichts kaufen wollte, aber Monika kam ihr zuvor.
»Und wie ist es mit Herrn Hamid?«
»Auch der ist auf lange Sicht ausgebucht. Soll ich Ihnen eine andere Kanzlei empfehlen?«
Monika lehnte ab und ließ sich in einen Sessel sinken.
Das Ganze lief keineswegs gut. Also musste sie es auf andere Weise versuchen. Sie bemerkte, dass sie zu müde war, um sich mit dieser Frage herumzuschlagen, und griff zu den Büchern ihrer Großmutter. Sie fing mit dem ersten Band an. Erst kürzlich hatte sie entdeckt, dass es durchaus lohnend sein konnte, dort anzufangen, wo die Geschichte begann.
»Ich bin so alt wie das Jahrhundert«, lautete der erste Satz. »Ich bin so alt wie das Jahrhundert, in dem die moderne Zivilisation die Menschheit von den vier Reitern der Apokalypse befreien wollte, jenem Jahrhundert, in dem Pest, Krieg, Hunger und vorzeitiger Tod die leidende Menschheit endlich aus ihrem Zugriff entlassen sollten.«
So alt wie das Jahrhundert. Die Großmutter wäre jetzt also hundert, wenn sie noch lebte. Das hatte sie nicht gewusst. Sie las weiter und stellte fest, wie wenig sie über ihre Großmutter wusste. Die Großmutter war in Sundsvall aufgewachsen, hatte das Entsetzen des Ersten Weltkriegs durch Zeitungsberichte und durch die ruckhaften schwarzweißen Wochenschauen im Kino erlebt und außerdem in Finnland einen geliebten Vetter verloren.
Sie war ein Einzelkind gewesen. Papas Mädel.
Monika verstand nicht, wieso sie die Bücher nicht schon längst gelesen hatte. Sie waren zwar in einer bürokratischen Sprache verfasst, aber immerhin stammten sie von ihrer Großmutter. Hier ging es um eine junge Frau, die aus ihrem Leben etwas machen wollte, die berichtete, dass sie von Präsident Wilsons Vierzehn Punkten für einen Friedensplan 1918 so ergriffen gewesen war, dass sie daraus ihre Lebensaufgabe machen wollte. Sie beschrieb, wie glücklich und erstaunt sie darüber war, als einundvierzig Staaten beschlossen hatten, dass die Welt nie wieder durch einen Krieg überrumpelt werden sollte. Sie wollten den Krieg verhindern, indem sie die Ursachen dafür aus der Welt schafften und entsprechende Organe aufbauten, die dem Krieg zuvorkommen konnten. Darin hatte die Großmutter ihre eigene und die Zukunft der Welt gesehen. Deshalb hatte sie Jura studiert, sich auf Völkerrecht spezialisiert und später, zur Freude und zum Stolz ihrer Familie, ihr Ziel auch erreicht. 1930 war sie als Juristin beim Völkerbund angestellt worden. Das »Licht aus Genf«, so hatte sie den Bund genannt. »Wie so viele andere fühlte ich mich vom Licht aus Genf unwiderstehlich angezogen.«
Monika hatte das Gefühl, ihrer Großmutter zum ersten Mal zu begegnen. Sie hatte nie etwas über deren Träume und Hoffnungen oder über den Grund für ihre außergewöhnliche Berufswahl erfahren.
Als das Telefon klingelte, fragte sie sich, wer das sein mochte. Es war Mikael, und sie freute sich so sehr über seinen Anruf, dass es schon fast peinlich war.
Er habe keine Zeit zum Reden, sagte er, sondern wolle nur wissen, ob sie bei Granat & Hamid etwas erreicht habe.
»Absolut nicht. Sie haben nicht mal Zeit für ein Gespräch.«
»Hast du Eloïse angerufen?«
»Nein.«
»Das hab ich mir gedacht. Das solltest du am besten gleich tun.«
»Ich kann ihr doch nicht so viel Mühe machen.«
»Monika. Hat sie dir Hilfe angeboten oder nicht?«
»Schon, aber sie erwartet doch sicher nicht, dass ich sie beim Wort nehme . . .«
»Ruf sie an, sonst werde ich sauer. Und morgen kommst du zum Essen und erzählst, wie es weitergegangen ist.«
»Erpresser.«
»Was sein muss, muss sein. Pass auf dich auf. Kuss.«
Die Kombination von Mikaels Aufforderung und ihren bislang vergeblichen Versuchen, in Erfahrung zu bringen, was mit Babs geschehen war, veranlasste sie letztendlich, Eloïses Nummer zu suchen. Sie konnte sich nicht einmal daran erinnern, wann sie zuletzt jemanden wegen eines Gefallens angerufen hatte.
Sie hatte keine Ahnung, wie sie anfangen sollte.
»Ich brauche wohl die Hilfe, von der du gestern gesprochen hast«, platzte sie heraus, als Eloïse sich meldete. Eloïse schien sich an ihr Wort zu halten.
»Alles klar. Wir müssen ihren wunden Punkt finden, und ich glaube, bei Granat & Hamid weist die soziale Fassade die meisten Schwachstellen auf. Willst du dich als Praktikantin ausgeben? Als Tochter einer wichtigen Persönlichkeit, die vielleicht Jura studieren will und erst mal wissen möchte, wie so etwas aussieht?«
»Bin ich dafür nicht ein wenig zu alt?«
»Ein wenig vielleicht, aber es gibt viele, die spät damit anfangen und Jura zu ihrer zweiten Karriere machen. Oder hast du eine bessere Idee? So müssen sie dich empfangen und hilfsbereit sein.«
Monika hatte keine bessere Idee, deshalb schwieg sie. »Das Beste wäre es, wenn die Frage von der Anwaltskammer käme, aber leider habe ich im Moment keine Beziehungen dort, die ich aktivieren könnte. Ich könnte natürlich von hier aus anrufen. Wenn Erik Granat ein Sechsender ist, der sich für einen Zehnender hält, dann ist mein Chef ein echter Zwölfender. Das könnte funktionieren. Wenn wir behaupten, dass wir gerade ein EU-Projekt entwickeln und eine unserer Mitarbeiterinnen eine schwedische Kanzlei von innen sehen muss. Wir könnten dich als Belgierin oder Italienerin ausgeben oder so . . . welche Sprachen sprichst du?«
»Schwedisch. Und holpriges Englisch.«
»Ist das alles?«
Eloïse war aus einer anderen Welt, einer Welt, in der es normal war, mehrere Sprachen akzentfrei zu sprechen. Einer Welt, in der Jugendliche jahrelang ins Ausland geschickt wurden, um sich eine perfekte Aussprache zuzulegen. In den Stockholmer Vororten wuchsen junge Schweden ohne Kenntnisse in ihrer Muttersprache auf, während am anderen Ende der sozialen Leiter junge Menschen mit nicht nur einer Sprache ins Leben traten, sondern mit einer ganzen Batterie, die ihnen den Zutritt zu Schulen, Universitäten und dem globalen Arbeitsmarkt eröffnete.
Mit einem Mal wurde Monika bewusst, wie satt sie all das hatte – sie hatte es satt, sich unterlegen zu fühlen, hatte die Ahnungslosigkeit der Privilegierten satt.
»Warum vergeudest du eigentlich deine Zeit mit dieser Geschichte? Du hast doch nicht gerade wenig zu tun, oder?«, fragte sie schroff.
»Mikael hat mir schon gesagt, dass du bei Hilfsangeboten die Stacheln ausfährst. Tatsache ist, dass ich es für Patrik tue.« Sie hielt einen Moment inne. »Er sieht aus, als sei er mit einem goldenen Löffel im Mund geboren worden. Er hat immer gut ausgesehen, hatte immer genug Geld und konnte immer alles lernen, was er wollte. Aber das bedeutet nicht, dass sein Leben einfach oder völlig schmerzlos war«, fügte sie hinzu.
Monika konnte fast sehen, wie Eloïse um die richtige Formulierung rang.
»Ich glaube an Mikael. Ich glaube, dass er genau der Richtige für Patrik ist. Ich weiß auch, dass du Mikael sehr nahe stehst, und für mich stellt sich das ganz einfach dar. Wenn du zufrieden bist, ist auch Mikael zufrieden, und wenn Mikael zufrieden ist, hat die Beziehung der beiden bessere Chancen. Nimm mir das nicht übel.«
»Du hast sicher Recht. Übrigens hat Mikael mich zu diesem Anruf bei dir überredet.«
»Siehst du? Es funktioniert schon. Ich melde mich, was Granat & Co angeht.«
Den Teufel wirst du tun, dachte Monika. Sie war lange nicht mehr so wütend gewesen. Eloïse mochte sich über Monikas Hilflosigkeit amüsieren, was Schals und Anwaltskanzleien anging. Sie mochte angesichts der Tatsache, dass Monika weder Französisch noch Italienisch sprach wie eine Einheimische, die Augen verdrehen.
Sie mochte auch versprechen, sich um Monikas Probleme zu kümmern, sich wieder zu melden, wenn es ihr gerade in den Kram passte, und Monika unterstellen, dass sie die Stacheln ausfuhr, wenn nicht alle lieb genug zu ihr waren.
Sie sollte sich doch zum Teufel scheren.
Das hier würde Monika selber klären. Es war doch Wahnsinn, greise Analytiker im Rollstuhl und Inhaber von Kanzleien, die keine Gespräche führen wollten, zu belästigen, wo sie ihren eigenen Vater und Babs’ Ehemann unmittelbar neben sich hatte. Niels, der ganz bestimmt wusste, was los war.
Sie griff nach dem Schlüssel zu seiner Wohnung, nahm den ersten Band der Memoiren ihrer Großmutter und machte sich auf den Weg. Es regnete wieder. Diesmal würde sie das Kommando übernehmen. Jetzt wollte sie ihre Antworten haben, und zwar ohne die so genannte Hilfe, die Eloïse oder sonst irgendwer bot.