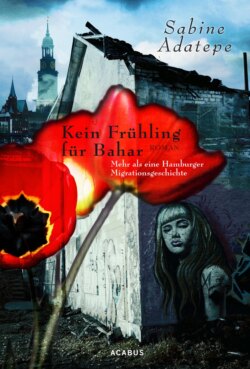Читать книгу Kein Frühling für Bahar. Mehr als eine Hamburger Migrationsgeschichte - Sabine Adatepe - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление3
Hausbesuch
„Oho, welch eine Ehre, Frau Ina, kommen Sie doch herein!“ Der alte Mann schüttelte mir die Hand, wollte sie gar nicht mehr loslassen.
Wie hatte ich vergessen können, dass Hüsniye in der Wohnung ihrer Schwiegereltern lebte, noch immer, nach all den Jahren! Eine großzügige Altbauwohnung im Vogelhüttendeich, man hätte neidisch werden können. Stuck an den Decken, blitzend weiß, einige Ecken merkwürdig ausgebessert. Wie abgeschlagen und übertüncht. Da mussten einst Putten gesessen haben. Nackte, dicke Engelchen, das war wohl nicht mit dem Glauben der derzeitigen Mieter vereinbar. Der Fernsehapparat lief, das unvermeidliche Häkeldeckchen und eine kleine Skulptur darauf, ein Hund oder ein Wolf, als Arif Bey mich ins Wohnzimmer führte.
Er gehörte zu den alten Stammkunden der Sozialberatung. Vor bald zwanzig Jahren war er mit seiner Familie aus den Baracken der Sietas-Werft in Neuenfelde hier ins Reiherstiegviertel gezogen, das muss kurz vor Hüsniyes Ankunft in Deutschland gewesen sein. Fadime, seine Frau und Hüsniyes Schwiegermutter, hatten wir nie für unsere Kurse gewinnen können. Vor etlichen Jahren hatte Arif Bey für seine ganze Familie den deutschen Pass beantragt, Frau und Kinder konnten damals noch ohne große Einzelprüfung mit eingebürgert werden, wenn der Antragsteller die Bedingungen erfüllte: langjähriger legaler Aufenthalt, unbefristetes Arbeitsverhältnis bei ausreichendem Lohn und genügendem Wohnraum sowie akzeptable Deutschkenntnisse, wobei die damals noch dem Ermessen des jeweiligen Beamten unterlagen. So war Fadime Hanım vermutlich durch das immer engmaschiger werdende Raster der Integrationskurse gerutscht, vielleicht war sie auch schon in Rente, als die Behörden begannen, reihenweise auch „Altfälle“, die nicht einmal in der Muttersprache alphabetisiert waren, in die neuen Pflichtkurse zu schicken.
Jetzt saß Fadime Hanım wie verwachsen mit dem Sessel in einer Ecke der guten Stube, eine Häkelarbeit in den Händen und eine lächerlich filigrane Brille auf der mächtigen Nase. Der Sessel gegenüber war vermutlich dem Familienoberhaupt Arif Bey vorbehalten, was mich nicht daran hinderte, darauf zuzusteuern. War da tatsächlich ein Räuspern in meinem Rücken, ein empörtes Blitzen in Fadime Hanıms dumpfem Blick hinter den Brillengläsern? Ich schaltete auf stur. Schon die Anwesenheit dieser beiden alten Herrschaften war genug des Schocks gewesen. Jetzt auch noch mit wer weiß wem das Sofa zu teilen, und sei es Hüsniye, die ich noch nicht erblickt hatte, hätte schon in den ersten Minuten eine harte Geduldsprobe bedeutet. Also nahm ich lächelnd Platz, nachdem ich auch Fadime Hanım die Hand geschüttelt hatte. Die beiden wussten offenbar nicht, dass Hüsniye mich eingeladen hatte.
„Ist Hüsniye nicht da?“, fragte ich, bevor das Ganze in einen unmotivierten Familiennachmittag ausarten konnte.
„Geliiin!“
Also musste Hüsniye im Haus sein. Arif Bey rief die Schwiegertochter auch nach zwanzig Jahren noch nicht beim Namen; Gelin – dieses Wort, das sowohl Braut als auch Schwiegertochter bedeutete, das zärtlich, liebevoll klingen konnte oder auch abwertend, verachtend. Letzteres hätten alle unsere Klientinnen, ach, vermutlich alle türkischen Familien, weit von sich gewiesen. „Gelin, das ist doch die, die zu uns kommt, die wir in unsere Familie aufnehmen, die ein Teil von uns wird …“ Richtig, doch wie oft kam es noch immer vor, dass niemand die Braut gefragt hatte, ob sie diesen Mann überhaupt heiraten wolle. Ob sie darüber hinaus auch bereit war, künftig Teil der Schwiegerfamilie zu sein, schlimmstenfalls jahrzehntelang als Mädchen für alles den Schwiegereltern zu dienen, bestenfalls aber deren Launen zu ertragen, gute und schlechte Tage mit Schwiegereltern, den Geschwistern des Mannes und den zahlreichen Verwandten der neuen Familie zu teilen. Wie viele junge Mädchen sahen zudem die Ehe als Ausweg aus der Enge der eigenen Familie? Kaum zehn Jahre war es her, dass die Schulpflicht in der Türkei von fünf auf acht Jahre heraufgesetzt worden war. So hatten auch die Mädchen zumindest gesetzlich die Garantie, bis zum 15. Lebensjahr zur Schule zu gehen und nicht in Haus und Hof eingesperrt zu werden. Unbegreiflich, dass es noch immer junge Bräute von 18, 20, 24 Jahren gab, die nie eine Schule von innen gesehen hatten.
Hüsniye war zur Schule gegangen, das wusste ich. Nach fünf Jahren Grundschule, die sie ohne große Lust und ohne jegliche Unterstützung der Eltern in einer Dorfschule mit nur einer Klasse und einem Lehrer, aber mindestens vierzig Kindern abgesessen hatte, wenn sie nicht gerade dringender für die Feld- oder Hausarbeit benötigt wurde, hatte sie die jüngeren Geschwister groß gezogen, das Hausvieh versorgt, war mit den Eltern aufs Feld gegangen. Nichts von dem, was der Lehrer in der Schule dem in Ankara festgelegten nationalen Curriculum zufolge allen Kindern beizubringen hatte, war ihr dabei irgendwie von Nutzen gewesen. Sie hatte das wenig bedauert. „Nix wichtig für Kinderkriegen“, hatte sie gesagt und alle zum Lachen gebracht, als wir vor vielen Jahren im Deutschkurs darüber diskutiert hatten, warum so viele junge Frauen in der Türkei kaum lesen und schreiben konnten. Wie lange hatte ich ihr unterstellt, bewusst die Rolle des Klassenclowns zu spielen mit ihren naiven Bemerkungen, bis mir klar wurde, dass sie jede einzelne davon trotz des Lachens bitterernst meinte.
Die Tür ging auf; mit einem Blick, als bitte sie um Entschuldigung, und einem silbernen Tablett mit vier Gläsern voll dampfenden, blutroten Tees trat Hüsniye ins Zimmer.
„Ayıp!“, beschwerte sich Arif Bey künstlich empört, als Hüsniye ihm als Erstem Tee anbot. „In meinem Haus wird immer noch der Gast als Erster bedient!“
„Ina ist ja keine Fremde“, kam es entschlossen von Hüsniye, bevor sie zur Schwiegermutter weiterging. So viel Widerstandsgeist hätte ich ihr gar nicht zugetraut. Möglicherweise flößte meine Anwesenheit ihr Mut ein. Hoffentlich würde sie das nicht zu bereuen haben, wenn ich gegangen war. Nachdem auch ich mir ein Glas vom Tablett genommen hatte, „Nein danke, ohne Zucker“, setzte Hüsniye das Tablett auf dem Beistelltisch ab und begrüßte mich mit einer Umarmung. Das war mir gar nicht recht, doch vor ihren Schwiegereltern konnte ich es ihr unmöglich verwehren.
Nach einigen Minuten Höflichkeitsgeplauder – schon überlegte ich, wie ich den Grund meines Besuchs zur Sprache bringen könnte - kam Hüsniye von selbst auf den Punkt.
„Komm, ich zeig dir Buraks Zimmer!“
„Aber…“ Arif Bey kam nicht dazu, etwas einzuwenden. Hüsniye ließ ihn mit aufgerissenen Augen sitzen und zog mich hinter sich her.
* * *
Hüsniye öffnete die Tür zum Zimmer ihres Sohnes, als beträte sie ein Heiligtum. Es fehlte nur noch, dass sie anklopfte. Der kleine Raum war ringsum mit Postern tapeziert. Hier wurde mir wieder einmal klar, dass ich nicht mehr zur Jugend gehörte. Ich kannte kein einziges der abgebildeten Gesichter. Mit tief in die Stirn gezogenen Baseballkappen waren die meisten der für meinen Geschmack finsteren Gestalten ohnehin kaum zu erkennen. Popstars vermutlich. Eine für diesen Raum völlig überdimensionierte Stereoanlage bannte den Blick wie die Gebetsnische in der Moschee. Die Anlage stand in einer Schrankwand, Modell 80er-Jahre, allerdings nicht für Jungenzimmer, sondern für Wohnzimmer vorgesehen. Ein schmaler Tisch stand vor dem Fenster, ein Stuhl, ein Sessel vor dem Bett. Ein Bildschirm auf dem Tisch, die Kabel führten unter den Tisch, der PC fehlte. Kein Fernseher, erstaunlich, keine Kuscheltiere, mehr Bücher, als ich hier erwartet hätte, und natürlich CDs. Keine 90-60-90-Nackedeis an Wänden oder Schranktüren? Die fehlten in der für einen mitten in der Pubertät steckenden Jugendlichen typischen Ausstattung. Burak wollte es sich vermutlich mit den Großeltern nicht verderben. Stattdessen prangte recht prominent platziert ein stilisierter heulender Wolf auf einem schwarzroten Poster an der Wand gegenüber der Tür.
Ja, da hatte ich den Beweis. Nicht für Buraks Unschuld, wie Hüsniye sicher gehofft hatte, als sie mir das Heiligtum ihres Sohnes auftat. Unauffällig suchte ich nach weiteren Beweisen: Wölfe, die drei Mondsicheln … doch außer dem eindeutigen Poster nichts.
Viele der türkischen Frauen aus den damaligen Kursen hier im Viertel hatten einen konservativen bis offen rechtsgerichteten familiären Hintergrund. Die Wenigsten hatten selbst irgendein politisches Bewusstsein, wiederholten meist nur stereotyp, was sie von Ehemännern und Schwiegereltern zu hören bekamen: „Wir dürfen Deutschen nicht die Hand geben. Wir sollen nicht zuerst grüßen, nur wenn ein Deutscher uns grüßt, sollen wir zurückgrüßen. In den Kindergärten werden unsere Kinder doch nur benachteiligt. Die deutschen Lehrer hassen unsere Kinder. Die deutschen Frauen wollen nur unsere Männer …“ Das war das Totschlagargument – und ich fühlte mich seltsam getroffen. Nicht ohne Hintergedanken blickten mich Frauen, kaum älter als ich, aber mit Mitte zwanzig schon wie mütterliche Matronen wirkend, unverhohlen grinsend an, wenn sie solche Sätze äußerten. Ich sprach Türkisch, damit war ich eine von ihnen. Ich war geschieden, damit war ich eine Gefahr – für den brüchigen Frieden, den sie angeblich mit ihrem Schicksal geschlossen hatten. Für ganz konkret jede einzelne Frau war ich doch potenziell eine Konkurrentin. In den Kursen wussten die Frauen nicht, dass mein Ex-Mann Kurde war, Flüchtling, verfolgt als Linker, und mit Religion so gar nichts am Hut hatte. Das alles hätte mich klar zur Gegnerin für die Mehrheit meiner Kursteilnehmerinnen gemacht, denn der Stallgeruch des Mannes färbte in den Augen dieser Frauen stets ab, ohne Aussicht, je wirklich getilgt zu werden.
Hüsniye war mir stets so absolut unpolitisch erschienen, so desinteressiert an allem, was über Kochen und Putzen hinausging, sie interessierte sich ja nicht einmal für die Erziehung und Bildung ihrer Kinder, dass ich bei ihr nie in Versuchung geraten war, sie dem einen oder anderen politischen Lager zuzuordnen. Die Art, wie sie lässig ihr Kopftuch über die Haare legte, jahrelang achtlos die Zipfel vor dem Kinn verknotete, ein verrutschtes oder auch gänzlich von den doch schamhaft zu verdeckenden Haaren geglittenes Tuch erst auf Zuruf einer achtsameren Geschlechtsgenossin wieder richtete, all das sagte mir, dass sie nicht zur islamistischen Fraktion zählte.
Nun erfuhr ich, dass ihre Familie ganz rechts stand. Der Wolf war das Symbol der türkischen Faschisten, der Grauen Wölfe, der MHP, Partei der Nationalistischen Bewegung. Glückwunsch! Und ich als überzeugte, wenn auch nicht mehr sehr aktive Linke stand im Zimmer dieses Jungaktivisten, der Burak zweifellos war oder doch sein wollte, und sollte mich auf Wunsch der Mutter von seiner Unschuld überzeugen. Wo war ich da hineingeraten! Der Schock hinderte mich daran, weiter ins Zimmer hineinzutreten. Doch Hüsniye ließ mir keine Wahl. Ich unterdrückte den ersten Fluchtimpuls und tat, als schaute ich mich interessiert um. Nein, ich tat nicht nur so. Tatsächlich faszinierte mich dieser Raum. Hatte ich je vorher die Gelegenheit gehabt, sozusagen den Wolf im eigenen Bau zu beobachten? Fußballspieler ließen sich immerhin am Vereinslogo erkennen, St. Pauli ebenso wie HSV – dass man Fan von beiden sein konnte, war mir neu –, daneben türkische Vereine. Bettwäsche in Blau-Gelb, den Farben von dem Istanbuler Club Fenerbahçe. Mein Gott, als wäre Burak nur kurz unten auf der Straße und käme jeden Augenblick heim. Viel zu ordentlich wirkte der Raum für einen kaum Siebzehnjährigen.
„Sag mal, Hüsniye, hast du hier aufgeräumt?“ Unwillkürlich war mir das Du herausgerutscht. Ich korrigierte es nicht.
Sie nickte nur. Dem Sohn hinterherzuräumen, war offenbar selbstverständlich für sie. Ob sie dasselbe auch für ihre Tochter getan hatte? Sie zog die oberste Schublade der Kommode auf.
„Guck mal, was der für Sachen hortet!“, sagte sie, stöberte in den ungeordneten Unterlagen, die aus dem Schubfach quollen. Nein, in Buraks Zettelwirtschaft kramen, das ging mir nun wirklich zu weit. Doch Hüsniye zog ein paar Blätter heraus und drückte sie mir ungeniert in die Hand. „Lies mal! Der Junge wollte bestimmt Dichter werden!“
Verstohlen musterte ich die auf kariertes Papier gekritzelten Zeilen. Gedichte? Ich warf Hüsniye einen Blick zu. Stolz wartete sie auf mein Urteil. In ihren Augen war ihr Sohn wohl schon ein neuer Necip Fazıl. Eine deutsche Mutter hätte sich womöglich geschämt, wenn ihr Teenie-Sohn ihr mit Gedichten gekommen wäre. Es mochte der Stellung der Poesie in der türkischen Gesellschaft geschuldet sein, dass Hüsniye stattdessen stolz war. Ein zweiter Blick auf das Gekritzel – was für eine Klaue! – ließ mich stutzen. Gedichte? Texte waren das, ja, aber unter Gedichten stellte ich mir doch etwas anderes vor. Es sah eher nach Songtexten aus:
Wenn sie dir auf die Füße treten,
dann tritt zurück mit Füßen.
Wenn sie dich mit Worten schlagen,
dann schlag zurück mit Fäusten.
Du bist der Mann, vor dem die Leute rennen,
du bist der Mann, bei dem die Mädels flennen.
du bist der Mann, der nichts beweisen muss, der einfach ist…
Da steckte Harmonie drin, ebenso wie Aggression, Arroganz, Jungmännergehabe. Aber diese wenigen Zeilen zeugten von einer Sprachkraft, wie ich sie Burak niemals zugetraut hätte. Hatte er das selbst geschrieben? Es mochte seine Handschrift sein, ungelenk, fast kindlich, ja, die Handschrift passte zu dem aufmüpfigen Loser-Typen, den ich im Gefängnis gesehen hatte, ohne dass er mir die Chance zum Kennenlernen gegeben hätte. Aber wie passte diese chaotische Schrift mit den sehr sorgfältig gesetzten Zeilen zusammen?
„Das hat er sicher irgendwo abgeschrieben“, warf ich in den Raum.
Hüsniye riss die Augen auf. „Ach? Ich dachte, das hat er sich selber ausgedacht“, stotterte sie.
„Was hat er denn selbst darüber gesagt?“, forschte ich nach.
„Aber er weiß doch gar nicht, dass ich das gesehen habe!“ Unwillkürlich schlug Hüsniye die Hand vor den Mund, um gleich darauf ihr lockeres Kopftuch festzuzurren. „Ich hab’ das beim Aufräumen gefunden, das lag unter dem Schrank da drüben …“
Hektisch begann sie, die übrigen Schubfächer zu öffnen, sogar den Kleiderschrank schloss sie auf, zeigte mir seine Lieblingskleidungsstücke, versuchte dann, die Namen auf den CDs neben der Musikanlage vorzulesen, was kläglich misslang, selbst bei den türkischen Titeln. Offenbar hatte all das erst jetzt für sie Bedeutung gewonnen, jetzt, nachdem der Sohn nicht mehr da war - was sie verdrängte, indem sie sein Zimmer so in Ordnung hielt, dass er es unverzüglich wieder beziehen konnte. Sie mochte auch früher für ihn aufgeräumt haben, doch mit seinen Lebensinhalten hatte sie sich offensichtlich nie beschäftigt.
Ich legte die Blätter auf den Tisch, ich hatte genug gesehen.
„Und Bahars Zimmer?“ Ob das auch so picobello aufgeräumt war und nur darauf wartete, dass seine Bewohnerin jeden Augenblick zurückkehrte?
„Bahar?“
„Na ja, ich würde auch gern Bahars Zimmer sehen“, setzte ich nach. Hüsniyes Augen verloren ihren Glanz. Klar, Burak war ihr Sohn, ihr Ein und Alles, ihr Stolz. Bahar war nur ihre Tochter gewesen. „Macht nichts, wenn’s nicht aufgeräumt ist, das könnte ich gut verstehen. Ist sicher noch viel zu schmerzhaft, nicht? Aber ich würd’ schon gern einen Blick hineinwerfen …“
Hüsniye drehte sich um, schloss Schranktüren, Schubfächer, wischte einen unsichtbaren Fussel von der Bettdecke. Dann wandte sie sich mir zu und flüsterte: „Bahar hatte kein Zimmer. Sie hat bei mir geschlafen.“
„Und … und wo hat sie Hausaufgaben gemacht?“ Bahar hatte vor ihrem Tod in einem Projekt zur Ausbildung als Pflegerin gesteckt, so viel ich wusste. Also brauchte auch sie einen Platz zum Arbeiten.
„In der Küche ist ein großer Tisch“, erklärte Hüsniye.
Vorwürfe, pädagogische Hinweise würden nichts ausrichten, waren in diesem Fall ohnehin zu spät, viel zu spät. Vielleicht sollten Lehrer und Kursleiter verpflichtet werden, zu Beginn jeder Schulungsmaßnahme ihre Schüler und Kursteilnehmer einmal zu Hause zu besuchen, Skizzen und Tipps für einen heimischen Arbeitsplatz mitzubringen, am besten gut sichtbar an der Haustür aufzuhängen … Was hatte ich erwartet? Hüsniye war ja selbst, als sie damals in meinen Kurs gekommen war, ohne Stift, ohne Papier gekommen und es hatte Wochen gedauert, bis sie sich die üblichen Materialien nicht mehr von den anderen ausleihen musste. Hatte sie eigentlich je ein eigenes Heft besessen? Ich konnte mich nicht daran erinnern. Möglicherweise hatte sie bis zuletzt mit geliehenen Zetteln in geliehenen Ordnern hantiert. Wieso war ich selbstverständlich davon ausgegangen, dass ihre Tochter über alles Notwendige zum Lernen verfügte?
„Und du hast deine Hausaufgaben wohl damals auch in der Küche gemacht, wie?“ Die Sache ins Humorvolle zu ziehen, war noch die beste Lösung.
„Hausaufgaben?“
Richtig, ich hatte offenbar vieles vergessen: Hüsniye war eine der notorischen Keine-Hausaufgaben-Macherinnen gewesen. „Keine Lust, keine Zeit oder vergessen?“, hatte meine Standardfrage in all den Kursjahren gelautet. Hüsniye hatte zu denen gehört, die jahrelang „keine Zeit“ gesagt hatten. Der Kurs hatte gelacht. Und ich war zur nächsten Teilnehmerin ohne Hausaufgaben übergegangen.
„Du bleibst doch zum Essen, ja?“ Mit der klassischsten Frage aller türkischen Hausfrauen wechselte sie das Thema.
Ich musste sie enttäuschen. Gefasster als befürchtet nahm sie es hin. Es mochte ihr recht sein, dass ich nicht mit den Schwiegereltern ins Gespräch kam. Auch befürchtete sie wohl noch Vorwürfe wegen der offensichtlichen Vernachlässigung von Bahar. Sie nahm die Zettel, die ich auf den Tisch gelegt hatte, hielt sie mir entgegen und sagte: „Ich wollte dir noch Fotos zeigen, aber …“ Sie hob den Kopf. „Ich komm’ dann morgen zu dir ins Büro.“ Hilflos starrte ich auf die Zettel. Den Arm mit den Papieren ausgestreckt, öffnete sie mir mit der freien Hand die Tür zum Flur. Ich hatte schon meine Schuhe zugebunden, sie stand noch immer mit den Blättern da, als sie leise sagte: „Du musst unbedingt auch noch mit Elif sprechen!“
„Elif?“
„Bahars beste Freundin. Burak hat sie angehimmelt. Sie hat sich über ihn lustig gemacht, Bahars kleiner Bruder war für sie nur ein Kind. Ich hab’ immer gedacht, irgendwann rächt er sich für ihre Ablehnung. Wenn er älter ist, wenn sie mal einen Freund hat, dann tut er ihr was an … Aber nun …“
Hüsniye hatte sich fantastisch gehalten. Eine tränenreiche Stunde hatte ich befürchtet. Es war ganz anders gekommen. Zum ersten Mal hatte ich etwas wie Rückgrat bei dieser Frau erlebt, deren Rücken ich für gebrochen gehalten hatte, bevor er noch die Chance bekommen hatte, sich recht auszubilden. Doch nun gab es kein Halten, die Tränen flossen, wie ich es aus den Stunden in meinem Büro gewohnt war. Spontan nahm ich sie in den Arm. Am Ende wusste ich nicht, ob Mitgefühl, Verachtung oder Abscheu überwog. Nein, hier hatte ich es mit einer menschlichen Tragödie zu tun, da musste meine persönliche politische Meinung zurückstecken. Ich nahm, mehr aus Höflichkeit denn aus Interesse, den Packen Zettel entgegen, den Hüsniye mir noch immer hinstreckte, schob ihn mir in die Tasche und verabschiedete mich fluchtartig.