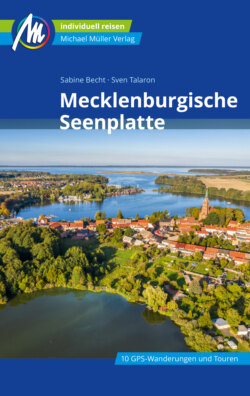Читать книгу Mecklenburgische Seenplatte Reiseführer Michael Müller Verlag - Sabine Becht - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеStadtgeschichte Schwerin
Die Geschichte Schwerins beginnt auf der kleinen Burginsel, die mindestens ab 600 n. Chr. von den slawischen Obotriten bewohnt war. Erste verlässliche Daten über die Gegend stammen von 973, in einer Chronik des Bischofs Thietmar von Merseburg ist im Jahr 1018 erstmals konkret von „Zuarin“ (vielleicht slawisch für „tierreiche Gegend“ oder „Wildgehege“) die Rede.
Als Stadtgründer jedoch ging Heinrich der Löwe (1129-1195) in die Geschichte ein, sein Reitersiegel ziert heute nicht nur das Stadtwappen, man begegnet dem Welfenfürsten auch in der Stadt selbst: z. B. als Löwe auf dem Marktplatz oder als kleine goldene Reiterfigur auf dem Rathaus. Heinrich besiegte im Jahr 1160 den Obotritenfürsten Niklot (1125-1160) und nahm ganz Mecklenburg ein. Als Statthalter der neuen Stadt ernannte er Gunzelin von Hagen (gest. 1185), bald darauf errichtete der Welfenfürst das Bistum Schwerin, 1171 wurde der Dom geweiht. Zwar blieb die Stadt über die Jahrhunderte ein bedeutender Bischofssitz, wirtschaftlich aber stand sie bald im Schatten der neuen Hansestädte Wismar und Rostock.
Nachdem die Linie Gunzelins 1358 ausgestorben war, kaufte Albrecht II. (1318-1379), ein Nachfahre Niklots, die Stadt zurück, die damit wieder in den Besitz der mecklenburgischen Fürsten fiel. Eine erste Blüte erlebte Schwerin unter Herzog Johann Albrecht I. (1525-1576), der - ganz im Stil eines Renaissancefürsten - Kunst, Kultur und Wissenschaft um sich scharte. Johann Albrecht ließ das Schloss, damals kaum mehr als eine einfache Burg, zu einem repräsentativen Renaissancebau umgestalten und führte Schwerin dem lutherischen Glauben zu. Der Dreißigjährige Krieg hinterließ in ganz Mecklenburg tiefe Spuren, hinzu kamen eine Pestepidemie und in Schwerin im Jahr 1651 ein verheerender Großbrand, der die wenigen vom Krieg verschonten Häuser der Stadt vollends zerstörte. Einen weiteren Rückschlag erlebte Schwerin Mitte des 18. Jh., als die Residenz Stück für Stück nach Ludwigslust verlegt wurde.
Erst 1837 kehrte die Macht an den Schweriner See zurück. Im Gepäck hatte Großherzog Paul Friedrich (1800-1842) ambitionierte städtebauliche Pläne und einen Mann, der sie realisieren sollte: Georg Adolph Demmler, Schüler des berühmten Architekten Karl Friedrich Schinkel und seit 1835 Hofbaumeister des Herzogtums. Unter seiner Ägide entstand eine Vielzahl repräsentativer öffentlicher Gebäude, die noch immer das Stadtbild prägen, darunter der Marstall und das Kollegienhaus, heute Sitz der Staatskanzlei. Sein Meisterwerk war der Umbau des alten Schlosses, den er ab 1843 in Angriff nahm.
Zuvor waren bereits städtebauliche Erweiterungen erfolgt, v. a. mit dem Anschluss der Schelfstadt, dem Gebiet nördlich der Altstadt, im Jahr 1832. Hier gab es bereits ab dem 11. Jh. eine Fischersiedlung, die Anfang des 18. Jh. auf herzogliche Anweisung zur eigenen Stadt ausgebaut wurde. Im 19. Jh. wurde Schwerin mit der Paulsstadt nach
Mehr als nur der Architekt Schwerins - Georg Adolph Demmler
Der 1804 in Berlin geborene spätere Hofbaumeister Mecklenburgs machte nicht nur als Architekt von sich reden. Seit seinen Studientagen war er Freimaurer. Demmler engagierte sich schon früh in den liberal-demokratischen Zirkeln Schwerins und forderte eine Verfassung für das Fürstentum, die aber bis 1919 auf sich warten ließ. Ungewöhnlich für einen Liberalen des 19. Jh. war sein Eintreten für die Arbeiterschaft - etwa die Initiative für die Einrichtung einer Kranken- und Unfallversicherung für die Arbeiter des Schlosses oder sein Einsatz für eine Erhöhung der Bezüge von Handwerksgesellen.
Seine politischen Überzeugungen bescherten ihm 1850 jedoch das vorzeitige Ende der Karriere. Der Hof verbat sich seine Einflussnahme und beschied Demmler, er habe „sich fortan von politischem Treiben fern zu halten und sich zu freuen (...), dass der Betrieb der Politik zu seinem Berufe nicht gehöre.“ Den Knebel ließ sich Demmler nicht anlegen, er trat von seinem Amt zurück. Nach ein paar Jahren im Ausland kehrte er nach Schwerin und in die Politik zurück. Er wandte sich der Sozialdemokratie zu und wurde 1877 in den Reichstag gewählt, zog sich aber bereits 1878 von der öffentlichen Bühne zurück. Die Sozialdemokratie unterstützte Demmler bis zu seinem Tod am 2. Januar 1886.
Nordwesten erweitert, ebenso wurde das Pfaffenteichufer bebaut. Von der Reichsgründung 1871 bis zum Ersten Weltkrieg erlebte die Stadt einen anhaltenden wirtschaftlichen Aufschwung. Schwerins Zeit als Residenzhauptstadt endete 1918, als der letzte Großherzog, Friedrich Franz IV., im Zuge der Novemberrevolution abdanken musste.
Das prächtige Schloss samt Schlosspark
Im Zweiten Weltkrieg blieb die Schweriner Innenstadt von den alliierten Bombardements relativ verschont. Am 2. Mai 1945 wurde die Stadt von amerikanischen Truppen befreit, nur wenige Stunden zuvor war noch ein letztes Opfer des NS-Regimes am Bahnhofsplatz gehängt worden: die Lehrerin Marianne Grunthal, deren Namen der Platz heute trägt. Innerhalb weniger Wochen wurden die Amerikaner von englischen Truppen und diese bald von sowjetischen Truppen abgelöst. Als Bezirkshauptstadt in der DDR erlebte Schwerin erneut eine rege Bautätigkeit; so ließen der Ausbau der Weststadt und der Neubau der Stadtteile Lankow und Großer Dreesch die Einwohnerzahl erstmals auf über 100.000 steigen. 1990 einigte man sich auf Schwerin als Hauptstadt des neuen Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern. Heute ist Schwerin die kleinste Landeshauptstadt Deutschlands.
Derzeit bewirbt sich Schwerin um eine Aufnahme in das UNESCO-Weltkulturerbe. Genauer gesagt soll die einzigartige romantische Kulturlandschaft rund um das Märchenschloss auf der Insel Weltkulturerbe werden, einschließlich des Gebäudeensembles Alter Garten mit Staatstheater und des Staatlichen Museums vis-à-vis und natürlich des herrlichen Schlossparks (u. a.). Das „Residenzensemble Schwerin - Kulturlandschaft des romantischen Historismus“ steht bereits auf der Vorschlagsliste.
Sehenswertes in Schwerin
Hauptanziehungspunkt ist natürlich das prächtige Schweriner Schloss mit seinen repräsentativen Räumlichkeiten - ohne Schlossbesichtigung bleibt ein Schwerin-Besuch unvollständig. Über die Schlossbrücke kommt man zum wenige Meter entfernten Alten Garten, der von Staatstheater, Galerie Alte & Neue Meister und Kollegienhaus umrahmt wird. Auf der Schlossstraße gelangt man von hier - entlang diverser klassizistischer Repräsentativbauten, in denen heute die Landesregierung logiert - zum hektisch-modernen Marienplatz im Herzen der Innenstadt. Auf halbem Weg rechts ab geht es über die Puschkinstraße zum Marktplatz, hinter dem der Dom der Stadt unmittelbar aufragt. Von dieser beschaulichen Ecke Schwerins erreicht man in wenigen Minuten (z. B. weiter über die Puschkinstraße) die Schelfstadt. Nur einen Katzensprung weiter westlich liegt der Pfaffenteich, Schwerins „Binnenalster“. Auch hier am städtischen See reihen sich zahlreiche historische Repräsentativbauten, an seinem Südufer laden eine riesige Freitreppe und diverse Cafés zur Rast ein.
Schloss und Schlossgarten
Schloss: Ein imposantes Bauwerk, das sich auf einer winzigen Insel wie aus dem Wasser zu erheben scheint. Unzählige Türmchen und Aufbauten lassen an die Schlösser an der Loire denken, und in der Tat fühlte sich Georg Adolph Demmler (1804-1886), der wichtigste Baumeister des Schweriner Schlosses, vom Château Chambord im Loire-Tal inspiriert, wenn auch einige Jahrhunderte nach der Erbauung des prächtigen französischen Renaissanceschlosses.
Über eine Befestigung der heutigen Burginsel berichtete bereits im Jahr 973 ein arabischer Kaufmann namens Ibrahim ibn Jacub. Anfang des 11. Jh. ist von der Burg „Zuarin“ des Obotritenfürsten Niklot die Rede, die 1160 durch den Sachsen Heinrich den Löwen (1129-1195) eingenommen und zur ersten Residenz der Grafschaft Schwerin erkoren wurde. Es folgten erste Ausbauten auf der Burginsel, bis Herzog Johann Albrecht I. (1525-1576) im 16. Jh. das Bauwerk anlässlich seiner Hochzeit in weiten Teilen im Renaissancestil umgestalten ließ. 1560-1563 wurde die Schlosskirche angebaut, seinerzeit der erste protestantische Kirchenneubau in Mecklenburg. Dann aber ging es abwärts: 1756 verließen die Fürsten Schwerin und errichteten sich eine Residenz im etwa 40 Kilometer südlich gelegenen Ludwigslust. Als sie 1837 wieder zurückkehrten, war das ehemals prächtige Schloss heruntergekommen und kaum noch bewohnbar. Sechs Jahre später schlug die Stunde von Hofbaurat Demmler. Großherzog Paul Friedrich (1800-1842) hatte noch einen kompletten Residenz-Neubau am heutigen Alten Garten im Sinn, sein Nachfolger Friedrich Franz II. (1823-1883) hingegen entschloss sich, das Schloss stattdessen großzügig umzubauen und zu diesem Zweck Teile des alten Gebäudes abreißen zu lassen - nur zur Seeseite hin blieben Elemente des typisch mecklenburgischen Renaissancebaus aus dem 16. Jh. erhalten. Hofbaurat Demmler und sein Architektenkollege Hermann Willebrand (1816-1899) bauten zwischen 1843 und 1851 weite Teile der Anlage im Stil der Neorenaissance um. Der spätere Baumeister Friedrich August Stüler (1800-1865) veränderte die Fassade zur Stadtseite hin und fügte hier das Reiterstandbild des Obotritenfürsten Niklot wie auch die prachtvolle Goldkuppel an. Die feierliche Eröffnung des neuen Schlosses fand 1857 statt.
Am Schloss
1913 zerstörte ein Brand weite Teile des Schlosses, das 1919 zum Staatseigentum erklärt wurde. Nach langen Restaurierungsarbeiten wurde hier 1921 ein erstes Schlossmuseum eröffnet (bis 1945), von 1952 bis 1981 diente das Gebäude als Pädagogische Schule, an der Kindergärtnerinnen ausgebildet wurden. 1974 begann man erneut mit Restaurierungsarbeiten, die noch immer nicht abgeschlossen sind. Seit Herbst 1990 hat der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns hier seinen Sitz.
Der Rundgang durch das Schloss führt zunächst hinauf in die Beletage (zweiter Stock), wo sich die Wohngemächer der Herzogin befanden. „Beletage“ verspricht nicht zu viel: Es folgen in der Tat recht schmucke Räumlichkeiten, darunter das Speisezimmer mit kunstvoll gefertigtem Parkettboden und kostbarer Wandvertäfelung, die „Rote Audienz“ mit handgewebter roter Tapete, das Teezimmer (ursprünglich der älteste Raum des Schlosses), das runde Blumenzimmer mit Stuckdecke und Deckenmalerei sowie der „Blaue Salon“, das überaus gemütliche Wohnzimmer der Herzogin mit blauer Seiden-/Damasttapete und handgeschnitzten Wandkonsolen.
Im dritten Stock gelangt man in die Festetage mit den Repräsentationsräumen und den Gemächern des Herzogs: Letztere sind nur teilweise zugänglich, darunter das Adjutantenzimmer, das Rauchzimmer (für die Regierungspause) und die Bibliothek. Hinter dem Bücherregal befindet sich übrigens ein Geheimgang, der es dem Herzog ermöglichte, sich auch mal ohne Wissen seines Adjutanten (respektive der Herzogin ...) zu absentieren. Schließlich gelangt man in den Thronsaal, den prachtvollsten Raum des Schlosses, mit kunstvollem Intarsienparkett, einem vergoldeten Thronsessel mit Baldachin (dahinter das Wappen von Mecklenburg) und Säulen aus Carrara-Marmor, dem original erhaltenen Kronleuchter, einem aufwändigen Deckengemälde nebst Stuckarbeiten - und einer geradezu modernen Heizung. Die im Rundgang anschließende Ahnengalerie hatte der Untertan auf dem Weg zur Audienz abzuschreiten und bekam nebenbei die Legitimation des Fürsten in Erinnerung gerufen. Zu sehen sind mehr oder minder schmeichelhafte Porträts aller mecklenburgischen Fürsten von 1348 bis 1800.
Wer die Besichtigung des Schlossmuseums vervollständigen will, findet im ersten Stock eine umfangreiche Porzellansammlung sowie eine Waffensammlung (Aufgang gegenüber der Kasse im Erdgeschoss).
Wieder draußen, lohnt es sich, einmal komplett um das Schloss herumzugehen: Der Burggarten wurde von Joseph Lenné (1789-1866) im englischen Stil konzipiert, wobei auch die Dachterrassen der Orangerie (heute Café) gartenarchitektonisch mit einbezogen wurden.
♦ Schlossmuseum: Mitte April bis Mitte Okt. Di-So 10-18 Uhr, im Winter Di-So 10-17 Uhr, Mo geschlossen. Einlass bis eine halbe Stunde vor Schließung (Achtung: Die Porzellan- und Waffensammlung wird gerne auch einmal deutlich früher geschlossen). Eintritt 8,50 €, erm. 6,50 €, Kinder und Jugendl. unter 18 J. frei, Fotoerlaubnis 3 €. Führungen durch Beletage und Festetage im Sommerhalbjahr Di-So 11 und 13.30 Uhr, Mai/Juni auch Sa/So 15 Uhr, Juli/Aug. auch Di-So 12 und 15 Uhr, in den Wintermonaten nur Di-So 11.30 Uhr, Sa/So auch 13.30 Uhr, Dauer 1 Std. 3 €/Pers., erm. 2 €. Audioguide 2 €. Lennéstr. 1, 19053 Schwerin, Tel. 0385-5252920, www.schloss-schwerin.de.
Exklusive Sitzgelegenheit: im Thronsaal des Schweriner Schlosses
Schlossgarten: Über die alte Drehbrücke erreicht man vom Schloss aus in südlicher Richtung den Schlossgarten, der um 1670 als barocker Lustgarten angelegt wurde. Knapp ein Jahrhundert später wurde gemäß der Mode der Zeit der von 14 Skulpturen (u. a. antike Götter, Allegorien der Jahreszeiten) und zwei Laubengängen gesäumte Kreuzkanal angelegt. Auffälligstes Monument ist allerdings das Reiterdenkmal von Großherzog Friedrich Franz II. (1823-1883) von 1893. Links vom oberen Ende des Kreuzkanals gelangt man nach wenigen Schritten zum Grünhausgarten, einer Verlängerung des Schlossparks. Der Grünhausgarten stammt aus der Zeit um 1840 und wurde unter der Leitung des Landschaftsarchitekten Joseph Lenné (1789-1866) im so genannten englischen Stil realisiert. Lenné hatte auch den Burggarten rund um das Schloss gestaltet.
Schleifmühle: Südlich des Grünhausgartens, am „Faulen See“, steht die Schweriner Schleifmühle, ein altes Fachwerkhaus mit großem Mühlrad. 1705 ursprünglich als Pulvermühle gebaut, später eine Graupenmühle, nutzte man die Kraft des Wasserrads ab 1757 für eine Steinschleiferei, die u. a. auch die Bauherren des Schweriner Schlosses belieferte. 1862 erfolgte der Umbau zur Wollspinnerei, 1904 wurde das An wesen wegen Baufälligkeit stillgelegt und 1985 schließlich als Schauanlage und Museum wiedereröffnet. Der Rundgang durch das Mühlengebäude (im Obergeschoss zwei kleine Ausstellungsräume mit historischen Dokumenten, Schaubildern, alten Fotografien, geschliffenen Steinen und Halbedelsteinen) mündet in ein wirklich ohrenbetäubendes Erlebnis, wenn die Mühlenanlage zu Demonstrationszwecken angeworfen wird und der „Müller“ in einer etwa 10-minütigen Vorführung die durch Wasserkraft betriebene Steinsäge bedient. Sehenswert!
♦ Tägl. 9-17 Uhr (Sa/So ab 10 Uhr), im Winter nur Mo-Fr. Eintritt 4 €, erm. 3 €. Schleifmühlweg 1, Tel. 0385-562751, www.schleifmuehle-schwerin.de.
Ein guter Geist - das Petermännchen
Ein kleines, altes Männchen mit grauem Bart und Federhut, einer Laterne in der Hand und einem Schwert, dazu einem Schlüsselbund - so ist er auf Bildern zu sehen: der Schweriner Schlossgeist, der hier seit Jahrhunderten wohnt und das Böse aus der Stadt vertreibt.
Der Sage nach ist das Petermännchen der einzige übrig gebliebene Diener eines heidnischen Gottes der Tempelburg an der Stelle des heutigen Schlosses. Seine Dienerkollegen zogen sich - nachdem die Gottheit vor den nahenden Christen geflohen war - nach Petersberg bei Pinnow (östlich von Schwerin) zurück, daher auch der Name des Kobolds. Das Petermännchen aber blieb und bewachte fortan die Burg, verjagte unrechtmäßige Eindringlinge und belohnte die Guten. Seinen Schlossherren war es dabei stets treu ergeben.
Bekanntestes Opfer des umtriebigen Kobolds war Wallenstein, kaiserlicher Generalissimus während des Dreißigjährigen Krieges. Der hatte Gefallen am Schweriner Schloss gefunden und beabsichtigte, sich hier niederzulassen. Doch schon in der ersten Nacht im neuen Zuhause setzte ihm das Petermännchen ordentlich zu, machte mächtig Lärm, zog ihm die Bettdecke weg und zwickte und boxte den Feldherrn die ganze Nacht hindurch, sodass dieser am nächsten Tag entnervt in einen anderen Flügel des Schlosses umzog. Doch auch dort erging es ihm nicht besser, im Gegenteil, der Schlossgeist ließ Wallenstein nächtens sogar noch ein Ahnenbild auf den Kopf fallen - der Feldherr reiste am nächsten Morgen ab und kam nie wieder.
Alter Garten
Der Alte Garten mit Theater und Staatlichem Museum
Ein etwas leerer, riesiger Platz auf der Stadtseite des Schlosses, um den sich Staatskanzlei, Altes Palais, Staatstheater, Staatliches Museum und Schloss gruppieren. Um 1630 wurde hier ein Garten angelegt, der mit dem Bau des eigentlichen Schlossgartens um 1670 aber an Bedeutung verlor, zum „Alten Garten“ umbenannt wurde und bald verwahrloste; später befand sich hier ein Exerzierplatz. Heute ist der Alte Garten mit seinem gelungenen Ensemble klassizistischer Bauten der angemessene Rahmen für das Schweriner Regierungsviertel, im Sommer bietet er den Rahmen für die Opernaufführungen der Schlossfestspiele.
Ältestes Gebäude am Platz ist ein vergleichsweise bescheiden wirkender Fachwerkbau, das Alte Palais aus dem 18. Jh., das Großherzog Paul Friedrich (1800-1842) nebst Gattin Alexandrine als Wohnsitz diente. Deutlich mehr Eindruck hinterlässt das Mecklenburgische Staatstheater gleich rechts nebenan - ein prachtvolles Gebäude mit Säulen und Giebel, das 1883-1886 unter der Leitung von Baurat Georg Daniel (1829-1913) entstand. Ein von Demmler entworfener Vorgängerbau war kurz zuvor abgebrannt. An der Nordostseite des Alten Gartens blickt man nun auf die Staatsgalerie (Staatliches Museum Schwerin) von 1882, das vielleicht bedeutendste Kunstmuseum Mecklenburg-Vorpommerns; auch hier wird die Vorderfront von Säulen und einem Giebel im neoklassizistischen Stil dominiert. Das Museum wurde bereits 1837 von Demmler als neues Palais für Großherzog Paul Friedrich geplant, blieb aber unvollendet. Dem Museum gegenüber, am anderen Ende des Alten Gartens und direkt am Ufer des Burgsees, steht die 32 Meter hohe Siegessäule (1874), die an den Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 erinnert. Oberhalb davon, am Beginn der Schlossstraße mit ihren repräsentativen Bauten, steht linker Hand schließlich das Kollegienhaus, die heutige Staatskanzlei, das zwischen 1825 und 1834 gebaut wurde. Die streng klassizistische Fassade entstand nach Plänen Demmlers: drei Flügel mit einem ionischen Säulenportikus in der Mitte, die Giebel gekrönt von Darstellungen antiker Götter. Rechts an die Staatskanzlei schließt die 1892 von Georg Daniel konzipierte Neue Regierung an. Verbunden sind beide Gebäude durch einen über Arkaden verlaufenden Übergang, den der Volksmund spöttisch „Höhere Beamtenlaufbahn“ nennt - oder auch „Seufzerbrücke“ nach den Klagelauten der Beamten und Politiker, die angesichts leerer Kassen auf dem Rückweg vom Büro des Ministerpräsidenten ausgestoßen werden.
Staatliches Museum Schwerin: Ein Tempel für die Kunst. Schon von außen beeindruckt die mächtige Freitreppe. Durch eine von hohen Säulen getragene Vorhalle gelangt man in die Staatsgalerie mit ihrer beachtlichen Kunstsammlung hochrangiger Werke aus vier Jahrhunderten. Die Staatsgalerie zählt - neben den Schlössern Schwerin und Ludwigslust - zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Mecklenburgs.
Im Obergeschoss befindet sich die beeindruckende Sammlung Alter Meister mit Werken der deutschen Spätgotik und Renaissance sowie einer umfangreichen Sammlung holländischer und flämischer Malerei des 17. Jh., darunter die Torwache von Carel Fabritius und Lot und seine Töchter von Peter Paul Rubens. Ein weiteres Highlight ist der Saal mit den großformatigen Tierporträts des französischen Hofmalers Jean-Baptiste Oudry rund um das Rhinozeros mit dem schönen Namen Clara.
In einem Nebenraum schließlich stehen zwölf Bronzen von Ernst Barlach, die auf die nicht minder sehenswerten Neuen Meister im Erdgeschoss einstimmen. Hier sind u. a. Werke von Max Liebermann, Lyonel Feininger, Lovis Corinth und Vertretern der Künstlerkolonien Schwaan und Ahrenshoop wie Rudolf Barthels und Paul-Müller-Kaempff zu sehen. Überaus eindrucksvoll sind die Sammlungen von Werken Marcel Duchamps sowie des gebürtigen Mecklenburgers Günther Uecker, darunter auch die für Uecker typischen Nagelreliefs. Seit 2016 ergänzt ein großzügiger Neubau die Ausstellungsfläche, in dem zeitgenössische Kunst und Werke der Sammlung Neue Medien gezeigt werden.
♦ April bis Okt. Di-So 11-18 Uhr, im Winter nur bis 17 Uhr. Eintritt 7,50 €, erm. 6 €. Wechselnde thematische Führungen Sa 12 Uhr und So 11 Uhr. Museumsshop und Café im Erdgeschoss. Alter Garten 3, Tel. 0385-58841222, www.museum-schwerin.de.
Marstall: Das sorgfältig restaurierte, von zwei Kastanienbäumen flankierte, gelbe Gebäude - einst die herzogliche Reithalle - entstand 1838-1842 und stammt wie so vieles in der Stadt von Hofbaumeister Demmler. Heute befindet sich hier das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
Von hier führt die Straße mit dem einprägsamen Namen „Großer Moor“ zur Puschkinstraße: ein breiter Straßenzug mit einigen schönen Fachwerkhäusern aus dem 18. Jh., aber auch zahlreichen Neubauten aus den 1970er Jahren.
Altstädtischer Markt
Der Altstädtische Markt ist das Herz der Stadt, ein lebendiger Platz, zwar ohne Marktgeschehen, aber mit einigen architektonischen Sehenswürdigkeiten. Auffälligster Bau ist zweifelsohne das Neue Gebäude oder auch „Säulengebäude“ an der Nordseite des Platzes. Ursprünglich wurde das Gebäude unter Herzog Friedrich dem Frommen (1717-1785) in den Jahren 1783-1785 als Markthalle gebaut und soll nach Leerstand und fälliger Sanierung auch in naher Zukunft wieder eine werden.
Zweiter optischer Blickfang des Platzes ist das Alte Rathaus mit der 1835 aufgesetzten Fassade im (neugotischen) Tudorstil, hinter der sich vier alte Giebelhäuser verbergen. Bereits im Jahr 1351 ist hier ein erstes Rathaus dokumentiert. Auf der mittleren Zinne des Rathauses thront die kleine, aber strahlend goldene Reiterstatue des Stadtgründers Heinrichs des Löwen (1129-1195), dem auch das zweite Denkmal am Platz, eine Löwenplastik vor dem Neuen Gebäude, gewidmet ist. Letztere wurde 1995 anlässlich des 800. Todestags des Stadtgründers hier aufgestellt.
Ein Durchgang am Rathaus führt vom Altstädtischen Markt zum Schlachtermarkt. Mit seinen alten Fachwerkhäusern, hohen Bäumen und dem modernen Brunnen „Von Herrn Pastor sien Kauh“ (1978) zählt er zu den schönsten Plätzen der Stadt. Bis 1938 befand sich hier im Haus Nr. 3 die Schweriner Synagoge (bei der Pogromnacht am 9. November 1938 zerstört), deren Neubau sich heute im Innenhof des Gebäudes befindet.
Dom
Löwe, Dom und Neues Gebäude: am Altstädischen Markt
Die imposante dreischiffige Basilika mit mächtigem, ebenfalls dreischiffigem Querhaus entstand ab 1270 anstelle eines romanischen Vorgängerbaus. Da sich die Arbeiten bis ins 15. Jh. hineinzogen, weist das Gewölbe bereits spätgotische Einflüsse auf. So ist das ältere Langhaus mit einem Kreuzrippengewölbe versehen, das Querhaus dagegen aufwändiger mit einem Netz-, die Vierung mit einem Sterngewölbe. Der Raumeindruck der Basilika ist majestätisch und licht. Anders als beispielsweise in der zeitgleich entstandenen Zisterzienserkirche von Bad Doberan dominiert hier nicht das warme Rot des Backsteins, sondern ein strahlendes Weiß, das von grauen Diensten (kleine, vorgestellte Säulen) sowie roten und grünen Gewölberippen durchbrochen wird. Der 1327 fertig gestellte Chorumgang wird von einem so genannten Kapellenkranz abgeschlossen.
Von der gotischen Innenausstattung ist, nachdem die einstige Bischofs- und Klosterkirche zu einer evangelischen Pfarrkirche geworden war, nicht mehr viel erhalten. Das auffälligste Kunstwerk, das um 1420 entstandene und als Lebensbaum gestaltete Triumphkreuz, stammt aus der 1945 zerstörten Marienkirche in Wismar. Das bedeutendste Kunstwerk ist der gotische Flügelaltar (um 1490), in dessen Mitteltafel ein detailreiches Sandsteinrelief (ebenfalls um 1420) eingearbeitet wurde. Diese Mitteltafel zeigt eine Kreuzigungsszene, links davon St. Georg, rechts über einem drastisch ausgearbeiteten Höllenschlund die Auferstehung Christi. Am ältesten ist das achteckige eiserne Taufbecken (1325), das noch aus dem Vorgängerbau stammt. Die übrige Ausstattung ist v. a. neugotisch geprägt und wurde während einer Restaurierung des Doms Mitte des 19. Jh. hinzugefügt. Das Bild der Kreuzigung am Altar malte Gaston Lenthe, von dem auch das Altarbild der Schelfkirche stammt.
Neugotisch ist auch der Kirchturm, der anstelle des niedrigeren gotischen Turms Ende des 19. Jh. errichtet wurde. Abgeschlossen von einem spitzen, kupfergedeckten Helm, erhebt sich der Turm 117,5 m in die Höhe und prägt die Silhouette der Stadt. Wer sich die 220 Stufen hinaufquält, wird mit einem grandiosen Blick über die Stadt und die umliegenden Seen belohnt. An die Nordflanke schließen sich noch die Reste des ehemaligen Klosters an, die Thomaskapelle und der hübsche Kreuzgang.
♦ Mai bis Okt. Mo-Sa 10-17 Uhr, So 12-17 Uhr geöffnet, im Winterhalbjahr etwas eingeschränkt. Turmbesteigung bis 30 Min. vor Schließung. Domführungen: Mo 15 Uhr, Di und Sa 11 Uhr, Do 14 Uhr.
Schelfstadt
Die „Schelfe“, was so viel bedeutet wie „Land zwischen den Wassern“, erstreckt sich etwa zwischen Pfaffenteich, Ziegelinnensee, Werderstraße sowie Friedrich- bzw. Burgstraße. Bereits 1284 befand sich das Gebiet im Besitz der Bischöfe, damals ein einfaches kleines Fischerdorf mit einer Pfarrkirche. 1705 ernannte Herzog Friedrich Wilhelm (1675-1713) die Schelfe zu einer selbstständigen Stadt mit eigener Verwaltung, der „Schelfstadt“ (oder „Neustadt“), und ließ diese auch städtebaulich umgestalten: Es entstanden geradwinklige Straßenzüge mit ein- bis zweigeschossigen Fachwerkbauten, deren Zentrum der Schelfmarkt mit der gleichnamigen Kirche bildet. Heute zählt die Schelfstadt zu den schönsten und beschaulichsten Ecken Schwerins.
Das prächtige Triumphkreuz im Dom stammt ursprünglich aus Wismars Marienkirche
Schelfkirche (St. Nikolai): Der barocke Backsteinbau mit dem Grundriss eines griechischen Kreuzes entstand in den Jahren 1708-1713 ebenfalls im Auftrag von Friedrich Wilhelm nach Plänen des Ingenieurs Jacob Reutz. Ein früherer gotischer Kirchenbau (St. Nikolai von 1238) erschien für die neue Stadt zu klein und wurde für den Neubau abgerissen. Als einziger echter barocker Kirchenbau und erste große nachreformatorische Kirche ganz Mecklenburgs hat die Schelfkirche heute besondere Bedeutung. Das Kircheninnere stammt von einer Renovierung aus dem Jahr 1858, sehenswert ist das Altarbild von Gaston Lenthe (1805-1860), dem Hofmaler von Großherzog Paul Friedrich. Die Fürstengruft unter dem Altar kann besichtigt werden (Licht kostet 1 €, Vorsicht, steile Treppe). Die Fassade der Schelfkirche wurde zwischen 1983 und 1995 umfassend saniert.
♦ Tägl. mind. 11-16 Uhr.
Schleswig-Holstein-Haus: In dem Barockhaus von 1737 befindet sich seit 1995 ein wichtiges kulturelles Zentrum Schwerins: Wechselnde Ausstellungen, Lesungen, Konzerte und vieles mehr füllen den Veranstaltungskalender. Eine ständige Ausstellung der Stiftung Mecklenburg ist der mecklenburgischen Landesgeschichte gewidmet.
♦ Di-So 11-18 Uhr und zu Veranstaltungen. Eintritt (Dauerausstellung) 3 €, erm. 2 €. Puschkinstr. 12, Tel. 0385-555527.
Um den Pfaffenteich
Blau und Grün sind die Farben der Landeshauptstadt
In einer natürlichen Senke wurde der Pfaffenteich („Papendiek“, so genannt, weil er sich im Besitz der Kirche befand) bereits im 12. Jh. als künstlicher See aufgestaut. Damals markierte der kleinste See Schwerins noch die nördliche Grenze der Stadt. Wiederum ist es dem Stadtarchitekten Demmler zu verdanken, dass sich der See heute so harmonisch in das Stadtbild einfügt: Im Zuge der innerstädtischen Ausdehnung um 1840 ließ er die Ufer befestigen und einen repräsentativen Rundweg mit Lindenallee um den See herum anlegen.
Repräsentativ sind auch die noblen Bürgerhäuser, die hier bald darauf entstanden: am Südufer des Sees zunächst das gelbe Wohnhaus Demmlers (Arsenalstraße, Ecke Mecklenburger Straße), an der Ecke zur Friedrichstraße das Kückenhaus von 1868 (heute Restaurant-Café Friedrich’s) des Komponisten und Hofkapellmeisters Friedrich Kücken (1810-1882). Blickfang am Südufer des Sees ist allerdings das Arsenal schräg gegenüber: Der ockerfarbene Bau im Stil der englischen Tudorgotik entstand zwischen 1840 und 1844 ebenfalls nach Plänen von Demmler und beherbergte neben Kaserne, Zeughaus, Stallungen und Werkstätten auch das Militärgericht und das Gefängnis der Stadt. Nach umfangreicher Restaurierung befindet sich hier heute das Innenministerium von Mecklenburg-Vorpommern.
Die kleine Pfaffenteichfähre pendelt regelmäßig zwischen dem Ost- und Westufer des Sees und erlaubt schöne Ausblicke auf das Südufer mitsamt den Wasserkaskaden. Auf dem Pfaffenteich finden alljährlich im August die bekannten Drachenbootrennen statt.
Dokumentationszentrum Schwerin
Das „Dokumentationszentrum des Landes für die Diktaturen in Deutschland“ befindet sich in einem schmucklosen, 1916 errichteten Gebäude hinter der Schweriner Justiz am Demmlerplatz, die auch heute noch einen Teil des Gefängniskomplexes nutzt. Die Ausstellung im Zellentrakt erinnert dreifach an die Opfer politischen Unrechts - begangen zur Zeit des Nationalsozialismus (1. Stock), während der sowjetischen Besatzung (2. Stock) und in der DDR (3. Stock). Hintergründe und Einzelschicksale, Haftbedingungen und Verhörmethoden und nicht zuletzt die bestürzend engen Zellen („grüne Hölle“) selbst ergeben ein eindrückliches Bild davon, was die Menschen in der Haft erleiden mussten.
♦ Di-Fr 12.30-16 Uhr, Eintritt frei. Eingang vom Obotritenring 106, Tel. 0385-74529911, www.dokumentationszentrum-schwerin.de.
Praktische Infos zu Schwerin
Information Touristinformation, am Markt mitten im Zentrum; vielfältige Informationen und Zimmervermittlung, Stadtführungen, Kartenvorverkauf, Souvenirs etc. Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa/So 10-16 Uhr. Am Markt 14, 19055 Schwerin, Tel. 0385-5925212, www.schwerin.de.
Schwerin-Ticket
Zahlreiche Vergünstigungen in Museen und bei Stadtführungen sowie freie Fahrt mit Stadtbussen und Straßenbahn: Das Schwerin-Ticket gibt es für Erwachsene zum Preis von 5,70 € (24 Std.) bzw. 8,40 € (48 Std.) Kinder unter 15 J. zahlen 3,40 € bzw. 4,30 €. Erhältlich bei der Touristinformation und am Ticketschalter des Schweriner Nahverkehrs am Marienplatz.
Verbindungen Bahn: Die Landeshauptstadt ist erstaunlich schlecht an das Netz der DB angeschlossen: Mit dem IC/ICE etwa alle zwei Stunden nach Hamburg und weiter bis Frankfurt und in anderer Richtung bis Stralsund (teils Greifswald), zwar nicht jeden Tag, aber immerhin. Mit dem RE nach Güstrow (etwa stündl.) nur mit Umsteigen in Bützow oder Bad Kleinen, nach Waren nur mit Umsteigen in Rostock, nach Neustrelitz ebenfalls Umstieg in Rostock (ICE) oder zweimal umsteigen (RE) und von und nach Berlin Hauptbahnhof (Fahrtdauer gut 2 Std. 30 Min.) nur mit dem RE. Der Schweriner Hauptbahnhof befindet sich am Grunthalplatz im nördlichen Zentrum.
Bus/Straßenbahn: Verkehrsknotenpunkt für Busse und Straßenbahnen sind der Marienplatz und der Bahnhofsplatz. Bus Nr. 14 fährt vom Marienplatz zur Jugendherberge, die Straßenbahnen auch in die Außenbezirke. Näheres unter Tel. 0385-3990222 (Fahrplanauskunft) bzw. www.nahverkehr-schwerin.de.
Pfaffenteichfähre: pendelt Mai-Sept. tägl. außer Mo 10-18 Uhr zwischen Bahnhof, E-Werk, Gaußstraße/Schelfmarkt und Arsenal, Abfahrten nach Bedarf, einfache Fahrt 2 €, Kinder 3-14 J. 1 €.
Parken: Ein größerer Parkplatz in Altstadtnähe schräg gegenüber dem Marstall und beim Schlossparkcenter am Marienplatz, gegenüber dem Schloss ein kleiner Parkplatz, nahebei aber ein Parkhaus.
Taxis: unter anderem am Hauptbahnhof, Marienplatz und am Alten Garten, Schweriner Taxigenossenschaft Tel. 0385-717171.
Aktivitäten
Bootsausflüge Weiße Flotte, von April bis Okt. diverse Touren über den Schweriner See und den Ziegelsee. Erw. 16 €, Kinder bis 14 J. 8 €, Kinder unter 6 J. frei, „Hund, Katze, Maus“ 3 €. Auch Teilstrecken möglich, z. B. nach Zippendorf. Infos bei der Touristinformation oder beim Anleger der Weißen Flotte (gegenüber vom Schloss). Werderstr. 140, Tel. 0385-557770, www.weisseflotteschwerin.de.
Klettern Schweriner Kletterwald, neben dem Zoo (südlich vom Zentrum, beschildert, Straßenbahn Linie 1 und 2 ab Marienplatz bis Zoo), acht Parcours unterschiedlicher Schwierigkeit, mit Café. Geöffnet Juli bis Anfang Sept. tägl. (meist 10-19 Uhr) sowie in Schulferien (dann eingeschränkt), in der Nebensaison nur am Wochenende, Do meist Ruhetag. Erwachsene 20 €, Kinder 15 €, Familienkarte 47-80 € (es gibt auch Kombitickets mit dem Schweriner Zoo). An der Crivitzer Chaussee 15, Tel. 0385-5894551, www.schweriner-kletterwald.de.
Sport WINSTONGolf, ca. 10 km von Schwerin, in Vorbeck an der Ostseite des Schweriner Sees. Zwei 18-Loch-Plätze und ein 9-Loch-Platz, auch Golfschule und Verleih, Restaurant. Kranichweg 1, 19065 Gneven, OT Vorbeck, Tel. 03860-5020, www.winstongolf.de.
Stadtführungen Öffentlicher Stadtrundgang: tägl. 11 Uhr, Treffpunkt vor der Touristinformation, Dauer ca. 1,5 Std. (mit Markt, Dom, Altem Garten, Theater, Schloss), 8 €/Pers.
Nachtwächterführung: von April bis Okt. jeden Fr/Sa 20.30 Uhr, Dauer ca. 1,5 Std., 10 €/Pers.
Einer der vielen hübschen Läden in der Puschkinstraße
Sonderführung Schloss: April bis Nov. Sa und So, Nov. nur So, Start jeweils 12 Uhr, Dauer ca. 1,5 Std., 14 €/Pers., Kinder 2 €. Obligatorische Anmeldung bei der Touristinformation und Personalausweis nicht vergessen (wegen des hier tagenden Landtags).
Stadtrundfahrten Petermännchen, einstündige Rundfahrten mit dem Touristen-Bähnchen, u. a. durch die Altstadt und den Schlossgarten bis zur Schleifmühle, mit Erläuterungen, Abfahrt am Markt, April bis Okt. 4- bis 5-mal tägl., Erw. 12 €, Kinder bis 16 J. 6 €. Tel. 0385-65800, www.petermaennchen-stadtrundfahrten.de.
Doppeldecker-Bus, ab Anlegestelle der Weißen Flotte tägl. ab 10 Uhr alle 45 Min. (Nov./Dez. eingeschränkt, Jan./Febr. nicht), durch die Schelfstadt und entlang des Pfaffenteichs, dann zum Ostdorfer See (und Schleifmühle). 12 €/Pers., erm. 5 € (Kinder 6-14 J.). Infos unter Tel. 0385-48592182, www.schwerinerstadtrundfahrt.de.
Zoo Schweriner Zoo, südlich vom Zentrum (ausgeschildert), Leser schrieben uns begeistert „von dem wunderbar angelegten, vielseitigen und sehenswerten Zoo“. Tram Linie 1 und 2 ab Marienplatz. Ganzjährig geöffnet, im Sommer 9-18 Uhr (Sa/So bis 19 Uhr), im Winterhalbjahr tägl. ab 10 Uhr (Einlass bis 15 Uhr), Erw. 12,50 € (Nov. bis Febr. 10,50 €), Kinder (3-17 J.) 6 €, Familienkarte 31 € (es gibt auch Kombitickets mit dem Schweriner Kletterwald). Crivitzer Chaussee 1, Tel. 0385-395510, www.zoo-schwerin.de. ♦ Lesertipp
EinkaufenKarte
Die Shoppingmeilen der Stadt erstrecken sich in der Gegend um den Marienplatz (hier auch die Einkaufszentren Schlosspark-Center und Schweriner Höfe) und in der Fußgängerzone bis zur Mecklenburgstraße, vornehmlich mit städtischem Laden-/Ketten-Einerlei. Individueller gestaltete Einkaufsangebote finden sich in den Altstadtgassen um den Markt. Vor allem in der Puschkinstraße haben sich ein paar interessante Geschäfte angesiedelt, die u. a. Wohndesign, Küchen-Accessoires, Schmuck, Kunst etc. im Angebot führen, z. B.:
Das Kontor 10, Kunstkaufhaus und Silberschmiede. Allein die Räumlichkeiten des sorgfältig restaurierten Gebäudes von 1571 sind sehenswert, die Kunst ist es freilich auch. Puschkinstr. 36, www.kontor-schwerin.de. Mo geschl.
Design zum Gebrauch 9, gut, die Möbel werden sich vielleicht etwas umständlich nach Hause transportieren lassen, bei den eleganten Wohn-Accessoires (vulgo formschöner Schnick-Schnack) sieht das vielleicht schon anders aus. Puschkinstraße 32, www.dezug.com. Mo geschl.
Das Mecklenburgische Staatstheater blickt auf über 130 Jahre Geschichte zurück
Formost 8, ostdeutsches und internationales Design, darunter auch Art déco, Jugendstil und Bauhaus-Klassiker wie die Wagenfeld-Leuchte, Küchen- und Wohn-Accessoires, Schreibwaren, Spielzeug, Taschen und vieles mehr, nachhaltig und zeitlos elegant. Puschkinstr. 28, www.formost.de.
Keramikwerkstatt Loza Fina 11, sympathische Werkstatt und Verkaufsladen in einem, was bedeutet, dass man auch bei der Arbeit an der Töpferscheibe zusehen kann. Sehr hübsche Tassen, Schalen, Kannen etc. Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 10-16 Uhr geöffnet. Puschkinstr. 51/53, Tel. 0385-20234122, www.loza-fina.de.
Eine kleine, aber bemerkenswert gut sortierte Buchhandlung für Regionalia und Belletristik ist die Buchhandlung Benno Schoknecht 20 in der Schlossstr. 20, Tel. 0385-565804. Weitere schöne Buchläden sind: Ein guter Tag. Literatur & so in der Buschstraße 16 (Ecke 1. Enge Str., Tel. 0385-39379977) und littera et cetera in der Schliemannstraße 2 (Ecke Puschkinstr., Tel. 0385-5572065).
Veranstaltungen
Theater Das Mecklenburgische Staatstheater erfreut sich weit über die Stadtgrenzen hinaus großer Beliebtheit, der repräsentative Prachtbau gegenüber dem Schloss entstand in den Jahren 1883-1886. Im Großen Haus Schauspiel, Oper und Ballett. Tickets an der Theaterkasse Di-Fr 10-14 Uhr, Sa 16-18 Uhr, außerdem unter Tel. 0385-5300123, Alter Garten 2, www.theater-schwerin.de.
Zum Staatstheater gehört auch das E-Werk am Spieltordamm 1 an der Nordseite des Pfaffenteiches. Das E-Werk und das Große Haus (das Staatstheater) sind auch Spielstätten für die Fritz-Reuter-Bühne, hauptsächlich plattdeutsche Lustspiele und Schwänke.
Der Speicher, Konzert-, Comedy- und Kleinkunstbühne in der Schelfstadt. Konzerte, Lesungen, Kabarett, Filmabende usw. Röntgenstr. 22, Tel. 0385-512105, www.schwerin.de/speicher.
Veranstaltungen Schlossfestspiele Schwerin, große Open-Air-Oper alljährlich von etwa Ende Juni bis Anfang August auf dem Alten Garten, den eindrucksvollen Rahmen bilden das Staatstheater, das Staatliche Museum und nicht zuletzt das nahe gelegene Schloss. Tel. 0385-5300123 oder www.schlossfestspiele-schwerin.de.
Schweriner Gartensommer, von April bis Sept. mit zahlreichen Veranstaltungen im Schlossgarten (darunter die spektakuläre Schlossgartennacht), Programm bei der Touristinformation, www.schwerinergartensommer.de.
Fünf-Seen-Lauf, alljährlich am ersten Samstag im Juli, der größte Volkslauf in Mecklenburg- Vorpommern. Strecken zu 10, 15 und 30 km. Rahmenprogramm mit Kulinarischem, abends Ball. Anmelden kann man sich unter www.fuenf-seen-lauf.de.
Übernachten
1 Speicher am Ziegelsee 2 Seehotel Frankenhorst 3 Niederländischer Hof 7 Weinhaus Wöhler 15 Großer Moor 38 17 Weinhaus Uhle 18 Zur guten Quelle 21 Pension am Theater 23 Jugendherberge Schwerin
Essen & Trinken
1 Speicher am Ziegelsee 5 Friedrich's am Pfaffenteich 6 Zum Feinspitz 7 Weinhaus Wöhler 10 Feine Kost 12 Müllers 14 La Bouche 16 Lukas 17 Weinhaus Uhle 18 Zur guten Quelle 22 Ruderhaus
Cafés
13 Rösterei Fuchs 19 Café Prag
Nachtleben
4 Freischütz
Shopping
8 Formost 9 Design zum Gebrauch 10 Design zum Gebrauch 11 Keramikwerkstatt Loza Fina 20 Buchhandlung Benno Schoknecht
Drachenbootfestival, alljährlich an einem Wochenende im August. An die 100 Drachenboot-Teams treten hier zum Rennen auf dem Pfaffenteich an. Infos: www.drachenbootfestival.de.
ÜbernachtenKarte
Niederländischer Hof 3, edles Ambiente in historischem Gebäude am Pfaffenteich, sicherlich eine der besten Adressen der Stadt. 32 Zimmer (und sechs Suiten) im so genannten „englischen“ Stil, die modernen Badezimmer sind mit Marmor ausgekleidet. DZ ab 125 €, Dreibett-Zimmer ab 151 €, Frühstück 15 €/Pers., Hund 15 €/Tag. Alexandrinenstr. 12-13, 19055 Schwerin, Tel. 0385-591100, www.niederlaendischer-hof.de.
Weinhaus Uhle 17, das vor wenigen Jahren komplett renovierte Traditionshaus mitten in der Altstadt bietet neben Weinbistro und Gourmet-Restaurant auch elegante, stilvolle Zimmer. DZ 189 €, Frühstück 16 €/Pers. Schusterstr. 13-15, Tel. 0385-48939430, www.weinhaus-uhle.de.
Pension am Theater 21, zentrale Lage neben dem Staatstheater, angenehmes Ambiente, 18 gepflegte Zimmer. Freundlicher Service. DZ 79-100 €, jeweils inkl. Frühstück. Wer länger bleiben möchte, kann auch eine 2-Zimmer-Ferienwohnung zum Wochenpreis von 410 € mieten. Theaterstr. 1-2, 19055 Schwerin, Tel. 0385-593680, www.schwerin-pension.de.
Weinhaus Wöhler 7, zu dem bekannten Lokal samt Weinstube und -kontor am Rand der Schelfstadt gehören auch gediegene Zimmer. DZ je nach Größe und Ausstattung 124-139 €, Frühstück 13 €/Pers. Hund einmalig 15 €, Parkplatz 4-8 €/Tag. Puschkinstr. 26, 19055 Schwerin, Tel. 0385-555830, www.weinhaus-woehler.de.
Zur guten Quelle 18, bodenständiges Ambiente in einem historischen Fachwerkhaus im Herzen der Altstadt, wenige Meter vom Markt entfernt. Freundlicher Service, sechs Zimmer. Gutbürgerliches Restaurant. DZ ab 87 €, Familienzimmer 119 €, jeweils inkl. Frühstück, Halbpension 15 €/Pers. (zwei Gänge). Hunde 8 €/Tag. Schusterstr. 12, 19055 Schwerin, Tel. 0385-565985, www.gasthof-schwerin.de.
Großer Moor 38 15, Pension und Ferienwohnungen in einem „liebevoll sanierten“ Fachwerkhaus im Zentrum von Schwerin (drei DZ, vier Ferienwohnungen), „hervorragend“, „leckeres Frühstück“, angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis. DZ 72-75 €, Ferienwohnung 63-89 €. Großer Moor 38, 19055 Schwerin, Tel. 0385-734434, www.schweriner-ferienwohnungen.de. ♦ Lesertipp
Jugendherberge Schwerin 23, orangefarbener, schon etwas älterer 91-Betten-Bau mitten im Wald, zwischen Schweriner See und Faulem See. Jugendherbergsausweis ist obligatorisch. Im Sommer sollte man ca. eine Woche vorher reservieren. Bus Nr. 14 ab Marienplatz. Waldschulweg 3, 19061 Schwerin, Tel. 0385-3260006, www.djh-mv.de.
Bio/Regional Außerhalb Hotel Speicher am Ziegelsee 1, edel-gemütliches Ambiente in einem sorgfältig restaurierten Getreidespeicher aus dem Jahr 1939, etwas abseits des Zentrums, direkt am Ziegelsee gelegen (knapp 2 km zum Bahnhof oder zum Schloss). Geschmackvolle Einrichtung mit Korbmöbeln und Terrakotta, im Erdgeschoss Lobby mit Kamin und Bar. Das Restaurant aurum bietet saisonale Küche aus regionalen Produkten, vieles davon in Bioqualität, zu angemessenen Preisen. Terrasse (und Anleger) direkt am See. Sauna, Massagen, Kosmetik. Außerdem Fahrradverleih (auch E-Bikes). DZ 124-149 €, Studio ab 159 €, jeweils inkl. Frühstück, Hund 19 €/Nacht. Speicherstr. 11, 19055 Schwerin, Tel. 0385-50030, www.speicher-hotel.de.
Seehotel Frankenhorst 2, Best-Western-Hotel mit gewohntem Vier-Sterne-Komfort, aber in malerischer, sehr ruhiger Lage an einem Seegrundstück knapp 5 km außerhalb von Schwerin. Die Zimmer verteilen sich auf vier Gebäude, der hintere Flachdachbau erinnert durch die Parkplätze davor ein wenig an ein Motel. Im Inneren jedoch sehr elegant, einladend und modern eingerichtet. Schöne Bäder, Pantry-Küche und kleine Veranda davor. Im Haupthaus Bar, Restaurant und Wintergarten, zum Hotel gehört ein riesiger Garten samt Badestelle und Bootsanleger, außerdem Sauna und Hallenbad. Anfahrt: Die B 104 in nördliche Richtung (Güstrow), dann links ab, beschildert. DZ etwa 148-218 €. Hunde erlaubt. Frankenhorst 5, 19055 Schwerin, Tel. 0385-592220, www.seehotelfrankenhorst-schwerin.de.
Camping Ein sehr schöner Platz findet sich mit dem Ferienpark Seehof am Ostufer, ein weiterer südöstlich von Schwerin in Raben Steinfels, die Süduferperle.
Essen & TrinkenKarte
Traditionsreich: das Weinhaus Uhle
Weinhaus Uhle 17, Traditionsadresse in der Schusterstraße: Weinhandlung (10-18 Uhr geöffnet) sowie Bistro (ab 11.30 Uhr) und elegantes Gourmet-Restaurant (Di-Sa, nur abends geöffnet). Im Bistro - ein paar Tische stehen auch an der verkehrsberuhigten Straße - bekommt man feine, aber unkapriziöse Gerichte (wie Blutwurst mit Stampf oder recht gute Königsberger Klopse) aus regionalen Produkten, Hauptgericht 14-23 €, und ein gepflegtes Glas Wein. Im Feinschmecker-Restaurant degustiert man in festlichem Ambiente vom 3-Gang-Menü für 60 € bis zum 8-Gang-Menü für 120 €. Auch Hotel. Schusterstr. 13-15, Tel. 0385-48939430, www.weinhaus-uhle.de.
Weinhaus Wöhler 7, verwinkelter Fachwerkbau aus dem Jahr 1819, neben den einladenden Historischen Stuben (Restaurant) gibt es auch eine Weinbar und eine Weinhandlung (Weinkontor). Im Sommer stehen Tische auch im schönen Innenhof. Gute Küche mit zuvorkommendem Service, feiner Fisch, aber auch Deftiges. Hauptgericht etwa 13-23 €. Mittags und abends geöffnet, Mo und Di über Mittag geschlossen. Puschkinstr. 26, Tel. 0385-555830, www.weinhaus-woehler.de.
La Bouche 14, in dem sympathischen Bistro (auch Bar) mit einem Hauch französischem Flair kann man in freundlicher Atmosphäre gute saisonale französische Küche oder auch nur ein Glas Wein mit ein paar Snacks, in jedem Fall aber einen entspannten Abend genießen. Hauptgerichte 13-23 €. Kleine, aber feine Weinauswahl. Im Sommer ein paar Tische draußen. Abends geöffnet, Sa/So ab 12 Uhr, Mo/Di Ruhetag. Buschstr. 9, Tel. 0385-39456092, www.bistrolabouche.de.
Fischrestaurant Lukas 16, beliebtes, traditionsreiches Fischlokal mit Wintergarten und Terrasse. Regionale und saisonale Fischgerichte ebenso wie Garnelen und Steaks, leicht gehobene Preise. Hauptgericht 13-20 €. Zentrale Lage unweit des Marktes. Mo-Fr günstiger Mittagstisch. Tägl. 11.30-22 Uhr (Jan. bis März etwas eingeschränkt). Großer Moor 5, Tel. 0385-565935, www.restaurant-lukas.de.
Ruderhaus 22, v. a. besticht der herrliche Blick über den See auf das Schloss, entsprechend beliebt ist an lauen Sommerabenden die Terrasse am Wasser. Innen schick. Gute Küche, wenngleich nicht ganz so raffiniert, wie die Karte suggeriert. Hauptgericht ab etwa 17 €, Pasta ab 15 €, auch Café und abends dank der Terrasse auch ein schöner Ort für einen Cocktail. Di-Fr ab 16 Uhr, Sa/So ab 12 Uhr, Mo Ruhetag. Franzosenweg 21, Tel. 0385-34336855, www.ruderhaus.info.
Zur guten Quelle 18, beliebtes Gasthaus im historischen Fachwerkhaus im Herzen der Altstadt, wenige Meter vom Markt entfernt. Freundlicher Service, bodenständige Küche (und Preise), im Sommer stehen ein paar Tische im kleinen Hof und auf der Gasse. Tägl. ab 12 Uhr, Mo Ruhetag. Schusterstr. 12, Tel. 0385-565985, www.gasthof-schwerin.de.
Restaurant Friedrich’s am Pfaffenteich 5, angenehmes Kaffeehaus-Ambiente im neoklassizistischen „Kücken-Haus“, auch draußen im Gastgarten oder auf der schmalen Loggia recht nett zum Sitzen. Hauptgerichte um 16 €. Geöffnet tägl. ab 11 Uhr (und auch vergleichsweise lange Küche). Friedrichstr. 2, Tel. 0385-555473, www.restaurant-friedrichs.com.
Essen & Einkaufen Bio/Regional Feine Kost 10, Bio-Laden mit vegetarischem und veganem Imbiss unweit des Marktplatzes, tägl. wechselnd stehen eine Suppe (um 5 €) und ein Hauptgericht (8,30 €) auf dem Wochenplan. Mo-Fr 11-16 Uhr. Puschkinstr. 36, Tel. 0385-4848668, www.feinekost-schwerin.de.
Der Schweriner See ist der zweitgrößte See Mecklenburg-Vorpommerns
Mein Tipp Zum Feinspitz 6, ein Stück Österreich in der mecklenburgischen Residenzstadt. Österreichische Weine und Delikatessen, vor allem aber auch ein kleines, aber sehr feines Kaffeehaus: ob auf eine Melange, einen Grünen Veltliner aus der Wachau oder eine Palatschinken, im Feinspitz lässt es sich genießen. Auch Frühstück und kleine Gerichte zu Mittag (sehr gute Tagesangebote). Sehr freundlich geführt. Kurzum: Leiwand! Di-Fr 11.30-20 Uhr, Sa 10-18 Uhr geöffnet. Puschkinstr. 31, Tel. 0385-58931884, www.zum-feinspitz.de.
Cafés Café Prag 19, traditionsreiches Café in der Schlossstraße (Ecke Puschkinstraße). Den Namen verdankt das Café dem guten tschechischen Bier, das hier zu DDR-Zeiten ausgeschenkt wurde, doch die Geschichte der einstigen Hofkonditorei mit Café reicht weit zurück bis ins 18. Jh. Heute präsentiert sich das Café Prag als ein herrlich altmodisches, im besten Sinne klassisches Kaffeehaus. Schön fürs entspannte Frühstück oder eine gepflegte Tasse Kaffee, auch Mittagstisch; Tische auch draußen vor dem Haus. Mo-Fr 8-19 Uhr, Sa/So ab 10 (So bis 18 Uhr). Puschkinstr. 64, Tel. 0385-565909.
Rösterei Fuchs 13, schlicht-gemütlich, auch ein paar Tische auf dem Marktplatz. Zuallererst natürlich - der Name verrät es - Kaffeerösterei und damit Fachgeschäft für Kaffeespezialitäten. Daneben, das bietet sich an, auch Café. Es gibt Schokolade (handgeschöpfte Tafeln und zum Trinken), leckeren Kuchen, Bistro-Küche und: Röstbrote, d. h. geröstete Sauerteigbrote mit unterschiedlichen Belägen wie z. B. mediterran mit Feta und Pesto. Tägl. 9-20 Uhr geöffnet (Sa/So bis 18 Uhr). Am Markt 4, Tel. 0385-5938444, www.roesterei-fuchs.de.
Bio/Regional Müllers 12, das urban-puristisch eingerichtete, sympathische Café bietet vegetarische und vegane Gerichte (z. B. den „Vöner“, ein vegetarischer Döner) und Kuchen. Viele der verwendeten Zutaten stammen aus ökologischer Landwirtschaft. Auch Kneipe, freundlicher Service, gemütlicher Hinterhof (zum Dom hin). Tägl. 9-21 Uhr geöffnet. Puschkinstr. 55, Tel. 0385-55596990, www.muellers-schwerin.de.
Kneipen Freischütz 4, super Kneipe am Ziegenmarkt (unterhalb der Schelfkirche), junges Publikum, lässige Atmosphäre, günstige Tagesgerichte und Wochenkarte, günstig auch die Getränke. Im Sommer Tische auch draußen an der Straße. Place to be. Mo-Fr ab 11 Uhr geöffnet, Sa/So ab 18 Uhr. Ziegenmarkt 11, Tel. 0385-561431, www.zum-freischuetz.de.
Um den Schweriner See
Zwar liegt die Landeshauptstadt an Deutschlands viertgrößtem See (61,5 qkm), doch geht es an seinem Ufer recht ruhig zu. Ein nennenswerter Strand findet sich am Südufer, ein toller Campingplatz am Ostufer, ansonsten bleibt die Gegend abseits der Landeshauptstadt menschenleer. Das sumpfige Nordufer des Schweriner Sees kann ohnehin nur weiträumig umfahren werden. Einen Besuch wert sind das Freilichtmuseum im Süden und Schloss Wiligrad über dem Westufer.
Am Südufer des Schweriner Sees
Zippendorfer Strand: Der Hausstrand von Schwerin liegt am südlichen Ufer des Schweriner (Innen-)Sees. Der schöne Sandstrand zieht die Badegäste hier schon seit Anfang des 19. Jh. an, um die Jahrhundertwende entstand dann die Strandpromenade mit den repräsentativen Villen. Am Strand Beachvolleyball, Bootsanleger, Imbissbuden, Gaststätten und einige Unterkunftsmöglichkeiten. Zippendorf selbst ist ein ruhiger Ort mit großer Seniorenresidenz am Waldrand.
Vom Zippendorfer Strand fällt der Blick auf die beiden Inseln Kaninchenwerder und Ziegelwerder, zwei unbewohnte Naturschutzgebiete, die zahlreichen Wasservögeln als Brutplatz dienen.
Anfahrt Mit dem Pkw: Zippendorf liegt ca. 3 km südlich von Schwerin; auf der B 321 Richtung Güstrow, dann links ab, beschildert. Großer gebührenpflichtiger Parkplatz am Strand.
Mit Tram/Bus: Tram Linie 1 oder 2 ab Marienplatz (Richtung Hegelstraße) bis Stauffenbergstraße, dort umsteigen in den Bus Linie 6 bis Zippendorfer Strand.
Zu Fuß/mit dem Fahrrad: Im Schweriner Schlossgarten auf den Franzosenweg einbiegen und diesem (vorbei am Zoo) immer folgen, zu Fuß ca. 90 Min.
Weiße Flotte: Im Sommer wird der Zippendorfer Strand mehrmals tägl. von den Schiffen der Weißen Flotte angefahren.
Freilichtmuseum für Volkskunde Schwerin-Mueß: Ein schöner Ausflug zu den Traditionen bäuerlichen Lebens in Mecklenburg. Der etwa einstündige Rundgang führt durch rund 20 Gebäude aus dem 18. bis ins frühe 20. Jh., die zwischen 1970 und 1989 restauriert und für die Besucher mit viel Liebe zum Detail hergerichtet wurden, darunter Bauernhäuser und Scheunen (besonders eindrucksvoll das Gehöft auf der anderen Straßenseite, dem Eingang gegenüber), Dorfschmiede, Büdnerei (Hallenhaus norddeutscher Kleinbauern), Spritzenhaus und eine Dorfschule. Zudem gibt es einen Kräutergarten, einen überdachten Backofen und diverse landwirtschaftliche Geräte. Ausstellungen informieren über Themen wie Imkerei, ländliches Schulwesen und Binnenfischerei. Im Kunstkaten werden Sonderausstellungen gezeigt. Es finden auch zahlreiche Veranstaltungen statt, darunter auch Gastspiele der Fritz-Reuter-Bühne in der Theaterscheune, Puppentheater, Vorträge, (Kunst-)Handwerk oder auch Märkte. Ein freundliches, günstiges Café (mit Terrasse) befindet sich auf dem Gelände, ein Museumsshop am Eingang.
♦ Mitte April bis Sept. Di-So 10-18 Uhr (Einlass bis 17.30 Uhr), Okt. Di-So 10-17 Uhr. Das Café ist Di-So 11-17 Uhr geöffnet (im Okt. bis 16.30 Uhr). Eintritt 5 €, Kinder/Jugendliche unter 18 J. 2 €, Familienkarte 10 €. Alte Crivitzer Landstr. 13, 19063 Schwerin, Tel. 0385-208410.
Anfahrt Von Schwerin zunächst in südlicher Richtung nach Zippendorf und dann in den Nachbarort Mueß. Dort ist das Freilichtmuseum bestens ausgeschildert. Mit Tram Nr. 1 oder 2 ab Marienplatz (Richtung Hegelstraße) bis Stauffenbergstraße, dort umsteigen in den Bus Nr. 6; das Museum hat eine eigene Haltestelle.
Einkaufen Fischereihof Mueß, neben dem Museum und direkt am Schweriner See gelegen; hier gibt es frischen und geräucherten Fisch. Ganzjährig geöffnet, Di-Fr 8-18 Uhr, Sa 8-12 Uhr, So/Mo geschl. Zum Alten Bauernhof 7 a.
Am Ostufer des Schweriner Sees
Ganz im Südosten des Schweriner Sees zeigt sich Raben Steinfeld mit seinen Häusern im englischen Landhausstil noch relativ idyllisch (Campingplatz am See → Camping). Am Ortsrand erinnert ein Denkmal an den Todesmarsch der Häftlinge aus den Konzentrationslagern von Sachsenhausen und Ravensbrück, der hier am 2. Mai 1945 mit der Befreiung durch die Rote Armee endete.
Dann: Felder, so weit das Auge reicht, durchschnitten von kilometerlangen Alleen, Bauernhöfe und stillgelegte Agrarbetriebe am Wegesrand, hier und da ein kleines, ruhiges Dorf, aber auch die Autobahn A 14 nach Wismar - die Ostseite des Schweriner Sees in Stichworten. Idyllisch ist die Gegend nicht (bis auf wenige Oasen), eher wirkt sie verlassen. Etwa in der Mitte des lang gezogenen Sees hilft der Paulsdamm (B 104) zwischen Wickendorf und Rampe ein wenig Wegstrecke sparen.
Übernachten Schloss Basthorst, ein gutes Stück außerhalb von Schwerin gelegen, ein schmuckes Schloss mit dominantem Neubau nebenan, ruhige Lage, hinter dem Park erstreckt sich der Glambecksee. Gehobenes Restaurant, dazu ein großzügiger Wellnessbereich mit Schwimmbad, Sauna und Dampfbad, Massagen und Kosmetikbehandlungen. Etwa 24 km östlich von Schwerin. DZ 144-228 €, jeweils inkl. Frühstück, auch Appartements. Schlossstr. 18, 19089 Crivitz/OT Basthorst, Tel. 03863-5250 www.schloss-basthorst.de.
Camping Süduferperle, in Raben Steinfeld, direkt am See gelegen. Platz mit viel Baumbestand, Liegeplätzen im Sportboothafen, hier befindet sich auch eine Tauchschule Kosie’s DIVE (www.dive-schwerin.de). Auch Bootsverleih mit Kanus und Ruderbooten. Zuletzt wurde die Gaststätte neu gebaut und soll bis 2021 fertig sein. Ganzjährig geöffnet. Anfahrt: in Raben Steinfeld ausgeschildert. Stellplatz für Zelt, Pkw und 2 Pers. 18 €. Stellplatz Wohnmobil/-wagen und 2 Pers. 24 €. Forststr. 19, 19065 Raben Steinfeld, Tel. 03860-312, www.sueduferperle.de.
Golf → WINSTONGolf.
Westufer und Schloss Wiligrad
Ebenfalls eher abgelegen, aber doch deutlich dichter besiedelt und verkehrsreicher als das Ostufer. Zwischen Bad Kleinen und dem Ort Hohen Viecheln ganz im Norden des Sees überquert man die im 16. Jh. angelegte „Viechelschen Fahrt“, die den Schweriner See mit der Ostsee verbindet. Der heute Wallensteingraben genannte Kanal konnte sich aber als Wasserweg nie durchsetzen und verfiel bald wieder.
Kulturelles Highlight am Westufer ist Schloss Wiligrad: Das Schloss in schöner Lage am See wurde in den Jahren 1896-1898 im Auftrag des mecklenburgischen Herzogs Johann Albrecht erbaut, der hier bis zu seinem Tod im Jahr 1920 lebte. Umgeben ist das Anwesen, dessen Nebengebäude weitgehend renoviert sind, von einem hübschen, über 200 Hektar großen Wald- und Landschaftspark mit Teich, Laubengang und vielen exotischen Bäumen. Spazierwege führen die steile Böschung hinab zum Ufer des Schweriner Sees, wo sich entlang der Promenade ein paar lauschige Badestellen finden. Im Schloss unterhält der Kunstverein Wiligrad eine überaus sehenswerte Galerie. In hellen Räumen werden jährlich wechselnde Ausstellungen, vornehmlich mit Künstlern aus Mecklenburg-Vorpommern, sehr ansprechend präsentiert. Etwa viermal im Jahr ist Ausstellungswechsel und Ende des Jahres findet die Kunstbörse statt. Im schönen Kaminzimmer befindet sich zudem der Art-Shop (Malerei, Grafik, Skulpturen, Porzellan etc.).
♦ Galerie: Geöffnet Di-Sa 10-18 Uhr, So 11-18 Uhr, Mo geschlossen, Eintritt 3,50 €. Anfahrt: am Nordende von Lübstorf Richtung See abbiegen (beschildert), dann 2 km durch den Wald zum Schloss. Kunstverein Wiligrad e. V., Schloss Wiligrad, 19069 Lübstorf, Tel. 03867-8801, www.kunstverein-wiligrad.de.
Heute ein Ort der Kunst: Schloss Wiligrad
Camping Ferienpark Seehof, schön ruhig am See gelegener, einladender Campingplatz bei der gleichnamigen Ortschaft ein paar Kilometer nördlich von Schwerin, bestens ausgeschildert und gut organisiert. Mit Gaststätte, Laden, Fahrradverleih, eigenem Seestrand und Bootsanleger, auch Bootsverleih sowie Kreativ-Zentrum mit Kinderspielbude. Netter Service, ganzjährig geöffnet. Stellplatz inkl. 2 Pers. 30-44 € (WoMo-Hafen vor der Schranke 15 €), Mietbad 6 €, Finnhütte (2 Pers.) 40-50 €. Am Zeltplatz 1, 19069 Seehof, Tel. 0385-512540, www.ferienpark-seehof.de.
Mein Tipp Essen & Trinken Schlossgärtnerei Wiligrad. Ein Traum von einem Gartencafé: Im weitläufigen Garten sitzt man an Tischen unter hohen Bäumen oder auf der sonnigen Wiese. Im Gras picken die Hühner, etwas abseits stehen Bienenstöcke, weiter hinten grasen Schafe. Sollte es mal regnen, sitzt man schön im Glashaus. Auf der Tafel stehen die hausgemachten Kuchen angeschrieben. Kaffee super, Kuchen super, was will man mehr? Auf der Rückseite des Cafés findet sich zudem noch ein Hofladen (hier auch Souvenirs). Tägl. 10-18 Uhr geöffnet, in den Wintermonaten Mo/Di Ruhetag. Wiligrader Str. 6, Tel. 03867-612703.
Abstecher nach Ludwigslust
Der Sonnenkönig hauste ja schließlich auch nicht in Paris! Also ließ sich Herzog Friedrich von Mecklenburg-Schwerin eigens eine prächtige Residenz auf dem Lande errichten. Und das Ergebnis konnte sich damals wie heute sehen lassen.
Zugegeben: Das echte Versailles ist etwas größer geraten als das „Versailles des Nordens“. Aber mit der bereits bestehenden Planstadt der Verwandtschaft, der Nachbar-Residenz Neustrelitz, konnte Ludwigslust allemal mithalten: barock strukturierte Straßenzüge mit einer weiten Hauptachse, ein respektables Schloss mit Wasserspielen und ein prächtiger Schlossgarten.
Anfang des 18. Jh. gab es noch kein Ludwigslust, nur ein kleines Dorf namens Klenow am Rand eines wildreichen Waldes. Der Jagdleidenschaft Herzog Christian II. Ludwig geschuldet wurde in das Lieblingsrevier des Herzogs nicht nur ein kleines Jagdschloss gestellt, sondern der Ort auch umgetauft in Ludwigs-Lust. Erst der Sohn Ludwigs aber, Friedrich, begann aus dem waidmännischen Refugium eine formidable Residenz zu machen, nachdem er diese 1764 von Schwerin nach Ludwigslust verlegt hatte. Der feinsinnige Friedrich, Herzog von Mecklenburg-Schwerin, auch „der Fromme“ genannt, kannte viele Tugenden, Sparsamkeit gehörte nicht dazu. Neben dem bescheidenen Jagdschloss entstand nach Plänen des Architekten Johann Joachim Busch 1772-1776 ein repräsentatives Schloss. Zuvor war bereits die Stadtkirche errichtet worden (1765-1770), für die Busch ebenso verantwortlich zeichnete, wie auch die Planung der streng strukturierten Stadtanlage auf ihn zurückging. Busch prägte bis zum Ende des 18. Jh. das architektonische Bild der Residenzstadt, sein Nachfolger war Johann Georg Barca, der nach 1808 in Ludwigslust wirkte. Vorbei war es mit der höfischen Pracht, als Großherzog Paul Friedrich im Jahr 1837 die Residenz wieder zurück nach Schwerin verlegen ließ, Ludwigslust diente nunmehr nur noch als Sommerfrische, Witwensitz und Jagdschloss. Bereits in den 1920er Jahren waren einige Räume des Westflügels des Schlosses für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden, die herzogliche Familie lebte hier noch bis 1945.
Der Volksmund übrigens bemüht selten Vergleiche zu französischen Prunkbauten, der Name Ludwigslust wird zugewandt und mundfaul auch zu „Lulu“ zusammengefasst. Und „Lulu“ mit seinen geradlinigen Straßenzügen und den schmucken Backstein- oder Fachwerkhäusern ist heute ein lebendiges kleines Städtchen, das die vielen Besucher rund um Schloss und Schlosspark freundlich empfängt.
Sehenswertes
Schloss Ludwigslust
Zunächst ist Ludwigslust an sich sehenswert: die barocke Stadtanlage mit der Schlossstraße als lange und breite Achse, die über den kreisrunden Alexandrinenplatz mit dem Standbild der reitenden Alexandrine, Tochter der Königin Luise und Gattin von Paul Friedrich von Mecklenburg-Schwerin, zum Schlossplatz führt; dann das Schloss samt Schlossplatz und umliegender Gebäude; der Schlossgarten, der zu den schönsten Landschaftsgärten Norddeutschlands gehört, und und und.
Schloss (mit Museum): Dass das bescheidene kleine Jagdschloss in Sachen Repräsentanz keine Dauerlösung sein konnte, war nach dem Tod von Herzog Christian II. Ludwig im Jahr 1756 schnell klar, zumal es das bisherige Schloss an Komfort deutlich mangeln ließ. Seinem Sohn Friedrich dem Frommen, dem sittenstrengen Schöngeist, gefiel es ebenfalls gut in Ludwigslust und er gab deshalb das neue Residenzschloss in Auftrag, das unter Hofbaumeister Johann Joachim Busch (1720-1802) in den Jahren 1772-1776 ausgeführt wurde. Von ihm stammen auch die Entwürfe für den Schlossplatz, Kanal und Kaskade sowie, hinter den Kaskaden, den Bassinplatz, der von zahlreichen Backsteinhäusern umgeben wird: seinerzeit die Wohnhäuser von Adel und Hofstaat.
Das Schloss selbst wurde aus Ziegeln errichtet und mit einer für Mecklenburg eher untypischen Sandsteinfassade überzogen. Es entstand ein dreigeschossiger, symmetrischer Bau, der stilistisch zwischen Spätbarock und Klassizismus zu verorten ist. 1777, die Innenausstattung war noch nicht fertig, zog der Herzog bereits in sein neues Zuhause, im gleichen Jahr ließ er das alte Schloss in weiten Teilen abtragen. Besonders beachtenswert an der Fassade sind die Attikafiguren am Dach des Schlosses: Zu sehen sind 40 Statuen, die Allegorien der Künste, der Tugenden und besonders der Wissenschaften darstellen, nicht aber der Schauspielkunst, die der fromme Friedrich verabscheute. Die mittlere Figurengruppe der Kaskade gegenüber vom Schloss stellt Allegorien der Flüsse Rögnitz und Stör dar.
Im Schloss ist derzeit der Ostflügel zu besichtigen. Der Rundgang beginnt im zentralen „Goldenen Saal“ im ersten Obergeschoss. Die prächtigen Dekorationen und Ornamente wurden - und das ist das Besondere - aus Papiermaché gefertigt und später vergoldet bzw. mit einer Messinglegierung angestrichen. Der sog. Ludwigsluster Carton (→ Kasten) erzeugt die Illusion von Marmor, Blattgold, Stuck, mithin von Pracht, die besonders im völlig symmetrischen, elegant verzierten Goldenen Saal zum Ausdruck kommt.
Achtung Bauarbeiten!
Nach Fertigstellung des Ostflügels und des „Goldenen Saals“ wird derzeit der Westflügel umfangreich renoviert und ist daher nicht zugänglich. Für die Sanierung werden noch ein paar Jahre veranschlagt.
Es folgen die Räumlichkeiten des Herzogs: Vorzimmer, Audienzzimmer und Arbeitszimmer, dann der Höhepunkt des Trakts: die Gemäldegalerie, schließlich Schlaf- und Wohnzimmer. Im zweiten Obergeschoss geht es durch die ebenfalls recht ansehnlichen Gästeappartements. Während des Rundgangs sind zahlreiche Kostbarkeiten und Kuriositäten zu besichtigen. Dazu gehören Gemälde u. a. des französischen Hofmalers Jean-Baptiste Oudry. Die Sammlung großformatiger Tierporträts rund um das Rhinozeros Clara ist weitgehend in der Staatsgalerie in Schwerin ausgestellt (und kehrt nach Fertigstellung der Sanierung möglicherweise nach Ludwigslust zurück). Heute sind hier u. a. der staatliche Löwe im Vorzimmer des Herzogs sowie zwei Leoparden, Tiger, Hyäne und Kraniche zu sehen. Das Nashorn in der Bildergalerie ist eine verkleinerte Kopie. Auch der Hofmaler Georg David Matthieu darf nicht unerwähnt bleiben. Dessen Figurentafeln aus den 1760er-Jahren, lebensgroße Figuren von Mitgliedern des Adels, wurden in den Sälen aufgestellt und wirkten - durch den Spiegel über Eck betrachtet - verblüffend echt, wenn auch aus heutiger Sicht ein wenig unheimlich. Bemerkenswert sind auch die Korkmodelle meist antiker Bauwerke in der an sich schon sehenswerten Gemäldegalerie, über und über mit Gemälden aus dem späten 18. und frühen 19. Jh. behängt. Ungewöhnlichstes Wohn-Accessoire ist wohl das Meissner-Porzellan-Ensemble aus Kamin, Kronleuchter und Spiegel im Kabinett - kostbar, aber kitschig. Weitere Preziosen finden sich in den Gästeappartements: Uhren, Elfenbeintäfelchen, zahlreiche Miniaturen, Terrakotta-Büsten des bedeutenden französischen Bildhauers Jean-Antoine Houdon und filigrane Wachsbild-Reliefs. Papiermaché, Kork und Wachs: Der Fürst scheint ein Faible für ungewöhnliche Werkstoffe gehabt zu haben - Marmor kann schließlich jeder.
Einen Museumsshop gibt es am Eingang (bei der Kasse), nebenan befinden sich das Schlosscafé im historischen Jagdschloss-Ambiente und eine Terrasse zum Schlossgarten.
♦ Schloss Ludwigslust mit Museum: Mitte April bis Mitte Okt. Di-So 10-18 Uhr, im Winterhalbjahr Di-So 10-17 Uhr, Mo geschl., Einlass bis 30 Min. vor Schließung. Eintritt 6,50 €, erm. 4,50 €. Schlossfreiheit 1, 19288 Ludwigslust, Tel. 03874-57190, www.mv-schloesser.de.
Im Ludwigsluster Schlosspark
Schlosspark und Schlossplatz: zweifellos eine der schönsten Parkanlagen in Mecklenburg-Vorpommern, wenn nicht der ganzen Republik. Ein Besuch in Ludwigslust bleibt unvollständig, wenn man nicht auch einen Rundgang durch den Park macht - und sei es nur ein kurzer Spaziergang im Rücken des Schlosses. Auch wenn der Park in seiner Anlage deutlich älter ist, ist er in seiner heutigen Form v. a. ein Werk des preußischen Gartenbaugenies Peter Joseph Lenné. Lenné integrierte die bestehenden, immer wieder erweiterten Parkanlagen - u. a. den barocken Garten, den englischen Park, den langen Kanal mit den Wasserspielen, der Mitte des 18. Jh. entstanden war und nicht nur der Belustigung, sondern v. a. der Bewässerung diente - und schuf daraus einen weitläufigen, herrlichen Landschaftspark. Zahlreiche Bauwerke, Skulpturen und Parkelemente sind in dem Park zu entdecken: darunter der genannte Kanal (1756-1763) mit Kaskaden und Wasserspielen, die neugotische Katholische Kirche (1803-1809), klassizistische Mausoleen für Herzoginnen, der Louisenteich samt Denkmal, lange prächtige Alleen usw.
Auch um den Schlossplatz gruppieren sich zahlreiche sehenswerte Gebäude, darunter ein paar sehr hübsche niedrige Fachwerkhäuser und die klassizistische Wache. Gegenüber vom Schloss befinden sich die Großen Kaskaden von 1780. Auf einer Achse mit Schloss und Kaskaden liegt schließlich die Schlosskirche (1765-1770), die mit der mächtigen vorgelagerten Säulenhalle eher wie ein Tempel wirkt.
Praktische Infos
Einwohner ca. 12.500.
Information Ludwigslust-Information, sehr freundlich und kundig. Die Info befindet sich links neben dem Rathaus, übrigens ursprünglich die Papiermaché-Fabrik. Tägl. ab 10 Uhr geöffnet. Schlossstr. 36, 19288 Ludwigslust, Tel. 03874-526251, www.stadtludwigslust.de.
Übernachten/Essen & Trinken Landhotel de Weimar, unweit des Schlossplatzes gelegen, viel gelobtes Hotel samt Restaurant Landküche (3-Gänge-Menü 38 €, Hauptgerichte um 17 €, mittags und abends Küche, So Ruhetag), entsprechend schmuck ist selbiges. Der Innenhof des Hauses wird von einer Glaskonstruktion überdacht und bildet eine Art „internen Wintergarten“, in dem es sich stilvoll speisen lässt. Hübsche, individuell eingerichtete Zimmer. DZ 88-138 €, Suiten ab 180 €, Frühstück 13 €/Pers. Schlossstr. 15, 19288 Ludwigslust, Tel. 03874-4180, www.landhotel-de-weimar.de.
Alte Wache, Kaffeehaus und Restaurant. Das ehemalige, 1853 erbaute und nun sorgsam restaurierte Wachgebäude liegt direkt am Schlossplatz. Innen sitzt man in einem kleinen Raum in stilvollem Ambiente, mächtige Kronleuchter hängen von der Decke, in der Ecke steht ein gusseiserner Zierofen. Im Sommer sitzt man auch draußen, in bzw. vor dem prächtigen Portikus oder auch in einem schönen Biergarten. Gute mecklenburgische Küche, auch saisonal, nachmittags herrlich für Kaffee und Kuchen, Hauptgericht um 18 €. Geöffnet Di-Sa 12-22 Uhr, So 11-18 Uhr, Mo Ruhetag. Schlossfreiheit 8, Tel. 03874-570353, www.altewache-ludwigslust.de.
Ludwigsluster Carton - sparen und klotzen
Die Idee ist so einfach wie genial, das Rezept dazu streng geheim: mit Ludwigsluster Carton ließ sich auf der Ludwigsluster Schlossbaustelle des späten 18. Jh. fast jede Illusion erzeugen, sei es in Form antiker Statuen wie die Venus Medici (1786) nach Vorbild der Originalskulptur aus den Uffizien von Florenz, Büsten (z. B. Herzog Friedrichs) und vor allem der unzähligen goldenen Ornamente und Applikationen in den Räumlichkeiten der Fest-Etage im Schloss. Nicht kostspieliger Marmor, gebrannter Stein oder gar Gold sind hier zu sehen, sondern schlicht und einfach raffiniert und täuschend echt bearbeitetes Altpapier! Ein Segen beim herzoglichen Spagat zwischen der Sehnsucht nach einem standesgemäßen Wohneigentum und notorisch klammen Kassen. Wie genau das Rezept für das erstaunlich wetterfeste Papiermaché lautet, haben die Meister am Hof des Herzogs mit ins Grab genommen. Auf alle Fälle gehörten altes und unbrauchbar gewordenes Papier, Mehl und Leim zu den Ingredienzien der Ludwigsluster Illusionen, das ergab zumindest die penible Buchführung am Ludwigsluster Hof. Das Papier für diese Scheinpracht ließ man sich aus den mecklenburgischen Amtsstuben liefern - Recycling im späten 18. Jh., das seine Wirkung nicht verfehlte. Erst in den 1820er Jahren schwand dann das Interesse an der Papp-Deko, die eigens gegründete Ludwigsluster Carton-Fabrique ging 1835 pleite, die Dekorationen und Skulpturen aus Papiermaché haben aber noch heute Bestand.