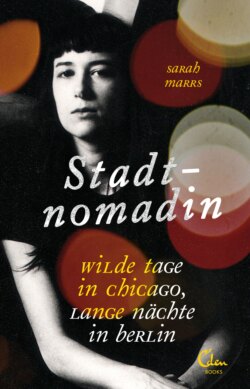Читать книгу Stadtnomadin - Sarah Marrs - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Queen Mum
Оглавление/Seit einiger Zeit wohne ich wieder im Ausland – in meiner Heimatstadt Chicago. Ich habe meine Jeans tief im Schrank meiner Mutter verstaut und versuche nun, eine gepflegte Frau zu werden.
Erster Stopp ist die Sonderaktion im Luxuskaufhaus Neiman Marcus. Dieser Ort ist für meine Mutter das Zentrum des Universums. Sie kann in die tiefste Depression versinken – um sie daraus zu erwecken, muss man sie nur zu Neiman’s bringen, wo sie ihr Geld rausschmeißen kann, als ob es kein Morgen gäbe. Wenn der Mantel von 6.000 Dollar auf bloß 1.800 reduziert wurde, freut sie sich darüber, wie viel sie gespart hat.
Das Gute an Neiman’s ist, dass man sich Essen in die geräumigen Umkleidekabinen liefern lassen kann. Das tun wir auch sofort nach unserer Ankunft; dazu wird eine Flasche Weißwein bestellt. Die Verkäuferin strahlt uns an und bringt alles, was uns ihrer Meinung nach gefallen könnte: gelbe, grüne, blaue Röcke, Karohosen, Blusen in zarten Blumenmustern (mit oder ohne Spitzen) und knallrote Abendkleider für den großen Auftritt. Ich trage wie immer Schwarz. Die Verkäuferin und ihre Kolleginnen rennen unseretwegen so viele Meilen durch den Laden, dass man fast ein schlechtes Gewissen bekommt, wenn man am Ende nur ein paar Hosen zum Sonderpreis von zweihundert Dollar mitnimmt. Meine Mutter versucht, mir alles aufzuschwatzen. Es ist ihr für ihr Selbstbild sehr wichtig, großzügig auszugeben, aber an mir verdienen die hart arbeitenden Verkäuferinnen keine guten Prozente. Eigentlich bräuchte ich erst mal einen Job und eine Wohnung, denke ich mir. Kann schon sein, dass ich später zu Galaveranstaltungen eingeladen werde, aber selbst dann werde ich mit Sicherheit nicht in Knallrot erscheinen.
Meine Mutter ist eine Queen. Sie wurde in Kentucky geboren und wuchs in Evansville, Indiana, auf, wo sie zur Miss Cherry Blossom und später von einer Kühlschrankfirma zur Miss Refridgeadorable gekrönt wurde. Mit ihrem ersten Ehemann machte sie in den Flitterwochen eine Dampferfahrt nach England. Als das Schiff ablegte, sagte ihr frisch angetrauter Ehemann: »Nur weil wir verheiratet sind, heißt das nicht, dass wir monogam bleiben müssen.« Sie heulte die ganze Strecke bis nach Europa. In London und Paris arbeitete sie als Model und wurde als Cover Girl von Harper’s Bazaar und Vogue für ihren »Audrey-Hepburn-Look« bekannt. Sie war sogar das Gesicht der Bounty-Werbung. Sie hatte in Europa auch einige heiße Affären, wie ihr Ehemann immer behauptete. Ihre Rechtfertigung war: »Wenn er es tut, dann tue ich es auch.« Sie vermutete, dass er sogar mit einem seiner männlichen Studenten herumgemacht hatte: »Die waren damals unzertrennlich, wie Siegfried und Roy.«
Am besten gefielen mir immer ihre Geschichten von Marcel Deroche, einem ihrer damaligen Liebhaber aus Paris. Ich hatte das Glück, ihn auf meiner ersten Europareise mit 21 Jahren tatsächlich persönlich kennenzulernen. Ich war schwer beeindruckt, als mich der gut aussehende, große Mann in seinem Jaguar Cabriolet vor meiner Pariser Pension abholte. Obwohl er viel älter war als ich, dachte ich anerkennend: Mensch, Mama, nicht schlecht! Er zeigte mir ganz Paris. Auf roten Teppichen betraten wir die besten Restaurants der Stadt, in denen er als Stammgast herzlich empfangen wurde. Er erinnerte sich gern an meine Mutter und behauptete großzügig, er habe in seinem Leben viele Liebhaberinnen gehabt, doch meine Mutter sei die einzige Frau gewesen, die jemals bei ihm übernachten durfte.
Meine Mutter hat nie Französisch gelernt, aber liebt die englische High Society. Sie schwärmt auch heute noch voller Nostalgie von ihren Londoner Zeiten und hat niemals ihre britische Lebensart aufgegeben. Nach ihrer ersten Scheidung zog sie in den späten Fünfzigerjahren mit einer kleinen Tochter allein nach Chicago.
Mittlerweile ist sie Mitglied in drei Privatklubs und bekommt in allen eine Altersermäßigung. Sie schwärmt für eine bestimmte Werbung, in der sich edle Rassekatzen in britischem Akzent darüber unterhalten, in welchen Klub sie gehen wollen. Sie macht die Katzen gern nach und freut sich, dass ihre Freunde auch noch anderen Klubs angehören, sodass sie eine breite Auswahl an Aktivitäten und Treffpunkten haben.
Als gefeierter Beautystar trägt meine Mutter auch im Alter von 75 Jahren nur das Beste. Obwohl ich mittlerweile vierzig Jahre alt bin, gibt sie mir jeden Tag eine ausführliche Stilberatung: »Deine Haare sind zu lang ... Kriegst du einen Schnurrbart? Du siehst so hart aus, kannst du dich nicht ein bisschen femininer anziehen? Probier mal dieses Kleid an!«
Jeden rationalen Einwand schmettert sie ab: »Aber Mama, das Kleid ist für jemanden geschnitten, der einen Busen hat; ich hab nur Tittchen.«
»Na, dann hol dir halt einen BH mit Polstern.«
Okay, nun sehe ich fast aus wie eine Drag Queen.
Einerseits will meine Mutter, dass ich die traditionelle männliche Rolle in ihrem Leben übernehme. Deshalb wurde ich schon als Kind darauf trainiert, ihr die Türen aufzuhalten, damit sie anmutig in den Raum schreiten konnte und ihre Ankunft von der ihr gebührenden Aufmerksamkeit begleitet wurde, die sie mit einem majestätischen Nicken zur Kenntnis nahm. Heute soll ich das Geld für sie und ihre Enkel verdienen, sie zum High tea ausführen und der Familie rund um die Uhr als Chauffeur zur Verfügung stehen. Andererseits soll ich dabei genauso wirken wie sie selbst in ihren früheren Jahren: zart, elegant, anbetungswürdig und dazu bestimmt, auf Händen getragen zu werden. Sie hat mich mit ihren Genen gesegnet; selbst das Muttermal auf meinem Po hat die gleiche Form, Größe und die exakt gleiche Position wie ihres. Natürlich soll ich reich heiraten – und vielleicht, so wie sie, nicht nur einmal.
Doch in Chicago passiert es – leider häufiger als an irgendeinem anderen Ort –, dass ich sogar bei Tageslicht für einen Mann gehalten werde. Ich bin 1,83 Meter groß, habe Haare, die bis zur Taille gehen, und eine sehr tiefe Stimme. Taxifahrer sagen gewöhnlich beim Aussteigen zu mir: »Thank you, Sir, have a nice day.«
Einmal laufe ich die Straße entlang, als zwei Männer an mir vorbeigehen. Einer fragt den anderen verwirrt: »War das gerade ein Mann oder eine Frau?«, ohne dass meine Stimme überhaupt die Gelegenheit hatte, sie zu verwirren. Ich sehe solche Vorfälle jedoch im Allgemeinen positiv und freue mich, dass die Menschen hier so selbstverständlich mit Transsexuellen und Transvestiten umgehen.
Aber an einem anderen Tag schlendere ich durch Downtown, als plötzlich ein Mann in meine Richtung spuckt: »Schwuchtel!« Geschockt drehe ich mich um und frage: »Wie bitte?« Mein Instinkt rät mir, locker zu bleiben und seine körperliche Überlegenheit zu respektieren. Also hebe ich die Hände und sage: »Peace.«
Ich denke, eine schlimmere Situation könne mir wegen meines Aussehens nicht passieren, bis ich eines Abends in meiner langjährigen Stammkneipe Rainbo in der Schlange vor dem Frauenklo warte und sich eine Frau an mir vorbeidrängeln will. Auf meinen Protest entgegnet sie: »Ey, du bist doch ein Kerl!«
Ich verneine höflich, aber sie bleibt hartnäckig und fängt an, mich körperlich zu bedrängen, um mir den unbefugten Eintritt zur Damentoilette zu verweigern. Auch als ich sie abwehre, bleibt sie penetrant und versucht, mich zum Armdrücken herauszufordern. Da reicht es mir und ich stoße sie gegen die Wand. »Aus dem Weg, du Schlampe!«
Auf dem Klo angekommen, kann ich vor lauter Adrenalin im Blut kaum mehr pinkeln. Ich flüchte aus den sanitären Anlagen, renne zum Barkeeper und schreie hysterisch: »Ich wurde gerade auf dem Damenklo beinahe zusammengeschlagen! Wie kann es sein, dass es hier überhaupt Gay Bashing1 gibt!?«
Zum Glück kann mich ein Kumpel rechtzeitig an einen anderen Ort bringen, bevor ich richtig ausraste. Seltsamerweise häufen sich solche Situationen, seit ich die Stylingtipps meiner Mutter befolge.
Es wird Frühling und ich brauche einen Job. Ich verabrede mich mit ehemaligen Chefs und Kollegen, zu unseren Treffen in einschlägigen Galerien oder Bistros erscheine ich in edlen Mix-and-Match-Outfits2. Nach 16 Jahren in der Berliner Kunstwelt sind mir die Jobangebote und Umgangsformen in Chicago immer mehr zuwider. Trotzdem sage ich mir, ich werde die Sache durchziehen. Natürlich will ich weiter mit Kunst zu tun haben. Ich glaube an meine Kontakte in der Stadt, in der ich mein Kunstdiplom erhielt, aber vor allem glaube ich an meinen super Lebenslauf, über den die Entscheidungsträger der kulturellen Organisationen auch beeindruckt staunen. Ich versuche, selbstbewusst und gepflegt zu wirken »und bloß nicht zu viel Make-up« zu verwenden. An Ratschlägen von kreativ tätigen Mitgliedern meiner Familie in Bezug auf mein Erscheinungsbild mangelt es nicht: Es gilt, mein Outfit bis ins letzte Detail abzustimmen und das richtige Maß zwischen Businessfrau und Kulturschaffender zu treffen. Meine innovative, künstlerische Grundhaltung soll auf den ersten Blick deutlich werden, aber ich darf keinesfalls mit einem oberflächlichen Hipster verwechselt werden.
In dieser Aufmachung betrete ich mit zunehmender Routine die Büros und bekomme meinen ersten Job als freie Mitarbeiterin in einem Förderverein für Lyrik:
»Guten Tag, Frau Miniboss« – sie arbeitet unter einem Maxiboss – »so ein schönes Büro, und die Lage erst – unvergleichlich!«
Nach neunzig Minuten Unterhaltung schenkt mir Miniboss einen Pappschuber mit einer Jahresausgabe ihres wöchentlich erscheinenden Lyrikmagazins. Jedes Heft präsentiert einen anderen Lyriker, jedes einzelne signiert. Auf den Schuber ist ein Phoenix-Logo geprägt; Miniboss meint warmherzig zu mir: »Wer diese Sonderausgabe bekommt, ist im Klub.« Sie reicht mir die Hand, wir schlagen ein. »Ich bin sehr gespannt auf Ihre Ideen.«
Ich fühle mich unschlagbar, denn mir ist bewusst, dass dieser Lyrikverein von einem der größten und vermögendsten Kulturzentren gesponsert wird. Meine Aufgabe in den nächsten Monaten besteht darin, ein Netzwerk für internationale Zusammenarbeit zwischen Dichtern und Musikern aufzubauen. Ich arbeite bei meiner Mutter zu Hause im Zimmer meiner 19-jährigen Nichte, die das Semester über auf dem Campus wohnt. Ausgestattet mit Laptop und Telefon sitze ich dort auf dem Schlafsofa und freue mich über das positive Feedback der Künstler auf meine Projektvorschläge. Sogar der Einstürzende-Neubauten-Frontmann Blixa Bargeld ist begeistert. Ich hatte gar keine Ahnung, wie freundlich der ist.
Auf der Suche nach Ideen für meine neue Karriere schalte ich nach 26 Jahren Pause den Fernseher wieder an und lasse ihn im Hintergrund laufen. Als Kind habe ich viel Fernsehen geglotzt, doch als ich mit 14 ins Internat musste, war Schluss damit. Meine Erinnerungen an amerikanisches Fernsehen stammen noch aus Shows, die die Moral der Fünfzigerjahre verbreiteten: I Love Lucy, The Brady Bunch und Hee Haw. Jeden Samstag um 22 Uhr gab es Creature Features, eine Serie über Sumpfmonster, Vampire, Mumien und Werwölfe, von denen ich regelmäßig träumte – ich glaube, deswegen stehe ich bis heute auf Männer mit Monobraue. Nichts, was im Fernsehen lief, war bedrohlich. Wenn ich sonntags aufwachte, lief Soul Train, eine Musik- und Tanzshow, die ich gern nachmachte. Auch die Werbung war harmlos – suspekt war höchstens ein Spot, in dem eine russischstämmige Dragqueen namens Rula Lenska versuchte, uns Shampoo zu verkaufen.
Jetzt laufen morgens meistens Talkshows, in denen es um Pädophilie oder Gewalt geht oder Frauen versuchen, die leiblichen Väter ihrer Kinder zu finden. Ein mutmaßlicher Vater steht auf der Bühne und wird von einer Frau auf einem Sofa angeschrien, die ungefähr 160 Kilo wiegt. Es gibt Bodyguards und ein Livepublikum. Der Angeklagte verneint alle Vorwürfe mit Gangsta-Fresse und Gangsta-Gesten und brüllt in bester Gangsta-Manier zurück: »Du Nutte! Du Nutte! Ich bin nicht dein Babydaddy! Du weißt nicht, wer dein Babydaddy ist!«
Die Spannung steigt, alle warten auf das Testergebnis. Der Moderator steht ruhig mit dem geschlossenen Umschlag da. Ein kleiner Säugling, der im Backstagebereich liegt, wird auf einer großen Leinwand gezeigt; sofort seufzt das Publikum: »Awww!«
Die Mutter schreit weiter: »Guck ihn dir doch an, er hat dein Kinn und deine Ohrläppchen!«
Der Moderator bittet um Ruhe. Mit betonter Langsamkeit öffnet er den Umschlag und sagt: »Gleich nach der Werbung werden wir erfahren, ob Sam der Vater dieses süßen kleinen Babys ist.«
Nach der Pause erfahren wir dann, dass der betreffende Mann nicht der Vater des Kindes, sondern der Zuhälter der Dame ist. Die Frau heult, schlägt um sich und rennt backstage in den Ruheraum, gefolgt von der Kamera. Der Nicht-Vater läuft mit erhobenen Armen auf der Bühne hin und her und posiert wie ein Boxer nach dem Sieg. Der Moderator versucht, die Mutter mit dem Versprechen zu beruhigen, dass sie gemeinsam mit ihrem Arbeitgeber weiter unter ihren Klienten nach dem Vater suchen werden, der dann den Unterhalt zahlen muss. Die Kindsmutter liegt jetzt in Tränen der Dankbarkeit aufgelöst bei dem Moderator auf dem Schoß, während dieser fröhlich in die Kamera winkt und sich vom Publikum verabschiedet. So verläuft ein ganz normaler Tag in der Maury Show.
Nachmittags gibt es nur öde Seifenopern. Doch um 16 Uhr gibt es einen Lichtblick, dann kommt Dr. Phil. Dr. Phil ist Oprah Winfreys Psychologe. Er konnte ihr auf so erfolgreiche Weise helfen, dass sie eine eigene TV-Show für ihn erfand. Heute hat Dr. Phil ein besonderes Thema für uns: die Sexsklavenindustrie. Während ich weiter an meinen E-Mails schraube, warnt er die Zuschauer, dass die nächsten Bilder erschütternd sein könnten. Man sieht Archivfotos von zwei jungen blonden Mädchen, die auf einer Familienreise durch die Dritte Welt gekidnappt und auf eine tropische Insel verschleppt wurden. Dr. Phil erzählt von der üblichen Grausamkeit der Sexindustrie, während die Bilder der Tatorte auf dem Bildschirm vorbeiziehen: Häuser mit Schutzwällen aus Beton, auf denen Glasscherben kleben. Danach folgt die Geschichte einer Frau, die schon im Alter von vier Jahren entführt und über Jahre hinweg sexuell missbraucht wurde, bis sie 22 wurde. »In diesem Alter sind die Frauen bereits zu alt, um für die Kundschaft noch von Interesse zu sein«, informiert uns Dr. Phil. Im nächsten Bild sieht man die junge Frau nackt auf ihrem Bauch liegen. Ihr letzter »Kunde« hatte sie von hinten penetriert, währenddessen wurde ein langer Nagel langsam in ihren Hinterkopf gehämmert. Dr. Phil erklärt uns den Grund für dieses Verfahren: Ein sterbender Körper verkrampft und verhärtet sich. Ich schalte den Fernseher sofort aus und mache ihn das nächste halbe Jahr nicht mehr an.
Als der Frühling zum Sommer wird, muss meine Mutter wegen einer Gebärmutterentfernung ins Krankenhaus. Zu Hause zieht meine älteste Nichte Lucy wieder ein; ihre Uni hat Sommerpause. Sie ist 19, ihre jüngere Schwester Alice 13. Ich kümmere mich um uns alle. Als meine Mutter wieder aus dem Krankenhaus entlassen wird, gibt es nicht mehr genügend Schlafplätze. Eine Woche teile ich das Ehebett mit ihr. Unsere Füße berühren sich beim Umdrehen und beim Aufwachen schaut sie mir selig direkt ins Gesicht. Als ich es nicht mehr aushalte, ziehe ich aufs Sofa ins Wohnzimmer, wo ich mich von jeglicher Art von Privatsphäre verabschieden kann. Ich versuche meiner Familie zu erklären, dass ich, sobald ich Kopfhörer auf den Ohren habe, nicht mehr ansprechbar bin. Leider funktioniert das nicht. In einem Artikel über den Schauspieler Larry Hagman hatte ich mal gelesen, dass es in seinem Familienleben immer einen Wochentag gab, an dem nicht gesprochen wurde und jeder seine Ruhe hatte. Das Konzept würde ich gern auch bei uns umsetzen, aber in meiner Familie bekomme ich nicht mal eine Stunde am Tag.
Meine Mutter erholt sich gut von ihrer Operation, bald bewegt sie sich schon wieder durch die gesamte Wohnung. Wenn ich morgens auf dem Sofa aufwache, ist sie schon mit leichter Hausarbeit beschäftigt. Da es für die Jahreszeit besonders heiß ist, läuft sie gewöhnlich nackt bis auf ihre medizinische Netzunterwäsche herum. Eines Morgens wache ich auf, als sie sich gerade über mich beugt, und mein erster Blick fällt auf die gesammelten Begleiterscheinungen ihrer Operation.
Durch solche Situationen verliere ich diesen Sommer zum allerersten Mal im Leben komplett meinen Humor. Als eine Art Gegentherapie fange ich an, mir DVDs mit Komödien zu bestellen. Schon nach kurzem Studium wird mir klar, dass die Komödie eigentlich die höchste Form der Kunst ist. Mit Kopfhörern auf den Ohren spiele ich die DVDs wieder und wieder ab, bis ich die Filme schließlich Wort für Wort mitsprechen kann, was meine Familie leicht verunsichert. Währenddessen denke ich weiter über die Zusammenarbeit von Dichtern und Musikern nach.
Dabei gibt es in diesen Wochen viel zu erledigen. Nach dem plötzlichen Tod des vierten Ehemanns meiner Mutter ist der regelmäßige Geldstrom in unserer Familie versiegt und die Eigentumswohnung muss verkauft werden. Mutter ermahnt uns jeden Tag, sparsamer zu leben. Als Vorbild stellt sie sich in die Küche und bügelt vier Blusen, die sie früher in die Reinigung gebracht hätte. Stolz verkündet sie, dass sie gerade zwanzig Dollar gespart habe. Dann macht sie sich zurecht und geht zu Neiman Marcus, um sich für ihre Sparsamkeit zu belohnen.
Die Wohnung ist überfüllt mit Dingen, von denen sich meine Mutter nicht trennen kann. Und nicht nur die Wohnung, sondern auch mehrere Lagerräume. Wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, sehe ich mich jeden Frühling Mutters Klamotten hin- und herschleppen, um Platz für den in der jeweiligen Saison benötigten Teil ihrer Kleidersammlung zu schaffen. Ihr Kleiderschrank besteht aus mehreren Einbauschränken, die zusammen ungefähr vierzig Quadratmeter Fläche ergeben; die Regale gehen bis zur Decke und die Kleiderstangen sind in zwei Reihen angebracht. Wie es das Schicksal will, bin ich wieder mal hier für die saisonale Umräumaktion. Mutter darf nach ihrer Operation noch nichts tragen. Ich frage sie, was noch ausgelagert werden soll und wieso die Kartons nicht beschriftet sind.
»Was ist überhaupt in diesem Karton?«
»Keine Ahnung.«
Ich mache den Karton auf und werde hysterisch: Er ist voll mit Schulterpolstern!
»Wie kannst du mich wegen Schulterpolstern ins Lager schicken?«
»Die Teile kommen immer wieder in Mode und ich bestehe darauf. Keine weitere Diskussion!«, schreit meine Mutter in sehr bestimmtem Ton zurück.
Der Gedanke, Schulterpolster für dermaßen wichtig im Leben zu halten, macht mich fast wahnsinnig. Am liebsten würde ich sie sofort in den Mülleimer schmeißen. Doch dann erfasst mich ein wohliges Gefühl der Zuversicht. Ich schaue die kleinen weichen Dinger an und denke: Die werden mein kuscheliges Erbe sein, die werden mich in der Zukunft trösten. Die Polster gehören mir und keiner darf sie vernichten.
Ich stelle mir vor, wie ich nach Mutters Tod eine große Ausstellung mit Mobiles aus in Bronze getauchten Schulterpolstern im Stil von Alexander Calder mache.
Die Polster sind ihre Flügel und sie steigt wie ein Phoenix aus der Asche.