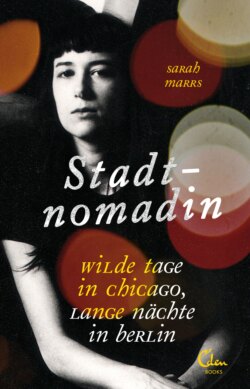Читать книгу Stadtnomadin - Sarah Marrs - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Bitterfeld 1992: Kunst. Was soll das?
Оглавление/Weiß Miniboss überhaupt, wen sie gerade erst vor die Tür gesetzt hat? Ich war schon mal in Bitterfeld. 1992 wurde dort der November-klub,9 die aktuellste Berliner Kunst-Band dieser Zeit, für einen Auftritt bei einer Kunstkonferenz engagiert. Kunst. Was soll das? ... und Bitterfeld, der Name sagt alles. Ich dachte, die Stadt hätte früher Flachspüler produziert, aber meine Ostkollegen korrigierten mich schnell: Jetzt weiß ich, dass Bitterfeld ein wichtiger Standort der Chemie-industrie war.
Es war die längste Zeitspanne, die wir als Band je vom Soundcheck bis zum Auftritt überbrücken mussten, und das in einer Stadt, die nach der Wende wie eine Geisterstadt wirkte. Wir würden ungefähr 36 Stunden auf einer Veranstaltung verbringen, auf der sich prominente Künstler, Herausgeber und Wissenschaftler aus Ost- und Westdeutschland trafen. Sie alle waren zusammengekommen, um »gemeinsam mit in Grund-fragen konsensfähigen Zeitgenossen Probleme der gegenwärtigen Kunst- und Kulturprozesse zu diskutieren«.10 Als Kunst-Musik-Band sollten wir das lange, mit Podiumsgesprächen gefüllte Wochenende auflockern und eine partytaugliche, aber dennoch niveauvolle Atmosphäre schaffen.
Die lang anhaltende Hitzewelle dieses Sommers war gerade auf ihrem Höhepunkt und ihr Ende noch nicht abzusehen. Ein bisschen hungrig, sehr durstig und entsetzlich schwitzend schleppten wir uns durch Bitterfeld; eine Stadt, in der es kein Restaurant gab, das geöffnet hatte, und falls doch, wollte man uns nicht hereinlassen. Als wir endlich eine Gaststätte fanden, in der bereits ein, zwei Leute bedient wurden, wurde uns der Eintritt mit dem Hinweis »Heute geschlossene Gesellschaft« verwehrt. Im nächsten Restaurant nahmen die anwesenden sechs Gäste an einer »Privatfeier« teil. Obwohl wir mehrmals hintereinander zum Gehen aufgefordert wurden, blieb ich stur und nahm diesmal einfach trotzdem Platz. Mit viel Mühe schafften wir es, dass uns schließlich ein trockener Toast Hawaii serviert wurde. Wir wurden allerdings grob beschimpft, als wir es wagten, um etwas »Soße« (Bitterfelderisch für Ketchup) zu bitten, um die Spezialität des Hauses wenigstens ein bisschen anzufeuchten. Also bestellten wir stattdessen ein paar Runden der offerierten Alkoholika dazu; der Toast konnte nun endlich rutschen und die Bedienung sollte doch ordentlich an uns verdienen, nachdem sie die Mühe auf sich genommen hatte, uns dieses Menü zu servieren.
Die Sonne schien immer stärker auf unsere schwarzen Klamotten und die Hitze wirkte sich ungünstig auf unseren physischen und psychischen Zustand aus. Wir schliefen auf dem Boden einer Jugendherberge; auf dünnen, mit Blümchen gemusterten Schaumstoffmatratzen, umringt von Kinderbüchern und kleinen Stofftierchen. Aus Mangel an Alternativen kehrten wir tagsüber wieder zum Veranstaltungsort zurück. Von der Vorderfront des grauen Kulturpalastes hing ein riesiges Banner herab, auf dem eine halb gepellte Banane auf schwarz-rot-goldenem Grund zu sehen war. Anstelle einer Banane ragte allerdings eine Wurst aus der Schale heraus. Optisch betrachtet fand ich das richtig ekelhaft und gar nicht witzig. Aber vielleicht war das einfach heilsamer Ost-West-Humor, nach dem Motto: »Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört.«
Im Backstagebereich des Veranstaltungsraums gab es immerhin kostenlose Getränke. Als wir von kühlem Bier, Weiß- und Rotwein und vielleicht auch noch einem Schnäpschen genügend erfrischt sowie mental wieder ausgeglichen waren, nahmen wir vom Rand aus als Zuhörer an der großen Veranstaltung teil. Penck war schon leicht am Abbauen, aber er beteiligte sich trotzdem auf dem Podium an der Diskussion. Ich döste entspannt vor mich hin und versuchte, seinen Worten zu folgen. Penck fand es absurd, dass sich alle abfällig über Funk und Fernsehen äußerten, und dann brachte er die Sache kurz und bündig auf den Punkt:
»Dazu möchte ich kurz bemerken, dass der Denver-Clan meiner Meinung nach weiter entwickelt ist als Maxim Gorkis ›Mutter‹. Man muß das richtig ins Auge fassen. Man muß solche Sachen unbedingt sehen. Daran ist ja die ganze Sache gescheitert. Das heißt, die Philosophie des amerikanischen Kleinbürgers ist weiter entwickelt als Stalins Theorien. Das muß man sehen. Stalin hat in seiner Freizeit hauptsächlich Hollywood-Filme angesehen. Und ich weiß, warum. Das ist mein Beitrag.«
Anschließend erklärte Hartwig Ebersbach, er sei Maler und kein Redner und dass er eigentlich eine Schweigeminute für die Kunst haben wolle. Sofort darauf begann er, einen Text zu proklamieren. Mit den Worten »Ich und Nicht-ich – ohnehin mein Konflikt« inspirierte er uns dazu, backstage noch ein paar Getränke zu holen. Obwohl wir dort noch einen Wein tranken, war er immer noch am Reden, als wir mit ein paar Bierchen unterm Arm zurückkehrten. Die Reden flossen träge vorbei und ich beschloss, mich ein wenig hinter der Bühne umzuschauen, um vor unserem Auftritt nicht einzunicken. In den hinteren Räumen war es auch nicht wirklich spannend. Nachdem ich etwas lustlos die Requisiten durchstöbert hatte, schnappte ich mir noch ein paar Getränke und kehrte wieder in den Saal zurück. Dort stellte sich gerade jemand vor:
»Mein Name ist René Holbein. Ich komme aus Berlin und habe keine Konzepte, bin relativ jung und möchte aber trotzdem ganz kurz meinen Eindruck schildern, den ich von dieser Veranstaltung habe. Ich werde auch morgen noch daran teilnehmen, aber ich muß sagen, es ist bedrückend, weil das Podium doch nach meiner Meinung einen sehr schlappen Eindruck macht. Es tut mir leid. Sie haben alle Ihre Konzepte und machen trotzdem einen bedrückend niedergeschlagenen Eindruck.«
Dieser Beitrag schien Penck zu erfrischen, er zuckte im Halbschlaf zusammen, hob ruckartig seinen Kopf und antwortete dem jungen Mann:
»Wir wissen ja über alles ziemlich gut Bescheid. Es ist ja nicht so, dass wir nichts wissen. Aber wir freuen uns auch über Darstellungen, die sozusagen unverdorben sind und frisch vom Faß kommen. Das ist doch auch gut.«
Er lächelte kurz vor sich hin und legte dann den Kopf wieder auf seine Arme, die gemütlich auf dem Tisch lagen.
Wir verschwanden wieder hinter dem Vorhang. Diesmal blieben wir etwas länger und betrachteten noch einmal die Requisiten, mit denen wir gelangweilt herumspielten. Nach ein, zwei Bierchen ging es wieder zurück. Im Saal war es unerträglich heiß und stickig geworden. Obwohl alle Fenster weit geöffnet waren, stand die warme, staubige Luft im Raum. Nicht nur wir, sondern auch die Künstler und Kunstexperten hatten Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, und bauten zunehmend ab. Der nächste Redner, Ulf Erdmann Ziegler, machte es jedoch wieder spannend, indem er Feststellungen über die Veranstaltung machte, die sich mit unseren Erfahrungen deckten und zugleich auch an die Möglichkeiten der deutsch-deutschen Verständigung erinnerten:
»Ich glaube, ich beginne den Charakter dieser Veranstaltung zu verstehen, im Vergleich zur ›documenta‹, wo die Künstler immer drinnen sind und draußen im Flur ist Klaus Staeck. Und hier ist draußen im Flur der Galrev-Verlag und drinnen ist Klaus Staeck. Und Klaus Staeck hat hier so seine Leute versammelt. An seiner Aufrichtigkeit zweifle ich am wenigsten. Aber dieser Charakter von Langeweile hat seinen Grund. Ich fühle mich fatal an den Verwandtenbesuch im Osten erinnert, natürlich vom Westen her. Ich weiß, es ist schrecklich. Und dann saßen wir da, als westdeutsche Linke – so mit 13 Jahren – und haben gesagt: Ja, bei uns ist es auch ganz schrecklich. Bei uns gibt es ganz viele Arbeitslose und so. Und ihr habt wenigstens eine Betriebsverfassung. Wir vielleicht auch. Und das gemeinsame Klagen hat immer unheimlich gut funktioniert, das hat uns so richtig zusammengebracht. Man hat unheimlich viel getrunken, das fehlt ja hier.«
Die Zeit floss zäh dahin. Wir beschlossen, schon einmal zum Backstagebereich zu gehen, um uns auf unseren Auftritt einzustimmen und um noch etwas kühles Bier zu suchen. Dabei stießen wir unverhofft auf eine tolle Sammlung Ost-Kram: Plakate, Klamotten, Requisiten und sogar noch ein paar Putzfrauenkleider. In einer Ecke saß eine alte Plastikpuppe, der ein Bein fehlte. Wir fanden es jedoch später in der Nähe der Puppe. Mario befestigte das Puppenbein an seinem Hosenstall. Wir schnappten uns jeweils ein Bier und zurück ging es zur Podiumsdiskussion, die ganz gut in Gang gekommen war.
»Der Meta-Künstler ist vor allem ein Künstler ohne Werk, denn die Kunst wird auf der (abstrakten) Meta-Ebene verhandelt, als Performance-Kunst-Theorie zum Beispiel. Ob diese Kunst nun von Bilderfolgen, Interferenzen oder Installationen handelt, für sich genommen sind Bilderfolgen, Interferenzen oder Installationen nur abstraktionsfähiges Material für eine Kunst, die unter anderem in Haltung und Handlung des Künstlers ihre Gestalt hat.«11
Während des Podiumsgesprächs spazierte Mario an den Tischen der Diskussionsteilnehmer vorbei, wie ein verlorener Junge, der vergessen hat, seinen Schwanz nach dem Pinkeln wieder einzustecken. Endlich gab es etwas, worüber man sich während der ewig dauernden Gespräche amüsieren konnte. Penck war endlich aus seinem Schlummer aufgewacht und schlug sich vor Lachen das Knie an. Gut, dass er wach war, denn nun war es Zeit für unseren Auftritt. Wieder backstage angekommen, legte Mario das Puppenbein kurz beiseite, um sich fertig zu machen. Ich sah, dass das Bein ein kleines Loch hatte, und füllte es mit Bier. 36 Stunden waren nun um. Ich stieg in meinen pinkfarbenen, mit erigierten Penissen verzierten Rock und erweiterte mein Outfit noch mit einigen Accessoires aus dem Putzfrauenspind, Mario befestigte das Bein wieder an seiner Jeans und der Novemberklub trat ins Rampenlicht.
Als Mario sich nach seiner Gitarre bückte, pinkelte er auf die Bühne. In wehender Kittelschürze eilte ich zu meinem Platz, gab Ronald, dem Schlagzeuger, mit dem ersten Takt das Zeichen zum Start und stellte dann mitten im Vollrausch fest, dass ich mit Gummihandschuhen gar nicht Gitarre spielen konnte. Mit meiner unkoordinierten Motorik bekam ich die Handschuhe nicht so leicht von den Fingern und hampelte für eine Weile wirr auf der Bühne herum. Schließlich waren meine Hände wieder frei und mit gelassenem Blick griff ich in die Saiten. Brad blies das Saxofon schrill und wild, dann trat unser Frontmann Bert Papenfuß an das Mikrofon. Als er mit seinem Text die giermann-produkte-verbrennung begann, knisterte einer der Verstärker verdächtig und fing einige Minuten später an zu rauchen. Penck hatte endlich über die Treppe hinauf zur Bühne gefunden, wo er sich direkt vor unsere Monitore legte, um ein Nickerchen zu machen. Bernd spielte weiter den Bass und rockte mit uns zusammen auf der Bühne, allerdings musste er zwischendurch immer wieder auf den mittlerweile stark qualmenden Verstärker einpusten. Mit einem Viertel meiner übrig gebliebenen Birne spielte ich weiter, nur noch fähig, Krach zu produzieren. Im Dunst sah ich, dass Mario seine E-Gitarre auf Pencks Bauch abgelegt hatte, der müde danach griff, sich mit dem Instrument in der Hand träge zur Seite rollte und sich wieder erhob.
Die Show ging weiter. Ich hatte mich mittlerweile ganz gut an die Gitarre gewöhnt, mein Hirn war ausgeschaltet, meine Augen geschlossen und all meine Sinne auf die Töne konzentriert, die ich erzeugte. Nach etwa 15 bis zwanzig Minuten kam ich wieder zu mir. Ich schaute mich um und merkte verblüfft, dass die gesamte Band von der Bühne verschwunden war; nur Penck und ich spielten noch unsere Gitarren, jeder für sich, aber erstaunlich synchron. Vor uns waren das Publikum und der schlafende Mario, der nun auf Pencks Plätzchen lag. Ich kann nicht erklären, warum dieser Fleck auf der Bühne solch eine magnetische Anziehungskraft ausübte, aber irgendwann wachte auch ich genau dort auf, nachdem die Show schon lange vorbei zu sein schien. Schnell rannte ich zum Wurst-ohne-Bananen-Büfett und stopfte Steidl einige Scheiben ins Hemd, da ich wusste, dass er wegen seines Ernährungsprogramms nichts davon in den Mund nehmen durfte. Er strahlte uns dankbar an – das sei der professionellste besoffene Auftritt gewesen, den er je gesehen hätte. Wenig später verabschiedeten wir uns von den versammelten Künstlern und Denkern, wünschten ihnen weiterhin viel Vergnügen bei der Debatte und einen erfolgreichen Abschluss der Veranstaltung. Zurück in der Jugendherberge feierten wir weiter und veranstalteten ein kleines Fotoshooting. Unsere Outfits bestanden aus T-Shirts und Unterwäsche, in die wir die kleinen Stofftiere gestopft hatten. Ich glaube, der Bassist hat die Bilder heute noch.