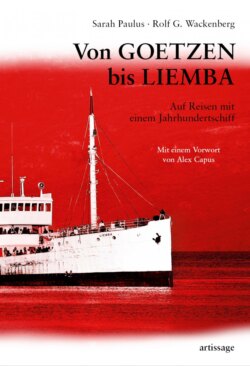Читать книгу Von GOETZEN bis LIEMBA - Sarah Paulus - Страница 11
ОглавлениеKapitel 4 | KALA
Der schwarze Fleck
»Auf dem See soll es Piraten geben«, sinniert Frank. Der Franzose reist mit seiner Freundin Audrey durch Afrika. Seit beide an Bord gekommen sind, hat sich die Liemba keinen Meter bewegt. Es ist 23.30 Uhr. Noch immer liegen wir im Hafen von Kasanga, schleppen Hafenarbeiter schier unermüdlich Sack um Sack, schwenkt der Schiffskran hin und her. Aus geplanten fünf Stunden Liegezeit wurden mittlerweile neun.
Audrey stört das überhaupt nicht, sie zeichnet unentwegt. Mannschaft und Passagiere, alles und jeden, der ins Blickfeld der aufmerksamen Beobachterin gerät. Schnell hat ihr dickes Buch die verschiedensten Situationen an Bord gespeichert, meist schwarz-weiße Skizzen in einem comicartigen, zugleich liebevollen Stil. Sie ist von Neugierigen umlagert, die dem Entstehen ihrer Kunst minutiös folgen und dabei ungestüm die von der Zeichnerin benötigte Bewegungsfreiheit einschränken. Während einige der Schaulustigen nach kurzer Zeit ein Porträt erfragen und Audrey anfangen muss, Termine zu vergeben, wissen andere den inneren Zwiespalt zwischen Faszination und Angst nicht zu lösen. Wie Generationen vor ihnen glauben sie noch immer daran, der Seele beraubt zu werden, sobald ihre Abbilder auf dem Papier erscheinen. Magie noire. Modernes Networking obendrein. Das Schiff hat noch nicht einmal abgelegt und Picture Girl ist in aller Munde, mit Porträtierten und Zuschauern auf ganz persönliche Weise verbunden.
Der arme Frank ist derweil komplett abgemeldet und muss sich mit uns unterhalten. Wir freuen uns über die höchst interessante Abwechslung. Frank hat einige Berufsjahre in der Zentralafrikanischen Republik verbracht, ist ganz offensichtlich afrikaerfahren. Wir stehen auf dem Promenadendeck, abseits der Kunst, und diskutieren angeregt über die große weite Weltpolitik. Frank entpuppt sich schnell als guter Zuhörer, als gewinnend eloquenter und aufmerksamer Gesprächspartner. Seine Sicht auf die Welt ist einnehmend und lässt dem Gegenüber gleichzeitig genügend Freiraum für eigene Ansätze. Nur seine Piratengeschichten machen mich nervös. So ein Quatsch, versuche ich mich zu entspannen, weil nicht sein darf, was sein könnte. »Kongolesen.« Ein Mitarbeiter der französischen Botschaft in Dar es Salaam habe ihn gewarnt, setzt Frank noch einen drauf. Die Liemba könne durchaus ein Ziel sein.
»All news out of Africa is bad«, lautet der erste Satz in Paul Theroux’ Standardwerk »Dark Star Safari«. Eine Generalverurteilung? Wohl eher nicht, der Autor hat seine Lebensweisheiten nicht am heimischen Schreibtisch gesammelt. Die Liste seiner Reisebücher und Romane ist lang. Sie erzählen seit Jahrzehnten erlebte Geschichten aus aller Herren Länder, unterschiedlichsten Ecken der Welt. In den 1960er Jahren stand der gebürtige Amerikaner mehrere Jahre im Dienst von Peace Corps und unterrichtete am Soche Hill College in Malawi, um später zur Makerere University nach Kampala, Uganda, zu wechseln. Knapp vierzig Jahre danach schildert er in »Dark Star Safari« seine Reise als Backpacker von Kairo nach Kapstadt und beschreibt deprimierende Momente beim Besuch alter Wirkungsstätten tief im schwarzen Afrika.
Seit Jahrhunderten ist die Mutter aller Kontinente eine überlebensgroße Projektionsfläche für Abenteuer, Fernweh, Mythen und Märchen. Für Angst, Korruption, Gewalt und Ignoranz. Zugleich ein Ort, den man von Ferne erträumt und der heute genauso stark wie Jahrhunderte zuvor Entdecker, Forscher und Tollkühne in seinen Bann zieht. Voll unstillbarer Sehnsucht und abgöttischer Liebe, dessen Anziehungskraft unerschöpflich strahlt, trotz Hitze, Staub und Dreck, Durchfall, Gelbfieber und sonstigen Nebenwirkungen, die von keinem Arzt oder Apotheker der Welt annähernd erschöpfend aufgezählt werden können. Wo vieles so schön fremd und anders ist. Wo so mancher seinen Glauben verloren hat. Andere ihr Herz, den Verstand, das Leben.
Wer heute nach Afrika reisen will, kann uneingeschränkt wählen. Pauschal oder individuell. Für kleine oder große Geldbeutel. Fly-in. Drive-out. Mit Rollkoffer oder als Backpacker. So unterschiedlich die internationale Weltenbummlerschaft auftreten mag, in Sachen Grundausstattung kann sie oft auf wenige gemeinsame Vielfache reduziert werden, die meist bereits von Weitem erkennbar sind. Es beginnt schon beim Outfit. Hosen, Hemden und Westen müssen dem Betrachter die Abenteuerlust des Trägers förmlich ins Gesicht schreien. Khaki, atmungsaktiv und modisch, ist gut, teuer besser. Dazu die passenden Accessoires, ohne die eine geführte Safari keinesfalls starten darf. Breite Gürtel, schwerste Outdoor-Lederstiefel und dicke Sonnenbrillen sind ein Muss, alles mit möglichst aufdringlichen Adventure-Schriftzügen veredelt. Diese Kaste von Abenteuertyp entfernt sich mit ihren Verkleidungen so weit von der Nützlichkeit, dass der Umwelt oft nichts anderes übrig bleibt, als peinlichst berührt zu Boden zu schauen. Der tiefe Blick in derart geöffnete Provinzseelen lässt auch mir ab und an den Atem stocken. »Ein großer Stuhl macht noch keinen König«, weiß man in Afrika.
Die platten Äußerlichkeiten unserer Zeit hätten in früheren Jahrhunderten unweigerlich das schnelle Aus von Expeditionen bedeutet. Abenteuer war Abenteuer, ein beinhartes Geschäft, oft genug mit Krankheiten oder Tod bezahlt. Weder gab es ordentliche Straßen noch Fahrpläne, Automobile, Busse oder Bahnen. Klimaanlagen? Fehlanzeige. Von anderen Annehmlichkeiten, die das Dasein der Forscher und Entdecker erleichtert hätten, ganz zu schweigen.
Bunte und gut sortierte Reiseführer beispielsweise, die selbst entlegenste Dörfer auflisten, um sie hernach in Rubriken wie An- & Abreise, Unterkunft, Essen & Trinken zu tranchieren. Der Reisende erfährt alles rund um Wechselstuben, Apotheken, Hotels, Krankenhäuser, Fahrpläne sowie Internetcafés nebst ausführlichen Hinweisen für allein reisende Frauen. Echte Überraschungsmomente, früher ein wesentlicher Bestandteil von Reisen, verschwinden von der Agenda. Der internationale Weltenbummler gibt sich mit Reiseführer zu erkennen, hält ihn bei jedem noch so kleinen Spaziergang in der Hand, um zeitnah den aktuellen Aufenthaltsort bestimmen zu können. Bedeutete Reisen früher vor allem Entdecken, scheint es heute nur ums Abarbeiten zu gehen. Der schönste Markt der Stadt? Gesehen. Die schönste Bucht in der Gegend? Erledigt. Entspanntes baden? Weiter. Ausgiebiges Meckern, wenn die Orte nicht den Beschreibungen entsprechen. Eine Art zu reisen, die gleich macht, ob mit oder ohne Rollkoffer. Wie beim Outfit wird lediglich in der Wahl der Marke unterschieden. Magst du Lonely Planet oder bist du Iwanowski?
Ich mag Reiseführer, am liebsten bin ich mit Reise Know-How unterwegs. Da weiß ich, was ich habe. Unmengen Informationen zu allen Fragen der Logistik unterwegs, überaus nützlich für Leute wie mich, die sich nicht pauschal, eher individuell von Punkt zu Punkt bewegen. Auch ich bin Gleiche unter Gleichen, das lässt sich nicht leugnen. Beim Outfit aber hört der Spaß auf. Markenfunktionskleidung kommt mir nicht in die Tüte, das Outfit ist nie teuer, eher abgetragen und farblos. Ich reise mit relativ kleinem Gepäck. Zwei Hemden, zwei Hosen, Socken und ein Sweatshirt für kühle Abende. Drei T-Shirts, Wechselschlüpfer und ein Afrikakleid für gut. Badelatschen und Sandalen. Medikamente für Befindlichkeiten zwischendurch. Was verschwitzt ist, wird gewaschen. Ein Mittel für alles, Duschgel gleich Waschmittel. Schmuck, Schminke und Parfümerie müssen zu Hause bleiben. Nicht auffallen ist mir bedeutend lieber, als überfallen zu werden. Zu wissen, wo ich bin und wohin es geht, ist wichtiger. Rolf hat immer einen Kompass in der Tasche, mittlerweile ein liebgewordener Begleiter, der uns auch schon mal aus den unübersichtlichsten Souks Nordafrikas herausgeführt hat.
Müsste sich die Welt allein auf den guten alten Kompass verlassen, würde sie ganz schön alt aussehen. Dank Navi, GPS und Google Maps hat die Menschheit viel verlernt. Wenn wir heutzutage unterwegs sind, sollten wir uns hin und wieder die Tatsache ins Gedächtnis rufen, dass wir auf den Spuren der frühen Wegbereiter wandeln, in den Fußstapfen der Entdecker Afrikas, die sich aller Entbehrung zum Trotz unbeirrbar durch den Busch kämpften und uns Nachkommen Reiseberichte und Landkarten hinterließen.
Die beschwerliche Entdeckung Ostafrikas wie auch anderer Gebiete des westlichen und nördlichen Kontinents begann mit der islamischen Kolonialisierung. »Schon in römischer Zeit unterhielten Königreiche der arabischen Halbinsel eine Reihe von befestigten Niederlassungen von Mogadischu bis Kilwa«, schreibt Egon Flaig in seinem Buch »Weltgeschichte der Sklaverei«. Ausschlaggebend dafür seien zwei Dinge gewesen: das halbjährliche Alternieren der Monsunrichtung zwischen Südwest und Nordost sowie die relativ kurzen Entfernungen zu den arabischen Königreichen, etwa 2700 km von Sansibar nach Aden bzw. 3500 km in den Oman. »Bezogen wurden vor allem zwei Güter: Sklaven und Elfenbein«, so Flaig. Seit dem 7. Jahrhundert sei der Indische Ozean in arabischer Hand gewesen, berichten chinesische Dokumente über den Import ostafrikanischer Sklaven. »Die Küste von Mogadischu über Mombasa bis Kilwa sowie die Inseln Pemba und Sansibar wurden regelrecht kolonisiert.« Insgesamt, so das Fazit, seien zwischen den Jahren 650 und 1920 »weit mehr subsaharische Afrikaner in die Kernländer des Islam verschleppt worden, als über den Atlantik in die europäischen Kolonien, mindestens 17 Mio. gegenüber 11 Mio.«
Im 17. Jahrhundert machten sich vor allem Portugiesen und Italiener auf den Weg nach Afrika. Sie erforschten und kartografierten Küstenlinien, errichteten Stützpunkte. Ausflüge ins Landesinnere blieben auf Nord- und Westafrika sowie deren küstennahe Bereiche beschränkt. Erst Ende des 18. Jahrhunderts wagte sich der Schotte Mungo Park über den Gambia-Fluss in Richtung Niger, dessen Mündung er finden wollte. Anfangs erfolglos, schaffte er es beim zweiten Versuch bis nach Bussa, nahe dem heutigen New Bussa im Nordwesten Nigerias, noch immer 900 km vom Mündungsdelta entfernt. Dort starb er im Februar 1806 im Alter von nur 34 Jahren.
Zehn Jahre älter wurde der deutsche Historiker und Geograf Heinrich Barth. Bereits in jungen Jahren hatte der gebürtige Hamburger ausgedehnte Reisen entlang der nordafrikanischen Mittelmeerküste unternommen und beherrschte mehrere Fremdsprachen. Auf Einladung der britischen Regierung beteiligte sich der erst 28-Jährige an einer Expedition durch die Sahara zum Tschadsee. Die Reise begann im März 1850 in Tripolis. Nach dem baldigen Tod seiner zwei Forscherkollegen wurde Barth Leiter der Expedition und entschied deren Weiterführung vom Tschadsee bis nach Timbuktu. Die Probleme Mungo Parks vor Augen, der immer wieder feindlichen Übergriffen ausgesetzt gewesen war, gab sich Barth auf der letzten Teilstrecke entlang des Niger als türkischer Muslim aus. Dass er während der Reise weitere heimische Sprachen und Dialekte gelernt hatte, erleichterte die Maskerade, die es ihm nicht zuletzt ermöglichte, sechs Monate in Timbuktu zu verweilen und unversehrt heimzukehren.
Zu den prominentesten Erforschern Ostafrikas zählen Sir Richard Francis Burton, John Hanning Speke, Dr. David Livingstone und Henry Morton Stanley. Ihre Verdienste werden in Tansania, Malawi und Sambia bis heute mit unzähligen Gedenktafeln, Museen und Ortsnamen gewürdigt. Weit weniger bekannt ist, dass zwei Deutsche, Johann Ludwig Krapf und Johannes Rebmann, von ihrer Missionsstation nahe Mombasa ausgedehnte Expeditionen ins Landesinnere unternahmen. Auf einer dieser Reisen stieß der Missionar, Sprachforscher und Geograf Rebmann im Mai 1848 bis zum Kilimandscharo vor, wenngleich er ihn nicht erreichte, sondern lediglich von Ferne sah. Seiner Schilderung, dass es drei Breitengrade südlich des Äquators Schnee geben sollte, glaubte in Europa so gut wie niemand. Kaum jemand nahm seine Hinweise auf eine ostafrikanische Seenplatte ernst.
Wenige Jahre später, im Juni 1857 startete die Expedition des Briten Richard Francis Burton. Zum Zeitpunkt seines Aufbruches war er 36 Jahre alt. Gerüstet mit Kenntnissen in mehr als einem halben Dutzend Fremdsprachen, darunter Arabisch, Persisch, Hindi und später auch Kiswahili, begab er sich gemeinsam mit John Hanning Speke, den er zuvor in Aden kennengelernt hatte, nach Ostafrika, um die großen Seen und die Quelle des Nils zu finden. Im Februar 1858 erreichten sie Ujiji am Tanganjikasee, nahe Kigoma, dem späteren Heimathafen der Liemba. Burton hielt den See für die Quelle des Nils. Speke reiste weiter und entdeckte den Victoriasee, den er wiederum als wahre Nilquelle identifiziert zu haben glaubte. Aus dem Streit um die Sache entstand eine lebenslange Feindschaft. Speke starb 1864 bei einem mysteriösen Jagdunfall. Er gilt als Begründer der Hamitentheorie, die der schwarzen Bevölkerung Afrikas jegliche Entwicklungsfähigkeit abspricht und diese lediglich den aus dem Norden stammenden hellhäutigeren Hamiten einräumt. Die Tansanier sehen das gelassen. Am südlichen Victoriasee ist noch heute eine Bucht nach Speke benannt.
Mitte des 19. Jahrhunderts erkundete der schottische Missionar David Livingstone das südöstliche Afrika. Seine dritte und letzte Expedition startete 1866 auf Sansibar. Von dort setzte er aufs Festland über und stand ein Jahr später am Südufer des Tanganjikasees, den die Einheimischen Liemba nannten, ein Name, der seit 1927 den Rumpf der ehemaligen Goetzen ziert. Livingstone erreichte das mehr als 500 km nördlich gelegene Ujiji im März 1869 und musste schwer erkrankt verweilen. In Europa galt er als vermisst.
Etwa zur gleichen Zeit hatte sich Henry Morton Stanley in New York zum Sonderkorrespondenten des New York Herald hochgearbeitet. Stanley, unehelich geboren und zunächst zum Großvater in Obhut gegeben, war anschließend in einem Arbeitshaus aufgewachsen. 1869 erhielt er von seinem Verleger den Auftrag, doch bitte Herrn Livingstone aufzuspüren. Zwei Jahre später, am 10. November 1871, fand Stanley den verschollen Geglaubten in Ujiji unter einem Mangobaum sitzend. »Dr. Livingstone, I presume.« Wahr oder erfunden, das Zusammentreffen ist legendär und die berühmten Begrüßungsworte wurden auch in Ostafrika von Generation zu Generation weitergegeben. Die Menschen verehren den berühmten Afrikareisenden vor allem wegen seines unermüdlichen Kampfes gegen die Sklaverei. Ihm zu Ehren gibt es in Ujiji ein Memorial. Die Anlage ist nicht wirklich schön, aber ambitioniert. Selbst an den Mangobaum wurde gedacht.
Livingstone starb 1873 in Chitambo am Bangweulusee im heutigen Sambia. Sein Leichnam wurde nach London überführt und in Westminster Abbey beigesetzt, sein Grab kann dort besichtigt werden. Auch in der anglikanischen Kirche, die britische Missionare nach dem Verbot des Sklavenhandels 1873 auf dem Areal des einstigen Sklavenmarktes in Stone Town auf Sansibar errichteten, finden sich Hinweise auf den Entdecker. Links neben dem Altar ist ein Holzkreuz an die Wand geschlagen. Es soll aus dem Baum geschnitten sein, unter dem Livingstone starb und unter dem sein Herz begraben sein soll. Getreu seinem Credo »Mein Herz ist in Afrika«.
Livingstone und Stanley hätten unterschiedlicher nicht sein können. Livingstone war Missionar und Philanthrop, Kämpfer gegen die Sklaverei. Stanley dagegen hasste Afrika, bereiste den Kontinent jedoch immer wieder. Zeitweilig stand er im Dienst des belgischen Königs Leopold II. und wurde »Bula Matari« genannt, »der die Steine bricht«, weil er Pisten quer durch den Busch trieb, rücksichtslos und brutal. Er starb 1904 in London, eine Beerdigung in Westminster Abbey blieb ihm verwehrt. Die Witwe schmückte seinen Grabstein mit den Worten: »Henry Morton Stanley, Bula Matari, 1841 – 1904, Africa«. Wenn das nicht Liebe ist.
Wer »Bula Matari« googelt, stößt auf Erstaunliches. Mehr als hundert Jahre später wollen vier junge Männer aus Brooklyn Steinbrecher sein und im Geiste Stanleys pogen: Joseph, Alan, Richard und Ben. »Bula Matari«, so der Name ihrer Combo, sind um Hardcore-Punk bemüht. Wohl eher gefällige Gitarrenmusik, findet Rolf, wenn man von den Texten absieht. »Put their fingers in the socket und watch them fry. Taxi drivers must die«, proklamieren sie in einem ihrer Songs. Die Jungs, in deren Entwicklung etwas schiefgelaufen sein muss, sollten zu den strengsten Eltern der Welt geschickt werden. Für solch spaßige Hardcore-Rebellen böte sich der Kongo an. Passend zu den Texten der Band, ist dort der Umgang mit Gliedmaßen nicht immer zimperlich gewesen. Warum die vier diesen Bandnamen gewählt haben, konnte ich leider nicht herausfinden. Typen, die Taxifahrer grillen wollen, beantworten keine Mails.
Das heutige Reisen in Afrika, speziell am Tanganjikasee, ist unzweifelhaft sehr viel sicherer und bequemer als in den Jahrhunderten zuvor, sofern die Reiseroute nicht gerade durch die Fronten immer wieder ausbrechender Bürgerkriege und Stammesfehden geplant wird. Dennoch ist der Kontinent ein exotisches Wesen geblieben, mit Risiken für Leib und Seele, von denen die Homepage des Auswärtigen Amtes lediglich die prominentesten benennt: Denguefieber, Bilharziose, Typhus, Hepatitis, Cholera, Malaria. Immer wieder einmal gibt es Pestausbrüche. Hinzu kommen Infektionsrisiken jeglicher Art sowie Beschwerden und Befindlichkeiten, die aus der Kombination ungewohnter klimatischer Verhältnisse, niedriger Ernährungsstandards und unerwartet hoher Reisestrapazen entstehen können. »Unvorbereitetes Wegeilen bringt unglückliche Wiederkehr«, das wusste schon Goethe.
Dementsprechend sind Impfungen, Pillen und Prophylaxen für viele Regionen nach wie vor unabdingbar. Natürlich gibt es unter den Reisenden wie immer und überall ein paar Außenseiter. Alte Hasen, die sich für immun halten. Peace Corps-Kämpfer, zum Beispiel, mit ihren oft jahrelangen Afrikaaufenthalten. Zwar sind die Entsandten anfangs scharf auf Linie und Sicherheit geeicht, doch einmal in Afrika abgesetzt, werden die guten Vorsätze schnell über Bord geworfen. Zu umständlich und wer weiß, wie der Körper die Langzeitbehandlung verträgt. Dabei sind Malaria und Cholera fraglos problematischer als Impfungen und Prophylaxen, selbst wenn die Beipackzettel von Lariam & Co. mit langen Listen von Grausamkeiten aufwarten.
Ebenfalls ins Gepäck gehört eine Portion gesunder Menschenverstand. Idealerweise in Kombination mit Gelassenheit, denn Angst ist ein schlechter Reisebegleiter. Vor dem Huhn vom Straßengrill oder aus der Kombüse der Liemba muss man sich nicht notwendigerweise fürchten, auch die Kulisse eines Vier-Sterne-Restaurants schützt in manchen Ländern nicht zwangsläufig vor mangelnder Hygiene.
Anders als früher müssen wir uns heute weder verkleiden, noch Angst haben, zu verhungern oder Pisten durch den Busch schlagen zu müssen. Letzteres übernehmen chinesische Baufirmen. Im Gegenzug gibt es Bodenschätze, beinahe geschenkt. Die Gefahr, überfallen zu werden, ist geringer, als in maroden Bussen, Bahnen oder auf greisen Schiffen zu Schaden zu kommen. Sagt man. Nach Franks Berichten bin ich mir da nicht mehr so sicher. Die Passagiere der alten Dame Liemba, eine potenzielle Beute für Piraten?
»Warum eigentlich?«, frage ich heiser.
»Reiche weiße Touristen. Entführungen. Lösegeld«, antwortet Frank und guckt wichtig.
»Wir, ihr und die anderen. Sieben auf einen Streich«, zählt Rolf.
»Ich bin nicht reich.«
»Woher sollen das bitteschön die Piraten wissen?«
»Vielleicht wollen sie ja Diamanten.«
»Wieso?«
»Es sollen Diamantenhändler an Bord sein.«
»Ach ja?«
»Nutten auch.«
Um uns herum und auf den Bänken am Heck hat sich eine Großfamilie auf engstem Raum ausgebreitet und beginnt ihr Abendmahl. Brot, Reis, Huhn und Gemüse werden aus einem halben Dutzend Plastikbüchsen auf Teller geschaufelt und in hungrige Münder gestopft. Kinderaugen glänzen gierig. Rote Sauce trieft von fettigen Händchen. Frauen in weiten Kleidern managen das Gelage und reichen Wasser in Plastikflaschen. Was nicht gebraucht wird, fällt zu Boden und verschwindet zwischen den Planken des Schiffs. Ältere Männer tragen farblose Anzüge, die Jüngeren ausgewaschene Jeans zu farbenfrohen T-Shirts aus westeuropäischen Kleidersammel-Containern. Goldfarbene Klunker hängen am Weibsvolk.
»Vielleicht sind die reich?«
»Alles unecht«, entscheidet Rolf.
Danke. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Missmutig schlürfe ich meine Brause mit neuem Lieblingsgeschmack: Fanta Pineapple. Ziemlich süß, aber unglaublich süffig. Frank hält sich an Stoney Tangawizi. Das Zeug schmeckt nach Honig, Pfeffer und einigem Unbekanntem. Kein Wunder, dass er dauernd Piratengeschichten erzählt. Audrey, die Magierin, macht eine Picture-Pause und gesellt sich zu uns. Wird sie während unserer Fahrt mit der Liemba Captain Flint oder Long John Silver zeichnen müssen? Blackbeard oder Francis Drake? Den Störtebeker Klaus? Oder wenigstens ein Abbild vom schwarzen Fleck?
Angestrengt beklopfe ich dreimal Holz und trinke mit den anderen auf eine gute Reise. Plötzlich ruckt das Schiff. Piraten? Nein. Ganz friedlich legen wir ab. Über zehn Stunden hat das Beladen in Kasanga gedauert. Wir schauen in die Nacht. Eine große Frau in bunten Puffhosen schlurft vorbei.
»Das ist Yvette«, weiß Frank Allwissend.
»Ach ja?«
»Eine Kongolesin.«