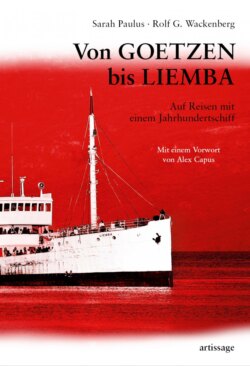Читать книгу Von GOETZEN bis LIEMBA - Sarah Paulus - Страница 8
ОглавлениеKapitel 1 | ANREISE
Christus, Cholera und Fegefeuer
»Na, das nenne ich doch mal Architektur.« Rolf winkt mich heran. Wir kommen im Haupteingang zum Stehen, staunen herum und behindern die Nachrückenden. Sicher hundert Meter breit und zwanzig hoch, so empfängt uns die farblose Bahnhofshalle in Dar es Salaam. Kein Schnickschnack, kein schmückendes Beiwerk stört den Blick. Groß, schlicht und karg, wie ein überdimensionierter Schuhkarton. Vollgestopft mit Hunderten von Menschen, die auf eine baldige Abfahrt des Zuges hoffen. Ein Ameisenhaufen inmitten chinesisch-praktischer Bauweise.
Unsacht werde ich nach vorn gestoßen, stolpere unschlüssig in den Schlund und finde an einem Geländer Halt. Von hier öffnet sich der Blick in die untere Etage mit Gängen zu den Bahnsteigen und diversen Schaltern für Tickets und großes Gepäck. Im Halbdunkel einer Nische plaudern Träger, entspannt und ohne Hektik. Staub tanzt im Licht der Sonnenstrahlen, die sich ihren Weg durch matte Fenster auf gegenüberliegende Wände erkämpfen. Weit ausladende Treppen verbinden die untere Ebene mit meiner Aussichtsplattform. Rolf unterbricht meine Gedanken und lenkt die Aufmerksamkeit in eine andere Richtung.
Dort stolziert ein Uniformierter mit strenger Miene umher. In der rechten Hand hält er einen schwarzen Stock, den er respekteinflößend umherschwenkt. Raffael Fabian Samwe steht ganz offensichtlich auf der Seite der Macht, die Einheimischen befolgen jede seiner Anweisungen. Scharenweise strömen sie weiter in den Bahnhof und lassen sich ehrfürchtig, ohne die geringste Gegenwehr, bei der Suche nach einem Sitzplatz führen. Bloß nicht aus der Reihe tanzen. Wer keinen Bahnhofstuhl findet, sucht schnell und möglichst unauffällig einen freien Flecken auf dem gekachelten Boden oder den mitgebrachten Taschen und Säcken.
Ob stehend, sitzend oder liegend, wir alle sind durch ein gemeinsames Ziel verbunden. Wir wollen Zug fahren. Vier Mal pro Woche erwacht der Bahnhof kurz und heftig zum Leben. Freitag und Dienstag, wenn ein Zug abfährt. Sonntag und Donnerstag, wenn er zurückkommt. Anderntags herrscht gähnende Leere. An diesen Tagen reihen sich nur kleine Grüppchen geduldig vor den Ticketschaltern, hinter denen Fahrscheine noch handschriftlich ausgefertigt werden.
Tanzania Zambia Railway Authority, kurz TAZARA, heißt der Betreiber der 1860 km langen Strecke nach Kapiri Mposhi in Sambia. The Great Uhuru Railway, der Zug der Freiheit, wie er einst hieß, ist eine afrikanische Idee, die in den Sechzigerjahren entstand, um den Export von sambischem Kupfererz zu erleichtern. Nachdem internationale Kapitalgeber ihre Unterstützung verweigerten, reisten die Präsidenten Tansanias und Sambias, Julius Nyerere und Kenneth Kaunda, nach China, stießen dort auf höchstes Interesse und traten die Rückreise an mit einem dreißigjährigen zinslosen Kredit in Höhe von unglaublichen 500 Mio. US-Dollar im Gepäck.
»Die Bahnlinie wurde 1976 in Betrieb genommen«, erzählt Raffael freundlich, die wartende Menge nicht aus den Augen lassend. Schnell winkt er einen Drängler zur Ordnung. Rolf nimmt stumm Haltung an und schlägt die Hacken zusammen. Raffael lächelt milde. Er hat Gefallen an Rolfs Blödsinnigkeiten gefunden und beginnt ein Gespräch, während sich seine uniformierten Mitstreiterinnen in Position bringen. Korpulente Matronen mit grimmigen Gesichtern und strammen Waden, trotz Hitze mit dicker Wolle bestrumpft.
Wir werden in ein Séparée geschoben, das für Fahrgäste der 1. Klasse vorgesehen ist, die VIP-Lounge. Nichts lenkt vom Warten ab. Wir sitzen auf festgeschraubten Stühlen mit speckigem Lederbezug und starren auf kahle Wände. Ein an die Wand geschraubter Fernseher verweigert den Dienst. Das spärliche Mobiliar einer entkernten Bar lässt Angebot und Nachfrage ganz sicher nicht zusammenkommen. Dann eben warten. Einfach nur warten.
Mit uns dösen ein paar Einheimische sowie eine Handvoll Wazungu, auf Kiswahili die Bezeichnung für Fremde oder Weiße. Ein unscheinbares Pärchen Mitte dreißig. Daneben ein hagerer Grin mit Mohawk, sonnengegerbt, Typ einsamer Wolf, der ein unerhört dickes Buch liest. Ferner zwei elegant aussehende silbergraue Damen unbestimmbaren Alters. Französinnen mit Rollkoffer, Sonnenbrille im Haar und dezentem Goldschmuck an Hals und Gelenken, die sich mit sprudelndem San Pellegrino aus einer kühlen Glasflasche verwöhnen, während wir Lauwarmes aus verbeultem Plastik nuckeln. Respekt, Franzosen haben es einfach drauf.
Eine halbe Stunde vor Abfahrt kommt Bewegung in die Masse. Die gewichtigen Matronen geben den Weg zum Bahnsteig frei. Eine Menschenmenge in bunten Kleidern und Tüchern strömt hastig in Richtung Zug. Dank Helmut Suitner, einem Österreicher, der seit zwanzig Jahren in Dar es Salaam lebt und hier bis Ende 2012 als Honorarkonsul tätig war, sind wir mit Platzkarten versorgt und trödeln der Masse gemächlich hinterher. Der Zug ist stets gut gebucht, Reservierungen müssen rechtzeitig erfolgen. Keine einfache Sache, wenn man nicht Wochen vor Abfahrt des Zuges anreisen kann und die lokalen Reisebüros an dem gewünschten Service kaum Interesse zeigen. Für Tansania können zwar aufwändigste Safari-Touren allerorten und zu jedem Preis gebucht werden, einfache Zugtickets hingegen nicht. Auch nicht über die gut sortierte Internetseite von TAZARA. Sie offeriert dem Interessierten Unmengen an Adressen, die sich jedoch als herrenlose Briefkästen erweisen. Keine meiner Mails wurde je beantwortet. Blieb das gute alte Netzwerk. Dr. Klaus Goebel, 2. Vorsitzender des Traditionsverbands ehemaliger Schutz- und Überseetruppen – Freunde der früheren deutschen Schutzgebiete e. V., half unermüdlich mit Informationen rund um die Liemba und stellte auch den Kontakt zu seinem langjährigen Bekannten Suitner her, heute Manager von Leisure & Safari Tours Ltd., der sich schließlich um unsere Platzkartenbuchung kümmerte. Ohne ihn hätten wir jetzt wohl ziemlich alt ausgesehen und mächtig um einen einigermaßen komfortablen Platz im Zug kämpfen müssen.
13.50 Uhr. Unerwartet pünktlich schrillt eine Pfeife. Die stählerne Raupe startet ihren langen Weg gen Süden. Bei TAZARA reisen Männer und Frauen getrennt. Wer dennoch gemeinsam logieren will, muss ein ganzes Abteil buchen. Vier Liegen, zwei unten, zwei oben. Dazu gibt es Kuscheldecken, Kopfkissen und Bettlaken. Toiletten am Ende der Waggons, wo sich Löcher im Boden öffnen, wenn man auf ein Stück Metall tritt. Das Gleisbett rast vorbei. In bunten Plastikbottichen schwappt Spülwasser unruhig hin und her. Willkommen in Afrika.
Die Trassenführung der Bahn, so heißt es, sei von chinesischen Fachleuten bei einem neunmonatigen Fußmarsch festgelegt worden. 30 000 Afrikaner und 16 000 Chinesen sollen an der Strecke gearbeitet haben. 300 Brücken, 25 Tunnel und 60 Stationen passiert der Zug. Meist gemächlich dahinruckelnd, während seine Insassen Bekanntschaft schließen und Reisegarn spinnen.
Rolf hat den Mohawk ins Visier genommen. »Darren«, stellt der sich mit tiefer Stimme vor und zieht kräftig an einer Selbstgedrehten, bis der Qualm sein verlebtes Äußeres vollständig umnebelt hat. Tiefe Falten durchziehen das fahle Gesicht. Er scheint seit Jahrzehnten nichts anderes zu tun, als kettenrauchend Zug zu fahren. »Ihr wollt also mit der Liemba reisen?«, fragt Darren treffsicher, als wir vom Tanganjikasee berichten. Das unscheinbare Pärchen neben uns lauscht aufmerksam. Die beiden haben noch nie von dem Schiff gehört. Sie fragen uns Löcher in den Bauch und überlegen ernsthaft, ihre ursprünglich geplante Reiseroute in Richtung Malawi über den Haufen zu werfen.
Wir starten eine Tour zum Bordrestaurant. Verwöhnt vom Dahinschweben deutscher ICEs, torkeln wir wie angetrunkene Yetis durch die schwankenden Waggons und stürzen bei jeder kleinen Kurve von einer Seite zur anderen. Ping. Pong. Nach einer Weile erreichen wir derangiert den dicht belagerten Tresen. Ping. Angeregt palavern Männer wie Frauen jeglichen Alters und trinken sich munter durchs Angebot. Pong. Standfestigkeit ist längst nicht mehr von Bedeutung. Schrill kracht Musik aus einer viel zu kleinen Box. Ping. Nur der Barkeeper hält sich wacker. Pong. Uns gelingt die Bestellung des Abendmahls: Hühnchen mit Chips und Gemüse. Lieferung ins Abteil, wenn das mal gut geht. Ping. Etwa eine Stunde später scheppert ein Rollwagen mit Zugbegleiter durch die Gänge und erreicht unfallfrei seine hungrigen Gäste. Pong.
»Die Qualität des Zuges ist eine Schande«, sinniert Kiume in gutem Englisch, während er an einem mageren Huhn kaut. Er ist Grundschullehrer in Mlimba, hochgewachsen und hager. Reist in schwarzer Hose und Jacket, ohne Gepäck. Maalik, Mitte dreißig vielleicht, bleibt zunächst schweigsam und tippt eifrig auf seinem Laptop herum. Von Anfang an habe die Linie Verluste gemacht, sagt Kiume, weil sie aufgrund fehlender Wartung oft außer Betrieb war. 1983 seien die chinesischen Experten zurückgekehrt. Seitdem fahre sie verlässlich. »Dabei gilt TAZARA als eine der gut erhaltenen Eisenbahnstrecken Afrikas«, ergänzt Maalik, als der Zug kurz vor Kisaki abrupt zum Stehen kommt und plötzlich strenger Geruch in unser Abteil zieht. Junge Männer schreien sich aufgeregt an und laufen hektisch durch die Gänge. Einige klettern auf die Gleise und funzeln mit ihren Handys durch die Nacht. Bald treibt auch Kiume die Neugier nach draußen. Er verlässt unser Abteil, um wenig später mit aufgerissenen Augen wieder hereinzuschauen. »Es brennt!«
Wo? Alle schnattern wild durcheinander, hängen gaffend an Fenstern und Türen. Der Rauch wird stärker, unklar, aus welcher Richtung. Ein Feuerlöscher wird vorbeigetragen und ins Dunkel gehievt, mitten hinein in den nächtlichen Park des Selous Game Reserve, ins Jagdrevier hungriger Raubtiere. Lichtkegel fallen auf die angespannten Gesichter der Ersthelfer. »Da läuft einer mit Gewehr!« Kiume zeigt in die Nacht und fragt einen Zugbegleiter nach Neuigkeiten. Die Bremsscheibe unseres Nachbarwaggons sei blockiert und habe während der letzten Kilometer zu glühen begonnen. Das dadurch ausgelöste Feuer sei unter Kontrolle. Nun müsse nur noch die verdammte Bremse gelöst werden.
Eine Stunde später setzen die chinesischen Waggons ihre poltrige Fahrt durch die Dunkelheit fort. Sie hängen an einer stämmigen Lok, die während der Nacht ihr zweites Gesicht zeigt. Wie irre jagt sie mit ihrer Gefolgschaft über die maroden Gleise. Als wolle sie dem Fegefeuer entkommen. Unsere schlafenden Körper hüpfen auf den Liegen auf und ab, dem Absturz gefährlich nahe. Das geht bis Uchindile so, bis zum nächsten Morgen, der sich zur Abwechslung schottisch gibt. Dicke Nebelschwaden wabern durch strauchiges Bergland. Die Luft kriecht feucht und schwer durch das nicht verschließbare Fenster ins Abteil. Es ist kalt in diesen frühen Morgenstunden. Hin und wieder ein zarter Sonnenstrahl, der durch die feuchten Nebelschwaden dringt. Die erste Nacht ist überstanden. Und als habe die zarte Sonne sie gezähmt, rumpelt die Lok wieder gemächlich durch die Kurven. Ganz die Harmlose. So als sei nichts geschehen. Wir sitzen herum. Schwatzen hier und da. Schauen gedankenversunken aus dem Fenster. Den ganzen Tag über ziehen Orte vorbei. Mkambako, Malamba, Mbeya, Mirgendwas.
In der zweiten Nacht, zur Geisterstunde, erreichen wir die tansanisch-sambische Grenzregion. Im Grenzbahnhof Nakonde kommt der Zug zum Stehen. Wir treffen erneut auf uniformierte Matronen, diesmal mit Taschenlampen, Formularen und Stempeln bewaffnet. Ihre korpulenten Körper werfen beängstigend große Schatten ins Abteil. Verschlafen blinzeln wir ihnen entgegen. Doch die Damen erweisen sich als wahre Frohnaturen und schlagen sich wiehernd auf die dicken Schenkel, als Herr Rolf zu scherzen wagt. Dreißig Minuten werden wir administrativ versorgt, dann ist der Spuk vorbei, wir können weiterschlafen. Nach insgesamt 1230 Schienenkilometern und 39 Stunden Zugfahrt erreichen wir das Etappenziel: Kasama. Es ist 5 Uhr morgens. Fünf Stunden Verspätung.
»Wir wollen weiter nach Mpulungu.« Mama blickt uns kritisch an. »Dort ist gerade die Cholera ausgebrochen«, weiß sie zu berichten. Die Entwicklungshelferin aus Kenia hört sich gern reden und logiert gemeinsam mit anderen Wohltätern im Thorn Tree Guesthouse. Wie, Cholera? Steht Mpulungu unter Quarantäne? Wird die Liemba hunderte kranke Menschen an Bord haben? Die UNICEF-Dame zuckt, ausnahmsweise einmal schweigsam, mit den Schultern. Details scheinen nicht ihr Fachgebiet zu sein. Hazel und Ewart Powell müssen ebenso passen, obwohl die Lodgebetreiber seit 1969 in Kasama leben.
Zwei Tage und weitere 200 km Busfahrt später erreichen wir Mpulungu, das Zentrum der Epidemie. »Choleraausbrüche gibt es hier immer wieder. Diesmal ist es durchaus ernst, aber sie arbeiten daran«, zerstreut Charity unsere Sorgen. Seit Jahren betreibt sie für einen indischen Eigentümer die Nkupi Lodge.
Wohlan. Es ist Dienstagnachmittag. Die Liemba soll am Freitag eintreffen. Genügend Zeit also, die einzige sambische Hafenstadt am Tanganjikasee ausreichend zu würdigen. Doch was genau tut man drei Tage lang in dieser Gegend? Drei Tage, von denen wir Globetrotter anfangs noch nicht wissen, dass es sogar vier werden. Gut, schwitzen ist ein Anfang. »Its too hot«, stöhnen selbst die Einheimischen. Mpulungu gilt als einer der heißesten Orte des Landes. Aufstehen, duschen, anziehen, essen, trinken – alles dauert doppelt so lange. Selbst schlafen. Beim ersten Blick auf die Uhr ist der halbe Tag bereits Geschichte.
Wir gehen zum Hafen. Das Areal an der Grenze zum Nachbarn Tansania ist durch einen hohen Zaun aus verbeulten Metallplatten verbarrikadiert. Wir stoßen das quietschende Tor auf und lugen vorsichtig dahinter. Eine Handvoll uniformierter Beamter sitzt an Klapptischen unter einem windschiefen Sonnenschutz. Angeregt lauscht die Gruppe der offensichtlich lustigen Geschichte des einzig zivil Gekleideten. Es ist nicht ganz klar, wer das Sagen hat. Zaghaft setzen wir einen Fuß vor den anderen und bewegen uns langsam auf die Versammlung zu.
»Good afternoon«, grüßen wir aufgesetzt lächelnd und erklären freundlichst unser Anliegen. Dass wir Sambia toll fänden, aus Deutschland kämen und mit der Liemba fahren wollen. Ob wir vielleicht den Hafen ansehen und ein paar Fotos machen könnten? »No photo«, gibt einer der Beamten von sich. Dabei schaut er diktatorisch durch seine schlecht verspiegelte Brille. Unbeweglich und immerzu geradeaus. Wir hören von Permits und Arrangements, von Security und anderen wichtigen Dingen. »No photo«, mahnt der Diktator noch einmal und winkt uns durch.
Vier klapprige Kähne liegen am Kai. Die Frachter Buragane und Sagamba werden nach Burundi aufbrechen, Rafiki und Murinzi sind auf dem Weg in den Kongo. In Säcke verpackte Cassava-Pellets werden von Hafenarbeitern in zerschlissenen Blaumännern verladen. Corporal Jacob Banda steht mit Kladde und Stift in der prallen Sonne und führt Strichlisten, weil selbst bei einer Lieferung für den Kongo alles seine Ordnung haben müsse. Er ist hoch erfreut über die Abwechslung und berichtet ausführlich von Maniok, dessen Wurzeln meist fermentiert und anschließend zu einer Art Brei oder Mehl verarbeitet würden. Getrocknet wirke Cassava auf den ersten Blick wie Gips, sei aber ein wichtiges Grundnahrungsmittel der Region.
Eine breite Teerstraße verbindet den Hafen mit dem Zentrum der Stadt, links und rechts von Gebäuden gesäumt, die wie Zeitzeugen einer längst vergangenen Geschäftigkeit wirken. Mpulungu muss schon bessere Tage gesehen haben. Überall leere Häuser mit zerborstenen Fenstern, windschiefen Dächern und bröckelndem Putz. Rolf ist begeistert und stürzt sich in die Ablichtung der einstürzenden Altbauten. Wie heruntergekommene Anhalter stehen sie am Straßenrand. So als wollten sie in eine bessere Zeit mitgenommen werden oder einfach nur raus aus der Tristesse.
Die endet tatsächlich weiter oben. Pulsierendes Leben entlang einer 500 m langen Einkaufsstraße. Laden reiht sich an Laden. Schilder mit verheißungsvollen Aufschriften wie Fiyakushala Guesthouse, Medeco Investment oder Uprising Zyanee hängen über den Eingangstüren und suggerieren boomende Geschäftstätigkeit. Im Roadside Special Bread hingegen wird am Verkaufstresen geschlafen, wenn das Brot ausverkauft ist. Gegenüber residiert der Platzhirsch: Maps Supermarket mit einem guten Angebot frischer Lebensmittel sowie Terrasse und Plastikstühlen. Der Laden gehört Alex, der jederzeit in seiner kleinen Ecke hinter der Kasse zu finden ist.
Alex bietet den besten Kurs des Landes. Der halbe Ort tauscht Geld bei ihm. Heimische Kwacha in fremde Dollar und umgekehrt. Ohne Bürokratie und Schlangestehen. Noch vor einiger Zeit wurde der Dollar fast überall akzeptiert. Nun jedoch hat die sambische Regierung ein Dekret erlassen und mit der ewigen Zweitwährung kurzen Prozess gemacht. Bezahlung ist offiziell nur noch in Kwacha möglich. Ein echtes Problem für Reisende, wenn es weit und breit keine Wechselstuben gibt und die einzigen zwei Banken vor Ort kein Interesse an funktionierenden Geldautomaten zeigen.
Wir kommen jeden Tag bei Alex vorbei. Auf eine Brause oder zwei. Lungern stundenlang mit Einheimischen auf der Terrasse herum, von der die Straße ohne große Mühe zu überblicken ist. Der Taxistand, die Bushaltestelle, der gesamte lokale Verkehr. »150 000 Einwohner leben hier«, wissen Mike und Cynthia, zwei Missionare von Youth for Christ, die seit Jahren in Mpulungu leben und regelmäßig bei Alex einkaufen. So viele Menschen in diesem kleinen Ort? »Die meisten wohnen in den umliegenden Siedlungen«, erzählen die gebürtigen Südafrikaner später bei einem gemeinsamen Abendessen in ihrem Haus. Ihre Organisation ist in mehr als hundert Ländern tätig und unterstützt in Zusammenarbeit mit den lokalen Kirchen soziale und medizinische Projekte.
»Beim aktuellen Choleraausbruch sind wieder einige Menschen gestorben«, berichtet Cynthia, eine gelernte Krankenschwester, während sie gefiltertes Wasser aus dem Tanganjikasee in unsere Gläser füllt. Aufklärung sei ein wichtiges Thema. Überall im Ort hängen Zettel, die über die Krankheit informieren. Vor beinahe jedem Shop sind Wassereimer und Seife zum Händewaschen aufgestellt. Initiativen und Aktionen, die in die richtige Richtung gehen. Sonst jedoch ist von einer Epidemie nichts zu spüren. Weder so etwas wie Quarantäne, noch irgendeine Art von Aufregung.
»Die schon wieder.« Hafendiktators Körpersprache am nächsten Morgen ist eindeutig.
»Wir kommen aus Deutschland und wollen …«
»Das weiß er doch schon«, zischt Rolf.
»… mit der Liemba fahren. Wissen Sie, wann das Schiff kommt?«
»Manchmal Freitag, manchmal Sonnabend. Wenn sie am Sonnabend kommt, dann meist recht früh.«
»Und wissen Sie …?«
»Bitte kommen Sie morgen wieder vorbei.«
»Seid ihr sicher, dass die Liemba wirklich fährt?«, fragt Dave skeptisch. Der Südafrikaner tourt seit seiner Pensionierung in einem Landrover mit Dachzelt durch Afrika. Eine Schiffspassage hat er nicht geplant, gesehen hätte er die Liemba aber schon ganz gern. Wir sitzen in der Küche der Nkupi Lodge, wo es sogar elektrisches Licht gibt. In Mpulungu fällt gern mal der Strom aus, vorzugsweise bei Einbruch der Dunkelheit. Charity hat für uns gekocht, was sie immer tut, wenn die Gäste es wünschen. Mit oder ohne Strom. Es gibt Fisch aus dem See, Kartoffeln und Gemüse.
Richtig heimelig könnte es sein. Die rustikalen Steinhütten der Lodge sind mit Stroh gedeckt und strahlen so etwas wie Gemütlichkeit aus. Toiletten und Duschen sind zwar außer Haus, aber picobello sauber. Wenn, ja wenn die Anlage nicht so vernachlässigt daherkäme. Überall trockenes Gestrüpp und unvollendete Bauvorhaben, die von mangelnder Kundschaft zeugen.
Still ist es trotzdem nicht, Dave redet ununterbrochen, als wolle er eine ganze Busladung Rentner wettmachen. Nach zwei Stunden gibt es nichts, was wir nicht über ihn wüssten. Rolf hängt ausgelaugt in den Seilen, ich bin erschöpft. »Ein Reisender soll Augen und Ohren aufreißen, nicht das Maul«, lese ich kurz vor dem Einschlafen in meiner Sammlung afrikanischer Sprichwörter und Weisheiten. Morgen ist Freitag. Liemba-Tag.
Am nächsten Vormittag sitzt der Diktator allein hinter seinem kleinen Klapptisch, wir stehen zu zweit davor.
»Good morning, Sir.«
»Nicht schon wieder.« Rolf verdreht die Augen.
»Wissen Sie, wann die Liemba kommt?«
»Sie wird pünktlich sein, aber niemand weiß, wann das ist.«
»Heute oder morgen?«
»Wenn sie bis 12 Uhr in Kasanga ist, dann heute. Sonst morgen.«
»Und wer …?«
»Niemand weiß das so genau.«
Am Sonnabendmorgen gegen 6 Uhr früh lässt die Liemba endlich von sich hören. Das Schiffshorn ruft laut und durchdringend ihr Publikum. Schaut her, da bin ich. Raus aus den Federn, der Zirkus ist da, die Ruhe vorbei. Wir sitzen kerzengerade im Bett. Der Countdown läuft.